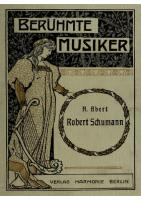Clara Schumann: Musik und Öffentlichkeit 9783412331801, 9783412194055
204 27 33MB
German Pages [568] Year 2009
Polecaj historie
Citation preview
Janina Klassen
CLARA S C H U M A N N
EUROPÄISCHE KOMPONISTINNEN Herausgegeben von Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld Band 3
Janina Klassen
CLARA SCHUMANN Musik und Öffentlichkeit
0 2009 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN
Die Reihe »Europäische Komponistinnen« wird ermöglicht durch die Mariann Steegmann Foundation
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagabbildung: Clara Wieck, 1840. Ausschnitt aus einer aquarellierten Zeichnung von Johann Heinrich Schramm.
© 2009 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau.de Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Satz: Peter Kniesche Mediendesign, Tönisvorst Druck und Bindung: Freiburger Graphische Betriebe Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in Germany ISBN 978-3-412-19405-5
INHALT Vorwort der Herausgeberinnen Einfuhrung und Dank I
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria Himmelblau und schwarzseiden Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne
II
III
1
Ohrringe oder Honorar Soziale und wirtschafdiche Aspekte
13
Mädchen und Monster Zeitgenössische Wissensdiskurse
25
Erinnerungen, Blumen- und Tagebücher Lebensdokumente
38
Tochter und Vater Frühe Nebel Kindheitserfahrungen
59
Künstlerin und Lehrer Ausbildung
68
Polonaisen, Walzer und Hexentänze Erste Kompositionen. Werke 1 bis 5
81
Wieck gegen Wieck Schritte in die Selbständigkeit
89
Starkult Torte und Lorbeerkranz Künsderischer »Durchbruch« Souvenir de Vienne op. 9
Inhalt
IX XI
99
Wie wird ein Star gemacht? Karrierestrategien
107
Die Nase zu groß, das Kinn zu spitzig Präsentation und Werbung
116
Auffliegender Phoenix Premier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6
123
V
IV
V
VI
Mignon und Meisterin Pressespiegel
133
Konkurrenz Nachahmung und Abgrenzung
147
Popularität und Popularisierung Das Verhältnis zum Publikum Bravour-Variationen op. 8 und Scherzo op. 10
161
Paar-Konzepte Inselstrasse 5 Die Leipziger Jahre
179
Künstlergemeinschaft Wünsche und Wirklichkeit DreiRomanzenop.il
196
Liederfrühling und Schubladenschätze Kompositionen der frühen 1840er Jahre
211
Idylle und Verlust Familienleben
232
Kontrapunkt und Kammermusik Werke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
255
Herr Kirchner und Johannes Beziehungsfragen
276
Handlungsreisende Chrystal Palace Industrialisierung und Kunstimperialismus
298
Schumann und etwas von Beethoven Repertoire und künsderisches Profil
316
Tempo! Geschwindigkeit und Interpretation
335
Lisztophobia Stationen eines komplexen Verhältnisses
351
Kaiserreich und Kanon Patriotisch und heilig Kunst und deutsche Politik
VI
379 Inhalt
Kanon und Museum Historistische Aspekte
395
Denkmäler aus Marmor und Papier Erinnerungskultur
408
Träumerei und Paradoxie Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
425
VII Generationen »Liebes Julchen« Erziehungsideale
441
Welcome to Frankfurt Die internationale Lehrerin
463
Nachleben Die Künsderin im 20. und 21. Jahrhundert
480
Wie wünsche ich mir meine Heldin? Biografisches Schreiben
496
Anhang
Inhalt
Bildnachweise
501
Siglen
503
Literaturverzeichnis
507
Werkverzeichnis
524
Personenregister
528
VII
Vorwort der Herausgeberinnen Clara Schumann als Komponistin? Oder: Die schwierige Frage der Profession Dass Clara Schumann, geb. Wieck, mit diesem Band in die Reihe Europäische Komponistinnen aufgenommen wird, bedarf auf den ersten Blick keiner Rechtfertigung, gehört doch gerade ihr Name zu den ganz wenigen, die regelmäßig genannt werden, wenn die Frage nach Komponistinnen gestellt wird. Clara Schumann verfugte bereits zu Lebzeiten über eine europaweite Popularität, und auch nach ihrem Tod blieb sie im kulturellen Gedächtnis: als Künsderin, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einer opulent dreibändigen Biographie gewürdigt und seither vielfach biographiert wurde, deren Konterfei auf dem 100-Mark-Schein und einer Briefmarke abgedruckt war, die in Schulbüchern als Beispiel für komponierende Frauen genannt und deren Leben mehrfach zuletzt 2008 - verfilmt wurde... Mit Clara Schumann scheint mithin eine der bekanntesten Komponistinnen in die Reihe aufgenommen zu sein. Auf den zweiten Blick jedoch stellt sich die Frage, ob hier nicht ein grundlegendes Missverständnis vorliegt. Ob nicht unter dem Lable »Komponistin« recht eigentlich eine Pianistin vorgestellt werden soll. »Nun, eine Komponistin war sie auch [...]. Und doch fuhrt's ein bisschen in die Irre. Denn bekannt wurde sie (und bedeutend bleibt sie) als Parteigängerin der Freiheit, als deutsche Demokratin«, bemerkte Benedikt Erenz in der ZEIT vom 19. Februar 2009 über den Band Johanna Kinkel. Romantik und Revolution von Monica Klaus, der 2008 in dieser Reihe erschien. Ahnlich könnte es über Clara Schumann heißen: bekannt wurde sie (und bedeutend bleibt sie) als Pianistin. Ihre Tätigkeit als Komponistin wäre dann als Nebenerscheinung ihrer Virtuosenkarriere zu betrachten, zumal Clara Schumann das eigene Komponieren, so Janina Klassen in diesem Buch, mit dem Tod ihres Mannes zu Grabe getragen hat. Warum also wird Clara Schumann in eine Reihe aufgenommen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, über das Leben und Wirken von Komponistinnen Auskunft zu geben? Die Frage rührt an Grundsätzlichem und betrifft dabei nicht nur Clara Schumann und Johanna Kinkel, sondern - mit nur ganz wenigen Ausnahmen — fast alle komponierenden Frauen der Musikgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. »Komponistinnen« im Sinne einer Profession waren viele nicht: Fanny Hensel ebenso wenig wie Barbara Strozzi, Antonia Bembo, Alma Mahler und viele andere. Und wenn dabei auch jeder Fall individuell zu betrachten wäre, allen ist eigen, dass diesen Frauen die Profes-
Vorwort der Herausgeberinnen
IX
sion des Komponierens qua Geschlecht nicht zuerkannt wurde. Denn weitab von Fragen des Könnens oder des Talents waren mit dem professionellen Selbstverständnis Dinge verbunden, die mit dem Ideal von Weiblichkeit und den daran anknüpfenden gesellschaftlichen Geschlechterbildern nicht konform gingen: etwa öffentliches Auftreten als Komponistin auf großer Bühne, das Leiten eines Orchesters, das Komponieren in >großen< Gattungen wie Sinfonie oder Oper, das kontinuierliche Veröffentlichen, Reputation, Erfolg, Geldverdienen u. a. m. So selbstverständlich die berufliche Karriere eines Komponisten - zumal seit der Verbürgerlichung der Musikkultur im 19. Jahrhundert - auf diesen Säulen der Professionalität aufbaute: vorgesehen waren diese Handlungs(spiel)räume ausschließlich für Männer. Hinzu kam, vor allem vor dem Hintergrund der Geschlechterdichotomien, wie sie das 19. Jahrhundert in allen Bereichen vorantrieb, dass mit dem Bild des Komponisten der Genie-Gedanke verflochten wurde und damit Schöpfertum als ausschließlich männliche Fähigkeit galt. Dass mit diesen Argumenten komponierende Frauen aus dem Bereich des Berufskomponistentums herausgehalten wurden, dass keine Frau »Komponist« in jenem emphatischen Sinne sein konnte, ist mithin ein historisches Phänomen. Und heute? Mit welcher Legitimation bezeichnen wir Clara Schumann als Komponistin? Sicherlich können wir den Begriff nicht in jenem dem 19. Jahrhundert nachhängenden Sinn verwenden. Wenn wir aber den Begriff offen lassen für die Vielfalt des musikkulturellen Handelns, wenn wir Komponieren und Interpretieren als ineinander verwobene, sich gegenseitig bedingende Wesensmerkmale der Musik wahrnehmen, wenn wir mithin die hagiographische Form des Begriffs »Komponist« (unter dem sich übrigens auch die Lebensläufe zahlreicher Musiker nur unvollkommen darstellen lassen - Franz Liszt mag hier als passendes Beispiel dienen) ad acta legen, ermöglicht er Einsichten in die vielen Facetten einer beeindruckenden Musikerin. Wohlgemerkt geht es dabei nicht darum, einen Schwerpunkt zu setzen, der in einem Musikerinnenleben nicht verwirklicht wurde (oder: nicht verwirklicht werden konnte). Aber es geht darum, das Komponieren zu benennen und die Umstände des Komponierens darzustellen. Janina Klassen hält in ihrem Buch eine wohl austarierte Balance zwischen der Pianistin und der Komponistin. Als Waage dient ihr dabei das intensive Nachzeichnen der (musik-)kulturellen Begleitumstände, die dazu führten, dass Clara Schumann als Virtousin jene Öffentlichkeit faszinierte, die sie als Komponistin nicht erreichte. Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld Berlin und Oldenburg, im August 2009 X
Vorwort der Herausgeberinnen
Einführung und D a n k Clara Wieck Schumann war ein Star - lebenslang. Sie wurde am 13. September 1819 in Leipzig geboren. Wenige Monate vor ihrem fünften Geburtstag trennten sich die Eltern. Das Mädchen wuchs beim Vater auf. In dieser Phase begann ihre Klavierausbildung. Von 1827 an setzte die Medialisierung ihrer Biografie mit einer auf die Öffentlichkeit gerichteten Perspektive ein. Die Virtuosin startete 1828 eine Wunderkindkarriere und stand von diesem Zeitpunkt an im Rampenlicht. Ihren internationalen Durchbruch als Star erlebte sie im Winter 1837/38. Nach der Hochzeit mit Robert Schumann 1840 setzte sie ihre Karriere fort, wenn auch in reduziertem Umfang. Mit ihrer ersten Tournee nach London 1856, im Todesjahr ihres Mannes, weitete sie den internationalen Wirkungskreis dann noch erheblich aus. Sie konzertierte bis 1888 regelmäßig in England. Darüber hinaus leitete sie von 1878 bis 1892 am Hochschen Konservatorium in Frankfurt am Main eine eigene Klavierklasse. Bis zu ihrem letzten öffentlichen Auftritt 1891 konnte sie sich ununterbrochen auf dem Podium behaupten. Clara Schumann starb am 20. Mai 1896. Ihre Karriere begann im vorindustriellen Zeitalter. In ihrem Geburtsjahr 1819 gründete Friedrich List einen Handels- und Gewerbeverein, der die verschiedenen Zollsysteme deutscher Länder einen sollte. List entwarf auch die Pläne für ein deutsches Eisenbahnnetz. Es wurde ab 1837 gebaut. Die Künsderin konnte sowohl das rasant wachsende Verkehrssystem als auch die sich neu bildenden kulturellen Organisationsstrukturen der bürgerlichen Gesellschaft nutzen. Schon das Mädchen nahm die Revolution von 1832 unmittelbar wahr: Vor dem Wieckschen Haus in Leipzig fanden Straßenkämpfe statt. In der Zeit des Vormärz sympathisierte die Künsderin mit den gemäßigten bürgerlichen Demokratiebewegungen, deren Zerschlagung sie 1849 missbilligte. Mitte des 19. Jahrhunderts begann ein neues globales technisches Zeitalter, dessen sichtbare Zeichen die erste Weltausstellung in London 1851 repräsentierte. Von der rasanten Industrialisierung der Gründerzeit profitierte auch Clara Schumann. Sie erwirtschaftete durch ihre Einnahmen ein sicheres Auskommen für sich und ihre Familie. Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 begrüßte sie als liberale Patriotin. Zum siebzigsten Geburtstag verlieh Kaiser Wilhelm II. ihr die »große goldene Medaille für Kunst«. Da galt sie als eine über alle Anfechtungen erhabene musikalische Autorität und authentische Zeugin der musikalischen »Romantik«, die rückblickend zum »Biedermeier« verklärt und verharmlost wurde. Einführung und Dank
XI
Während Clara Schumanns Künstlerleben entwickelten sich die öffentlichen Konzerte zu einem Forum anspruchsvoller autonomer Musik. Sie emphatisch zu verbreiten, hatte sich die Künstlerin schon in jungen Jahren vorgenommen. Den Weg vom unterhaltenden Genre bis zu einer in Andachtshaltung vollzogenen Musikpräsentation mit spezifischen Auftrittsritualen gestaltete Clara Schumann aktiv mit. Am Ende ihres Lebens waren Sinfoniekonzerte, Kammermusikreihen, Klavier- und Liederabende nicht bloß etabliert, sondern auch institutionalisiert, und sie bildeten eine eigene Sparte bürgerlicher Kultur, samt einem Kanon erlesener Meisterwerke, der noch gültig ist. Im Laufe des Jahrhunderts hat sich die ideologische Bedeutung von Kunst merklich verschoben. Sollte in der Spätaufklärung Kunst zu einer allgemeinen Menschenbildung beitragen, die das Bürgertum verwirklichen wollte, so überwog in den Konzepten des Vormärz die Funktion von Kunst zur Stärkung einer nationalen Identität in den politisch zersplitterten deutschen Ländern. Im Kaiserreich galt Kunst als Sache bürgerlicher Eliten, die für sich beanspruchten, die »hohe« Kunst als nationale Errungenschaft zu tradieren. Sie deklarierten neue Formen unterhaltender Massenkultur als »niedere« Kunst. Clara Schumann wollte beides: ihren Beruf als Künstlerin ausüben und eine Familie haben. Dieser Wunsch war im ideologischen Konzept der sich gerade formierenden deutschen Bürgergesellschaft für Frauen nicht vorgesehen. Allen Schwierigkeiten zum Trotz hat sie ihr Ziel nicht aus den Augen verloren und immer wieder Kompromisslinien gesucht, um das eine nicht gegen das andere vertauschen zu müssen, sondern die „Künstlerin mit der Hausfrau" zu vereinen, wie sie sich ausdrückte. Der strukturelle Konflikt mit allen seinen emotionalen, psychischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen durchzieht ihr Leben und macht es über ihr künstlerisches Wirken hinaus interessant, weil die daraus erwachsenden Alltagsprobleme auch heute immer wieder zu lösen und die schon von Clara Schumann gesuchte „Idealform" noch nicht gefunden ist. Die Erforschung von Clara Schumanns Biografie beflügelt ein neuer Aufschwung. Davon profitiert auch dieses Buch. Es knüpft an die Biografie von Berthold Litzmann sowie die neueren Publikationen von Joan Chissell, Nancy B. Reich, Eva Weissweiler, Beatrix Borchard, Claudia de Vries, Gerd Nauhaus, Renate Hofmann, Monica Steegmann und weiteren an. Großzügig durfte ich auf unveröffentlichte Materialien zurückgreifen. So konnte ich nicht nur die im Archiv des Robert-Schumann-Hauses in Zwickau aufbewahrten Jugendtagebücher Clara Wiecks einsehen. Gerd Nauhaus stellte mir auch seine Transkriptionen zur Verfügung, was die Arbeit wesentlich XII
Einführung und Dank
erleichterte. Auch die Einsicht der in Zwickau archivierten Briefe Clara Wieck Schumanns an ihre Mutter Mariane Bargiel und die Transkriptionen von Kristin R. M . Krähe ermöglichten es, neue Akzente zu setzen. Dafür bedanke ich mich sehr. Darüber hinaus förderten Thomas Synofzik, der Leiter des Robert-Schumann-Haus, und Anette Müller durch große Hilfsund Auskunftsbereitschaft den Fortgang. Sie gestatteten freundlicherweise auch die Wiedergabe von Bildern. Dafür danke ich auch Ingrid Bodsch vom Stadtmuseum Bonn und dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf für die Erlaubnis, Clara-Wieck-Schumann-Porträts nach ihren Vorlagen abzudrucken. Renate Brunner und Cathleen Köckritz überließen mir ihre umfangreichen Ausgaben und Untersuchungen noch vor Drucklegung - ein schönes Zeichen des Vertrauens, für das ich beiden sowie der Verlegerin Gisela Schewe sehr herzlich danke. Auch Beatrix Borchard, Silke Borgstedt, Reinhard Kopiez, Andreas C. Lehmann, Gerd Nauhaus, Julia M . Nauhaus und Matthias Wendt stellten mir noch unveröffentlichte Arbeitsergebnisse und Aufsätze zur Verfügung und Shinji Koiwa machte mir Ergebnisse seiner historischen Klangforschung zugänglich. Sie haben das Buch bereichert. Vielen Dank allen! Die opulente Dokumentation von Clara Schumanns Stieffamilie Bargiel aus der zweiten Ehe ihrer Mutter, die Elisabeth Schmiedel und Joachim Draheim gemeinsam herausgegeben haben, konnte leider nicht mehr berücksichtigt werden. Unter meinen anregenden Dialogpartnern, die immer wieder Ideen zu diskutieren bereit waren, möchte ich namentlich Gösta Neuwirth und Angela von Moos sowie Martin Günther nennen. Bei der Nutzung der Quellen wurde die ursprüngliche Grammatik und Orthografie ohne eingreifende Korrekturen übernommen, wie Clara Schumanns Abkürzung »ect.« (statt etc). Erstens bestanden im 19. Jahrhundert noch keine vereinheitlichten Rechtschreibnormen. Und zweitens wollte ich den Charakter der Zitate nicht beeinträchtigen: Flüchtigkeiten, grammatikalische Sonderheiten oder individuelle Namensschreibungen gehören auch zur Aussage der Äußerungen, die manchmal in großer Eile oder Erregung oder auch nach einem langen Arbeitstag in Müdigkeit notiert wurden. Clara Wieck entschied sich bei Hochzeit explizit für den Namen Schumann. Sie verzichtete auf einen Doppel- oder Künstlernamen, auch wenn sie in der einschlägigen Presse noch jahrelang mit ihrem Geburtsnamen angesprochen wurde. Dieser Entscheidung folgt der Namensgebrauch im Buch. Nicht ganz ist die Schumann-Literatur bei der Schreibweise von Claras Mutter einig: mal heißt sie »Marianne«, mal »Mariane«. Die erste Version ist heute üblich, die zweite könnte auf einem vergessenen »Faulheitsstrich« über dem »n« beruhen. Einführung und Dank
XIII
Oder leitet sich der Name von der schönen Schauspielerin Mariane ab, in deren Garderobe Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre beginnt? Der erste Band erschien 1795, zwei Jahre vor der Geburt von Mariane Tromlitz. Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld hatten es als Herausgeberinnen nicht leicht mit mir, da sich die Abgabe des Manuskripts immer wieder verschob, trotz der Hilfen von Friederike Litt, Simon Föhr und Martin Danneck. Sie beherrschten es, den nötigen Druck so verständnisvoll auszuüben, dass ich ihn als stete Ermutigung empfand. Ich danke ihnen dafür. Martin Greve und Lydia Jeschke übernahmen während der Entstehung des Manuskripts die Rolle aufmerksamer Testleser und füllten sie hervorragend aus. Die Darstellung verdankt ihren kritischen Rückfragen überaus viel. Zum Glück haben Frank Gertich, Sabine Sanio und Melanie Unseld alles noch einmal korrigiert, Sandra Danielczyk das Manuskript umsichtig vereinheitlicht und Stefan Körner das Register erstellt, damit ein schönes Buch daraus wird. Das war eine große Entlastung, vielen Dank! Janina Klassen
XIV
Freiburg, März 2009
Einführung und Dank
Z W I S C H E N KÖNIGIN LOUISE U N D Q U E E N VICTORIA
Himmelblau und schwarzseiden Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne »Was ziehst Du denn für ein Kleid an? Himmelblau?« Himmelblau, »ein weißer Zweig in den Haaren, eine weiße Rose vorne am Kleide, Deinen Ring [...] Warum erkundigst Du Dich so genau nach meinem Morgenden Concertanzug? ganz nach Deinem Geschmack soll ich mich kleiden - bist Du etwa da?« Nein, Robert Schumann reiste nicht spontan zur Uraufführung seiner zweiten Klaviersonate g-Moll op. 22 nach Berlin. Der Aufwand wäre zu groß gewesen. Die noch ganz neue Eisenbahn verkehrte im Februar 1840 nur auf wenigen Linien, Richtung Berlin erst ab Potsdam. Für die übrige Strecke hätte man Tage vorher schon einen Postkutschenplatz buchen müssen. Aber Robert Schumann wollte sich doch wenigstens des Bildes vergewissern, das ihm von Clara Wiecks Soirée vor Augen schwebte. Allein die Phantasie der imaginierten Szene versetzte ihn schon in Hochstimmung (Bw, S. 895ff). Die Uraufführung von Schumanns Sonate war allerdings ein Flopp. Das, was die junge Virtuosin dem Publikum im Saal der Berliner Singakademie zumutete, war zu neu, zu ungewohnt, zu avantgardistisch und alles ging viel zu schnell. Die Zuhörer harrten verständnislos aus und ließen das Stück über sich ergehen. In der Vossischen Zeitung erwähnte der Kritiker Ludwig Rellstab weder die Sonate noch ihren Komponisten namentlich, sondern kanzelte bloß pauschal die »verirrende Richtung« dieser so genannten »neuesten romantischen Schule« ab, mit deren Musik die Virtuosin Wieck ihr Publikum konfrontiert hatte (3. Februar 1840). Reilstabs Urteil hatte Gewicht. Als Rezensent formulierte er stellvertretend die Stimme des Publikums. Er vertrat und beeinflusste die öffentliche Meinung in und außerhalb Berlins entschieden. Rellstab galt als unbequemer, ästhetisch eher konservativer Beobachter, der indessen keine Konfrontation scheute. Schumann sperrte ihn zu den »Philistern«. Als Jugendlicher ein begabter Pianist, verfasste Reilstab erfolgreich Dramen und Libretti. Mehrere seiner Gedichte hat Schubert vertont. Er gewann immensen Einfluss, weil sein Urteil vielen als Richtschnur galt. Man schielte zuerst nach Rellstab, »was der für Miene macht«, um dann »entweder die Hände im Schoß [zu]
Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne
1
behalten oder [zu] klatschen«, so Clara Wieck (Jb, 1. Februar 1840). Immerhin hatte Rellstab 1826 fiir seine Gedankenfreiheit drei Monate Festungshaft in Kauf genommen. Den Anlass gab eine satirische Schrift gegen die Sängerin Henriette Sontag und dem ihr gewidmeten Verehrungskult. Zehn Jahre später kassierte er noch einmal vier Monate Festungshaft, weil er gewagt hatte, die Misswirtschaft des königlichen Generalmusikdirektors anzuprangern (Taddey 2005, S. 1548). Der Kritiker war unbestechlich. Seit 1829, als Niccolö Paganini ihm in Leipzig das zehnjährige Wunderkind vorstellte (Jb, 12. Oktober 1829), verfolgte Rellstab die Karriere der Clara Wieck mit skeptischem Interesse. Ihm ausweichen konnte man nicht, dazu war er zu einflussreich. Als Rellstab allerdings dann der jungen Frau bei einem privaten Empfang noch einmal leibhaftig gegenüberstand, da geriet der mächtige vierzigjährige Mann in Verlegenheit. Er war befangen. Die Höflichkeit, das gute Benehmen, die eingeübte Konversation: alles versagte. »Er hätte gern mit mir gesprochen, stand neben mir, setzte sich mir gegenüber, sah mich unverwandten Blicks an, mehrmals öffnete sich sein Mund schon, doch - er konnte nicht!« Clara Wieck ließ ihn schmoren. Sie genoss den kleinen Moment des Triumphs, den ihr die gesellschaftliche Konvention erlaubte. Rellstab hatte in seiner eigenen Zeitschrift Iris im Gebiet der Tonkunst 1839 öffentlich an Clara Wiecks künstlerischer Reputation gekratzt, weil ihm die ganze, von ihr vertretene >ultraromantische< Richtung nicht passte. »Ich hätte ihn angeredet, trotz allen Angriffen auf mein Spiel und meine Composition«, das Scherzo op. 10, schrieb sie ins Tagebuch. Als Kunstrichter stand ihm ein freies Urteil darüber zu, fand sie. Doch dass Rellstab sie persönlich attackierte und versucht hatte, sie »moralisch dem Publikum zu verdächtigen«, indem er behauptete, sie ließe sich von falschen Ratgebern beeinflussen, das ging zu weit. Im Hinblick auf die bevorstehende Uraufführung war ihre kleine Rache zwar taktisch unklug. Geschadet hat sie ihr insgesamt aber nicht. Ganz im Gegenteil. Rellstab respektierte ihre Gradlinigkeit. Im Laufe der folgenden Jahre wuchs sogar seine Verehrung mehr und mehr. Noch in einer seiner letzten Rezensionen (Vossische Zeitung, 21. Januar 1860) zollte er der Virtuosin höchste Achtung, obwohl er die Klaviermusik Schumanns bis zum Schluss nicht schätzte. Das schlichte Seidenkleid in himmelblau, der romantischen Farbe der Sehnsucht, Ferne und Treue, sowie die Liebe und Unschuld symbolisierende weiße Rose hatte Clara Wieck als Auftrittskostüm mit Bedacht gewählt. Die mit dem christlichen Marienkult verbundene Farbe himmelblau (»Celeste«) galt 2
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
im 19. Jahrhundert als ausgesprochene Mädchenfarbe (Heller 2006, S. 116f). Es waren die sichtbaren Zeichen ihres öffentlichen weiblichen Körpers, das einzige, was auf der Bühne zurückblieb, wenn die Musik verhallte. Im Unterschied zu Schauspiel und Oper, wo die Akteurinnen in Verkleidung durch Text und Dramaturgie entworfene Rollen übernahmen, spielte Clara Wieck eine ausschließlich immaterielle, klingende Kunst. Die Virtuosin artikulierte im Spiel die Stimme eines abstrakten, transpersonalen, musikalischen Subjekts (der musikalischen persona), das nach ästhetischen Vorstellungen der Zeit aus den Werken sprach, und sie formulierte die Musik in jeder Aufführung neu. Die physische Präsenz der Virtuosin, ihr Aussehen, die individuelle Physiognomie, die Mienen und Gebärden bei der Realisierung der Musik verschmolzen mit dem Charakter der raumfullenden Töne in der festlichen Atmosphäre des Saales zu einer auratischen künstlerischen Person. Dabei schoben sich die Darstellung der in die Musik einkomponierten Charaktere und deren Repräsentation, ihre Verkörperung, ununterscheidbar übereinander. Bei den Hörern wie bei der Interpretin selbst löste Musik konkrete, physisch spürbare Empfindungen aus, Herzklopfen, Tränen der Rührung oder »Gänsehaut«. Diese Reaktionen verbanden sich mit individuellen Erlebnissen, Erfahrungen und der eigenen Fantasiewelt. Aus der Zuschauerperspektive konnte man das Erlebte nun auf die reale Person am Klavier zurück projizieren. Alles zusammen formte das Image der Künstlerin in der Öffentlichkeit. Diese optischen und akustischen Zeichen von Clara Wiecks Auftritt enthielten über ihren öffentlichen Charakter hinaus auch private Informationen. Robert Schumann las ihren intimen nur für ihn dekodierbaren Sinn, als er sich die Szene, an der er nicht teilnahm, imaginierte: den Verlobungsring, das Symbol ihrer Verbundenheit, den das Publikum kaum bemerkt haben dürfte, die Robe, »einfach, lieb«, die Blumensprache (er hätte allerdings Myrthen bevorzugt, um ihren Brautstand zu bekunden) und die in ihrer Intensität exklusive, Zeit und Raum überbrückende, musikalische Kommunikation beider durch Musik. Tagelang setzte sich die Künstlerin mit jedem Detail der großen, komplexen Sonate auseinander. Der Kopfsatz, der so rasch wie möglich beginnen und am Ende schneller und noch schneller •werden soll, das Andantino mit seiner wehmütig-träumerischen Melodie, gefolgt von einem aufrüttelnden Scherzo und dem tosenden Finale: Presto - Prestissimo - Immer
schneller und schneller. Die Konzertbesucher goutierten dagegen zwar den optischen Reiz und die pianistische Bravour, sie kapitulierten aber vor der Musik, die als einHerrscherinnen auf öffentlicher Bühne
3
maliges Ereignis wirbelnd über sie hinweg flutete. Spärlicher Applaus, ein unbefriedigendes Feedback. »Eisig«, kritzelte Clara Wieck frustriert ins Tagebuch, »der Künstler muß nach und nach untergehen, wenn er immer unter solchen steifen Perücken sitzen soll«. Tatsächlich misslang das Experiment, »zum ersten Male etwas Größeres vom Robert« vor einem allgemeinen und nicht nur aus Musikexperten bestehenden Publikum aufzuführen (Jb, 1. Februar 1840). Trotzdem rechnete sich der Aufwand. Diese zweite Soirée in BerÜn war sogar noch besser besucht als die erste, die kurz zuvor stattgefunden hatte. Mit einem Gewinn von 220 Reichstalern verdiente die Zwanzigjährige nur durch die beiden Berliner Konzerte soviel wie ein niederer Staatsbeamter im ganzen Jahr (Bertz 2004, S. 57). Das Ziel, anspruchsvolle Musik zu verbreiten, gleichzeitig das Publikum zu begeistern, seine Aufnahmekapazität richtig zu taxieren und entsprechend dafür belohnt zu werden, war allerdings ein heikler Balanceakt. Sein erfolgreiches Gelingen, messbar an der Reaktion im Saal und der Resonanz durch die Kritik, bestimmte das Prestige der Virtuosin. Clara Wieck verkörperte als junge Künstlerin ein tugendsames Ideal voller »Natürlichkeit« und mädchenhafter Anmut, wie es von den Frühromantikern in der preußischen Königin Louise (1776-1810) gefeiert worden war. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts betraten in Deutschland neben den gekrönten Häuptern nur Künstlerinnen und Künstler die öffentliche Bühne. Erst in der zweiten Hälfte fächerte sich die Szene auf, zunächst vor allem durch die politischen Parteien und deren Repräsentanten. Da bildete die Kunst bereits einen fest etablierten eigenen Bereich in der Gesellschaft. Ihr Publikum bestand aus der neuen Bürgerschicht und der noch weit über die Gründung des Kaiserreichs hinaus einflussreichen regierenden Aristokratie. Auf diese Gruppen zielten die künstlerischen Präsentationsformate ab. Nachrichten und Klatsch über Königshäuser wie Kunststars verbreiteten sowohl die politischen als auch die der Kunst und Mode gewidmeten Zeitungen. Künstlerinnen und Königinnen wussten dabei die Medien geschickt zu nutzten. Beide spiegelten in der allgemeinen Wahrnehmung, zumindest der Aufmachung und dem Benehmen nach, ein ihrer Zeit konformes Frauenbild, das man kollektiv von ihnen erwartete. Gleichzeitig wurden diese sich öffentlich exponierenden Frauen idealisiert, eben weil sie sich durch etwas Einmaliges, Besonderes auszeichneten, sei es durch den Königinnenstatus oder eine brillante künstlerische Leistung. Gerade der unauflösbare Widerspruch zwischen dem kollektiv Bekannten, mit dem man sich aus eigener Erfahrung identifizieren konnte, und der Bewunderung für das Außergewöhnliche 4
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
fachte ein anhaltendes Interesse an. Diese Paradoxie gehörte zur Prominenz und zum Starkult (Borgstedt 2006, S. 114f). Königinnen wie Künstlerinnen erzeugten Träume. Die von ihnen repräsentierten weiblichen Muster wurden nachgeahmt. Das wussten die Akteurinnen. Die Art ihrer Auftritte resultierte aus einem komplexen Prozess von wechselseitiger Beobachtung und Selbstbeobachtung. In der Öffentlichkeit stellten die exponierten Frauen sich so dar, wie sie wahrgenommen werden wollten (Esposito 2004, S. 28ff). Dabei spielte die Kostümierung eine wichtige Rolle. Schon im späten 18. Jahrhundert orientierte sich die aufgeklärte Aristokratie modisch oft nicht mehr an den Extravaganzen der Hofgesellschaft, sondern an einem auf »Natürlichkeit« basierenden Ideal. Insofern glichen die Selbstinszenierungen von Königinnen und Künstlerinnen einander, ohne dass die Distinktionsgrenzen zwischen den Ständen tatsächlich aufgehoben wären. Auf der sichtbaren Außenseite präsentierten öffentlich idealisierte Frauen einen Katalog von einschlägigen Tugenden. So galt die preußische Königin Louise in den Texten, die über sie verbreitet wurden, als liebesfähig, treu, innig, fürsorglich, natürlich und bescheiden, dabei sparsam. Das heißt, sie entsprach vollkommen den neuen bürgerlichen Idealen des 19. Jahrhunderts. Auch die Liebesheirat anstelle einer Eheschließung aus Staatsraison gehörte zu dem in der Öffentlichkeit kultivierten Bild. Das Königspaar duzte sich. Ein gusseisernes Herrscherporträt im Profil, von Leonard Posch um 1804 entworfen, vereinte Louise und Friedrich Wilhelm III. als partnerschaftliches »Doppelgestirn« (Novalis 1999, 2, S. 291). Diesem programmatischen Bildaufbau einer gleichrangigen harmonischen Gemeinschaft folgte noch Ernst Rietschel, der 1846 ein Doppelmedaillon der Schumanns als ideales Künstlerpaar entwarf (Abb. 7). W i e die neuen Bürger ließen sich im 19. Jahrhundert auch Königsfamilien in privater Sphäre mit ihren spielenden Kindern malen beziehungsweise später fotografieren. Der Louisenorden, den ihr Mann, der preußische König, zum Gedenken an die Königin stiftete, spricht diese familiäre Sphäre an. Er zeigt die Initiale »L« auf himmelblau emailliertem Grund, umringt von sieben ihre Kinder symbolisierenden Sternen. Man bekam ihn in Anerkennung karitativer, sozialer und erzieherischer Verdienste verliehen, obwohl die Grundlage für Louises Apotheose zum »Schutzgeist der Deutschen« ihre, wenn auch erfolglosen, politischen Verhandlungen mit Napoleon bildeten. An diesen Aspekt knüpfte das am Gedenktag für die Königin 1813 inaugurierte Eiserne Kreuz an, Belohnung für soldatische Tapferkeit (Wülfing/ Bruns/Parr 1991, S. 60ff).
Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne
5
Frühromantische Literaten wie Körner, Fouque, Novalis (Friedrich von Hardenberg), Brentano, von Arnim oder Kleist trugen wesentlich zur Verbreitung des Louisenmythos bei, indem sie die junge Königin zum Prototyp des hebenden, gütigen, empfindsamen Gemüts stilisierten, der mit den fiktiven literarischen Figuren der »schönen Seelen« der Natalie aus Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre oder der Clothilde aus Jean Pauls Hesperus verschmolz. Umgekehrt erzählt die Legende, wie die Königin auf der Flucht nach Ostpreußen in Goethes Lyrik Trost suchte, als sie dessen Lied des Harfners: » Wer nie sein Brot mit Tränen aß« aus dem Wilhelm Meister mit ihrem Diamantring in eine Fensterscheibe ritzte, so die eine Variante, beziehungsweise in ihr Tagebuch notierte, was beides schon im 19. Jahrhundert nicht mehr zu verifizieren war. Noch vor ihrem Tod steigerten sich die literarischen Hymnen bis zur Anbetung einer säkularisierten preußischen Madonna, die man sich innig zur Gefahrtin wünschte. Novalis' transfigurierte Muse (Sophie von Kühn) und die Königin verbanden sich zu einer überhöhten Idealfigur. Auch äußerlich glich Louise auf den vom Hof verbreiteten Bildern den ephemeren Romangestalten, da sie unter Verzicht auf ein zeremonielles Königshabit die gleiche zeitgenössische Griechenmode trug wie die Frauen der neuen Bürgerschicht. Literatur und Wirklichkeit konnten deshalb so nahtlos verbunden werden, weil die fiktiven Figuren den Rezipienten das Ausleben hochgesteckter Ideale gleichsam realistisch vorführten. Sie boten ein Modell für die Kultivierung neuer bürgerlicher Umgangsformen. Das an den Romangestalten beobachtete Verhalten Üeß sich als Richtschnur für die Selbstkonstruktion übernehmen, indem man sich zwar von der erfundenen Figur distanzierte, sich ihre Handlungsweisen aber aneignete. Allerdings glich der bürgerliche Alltag herzlich wenig der im Roman ausgebreiteten Versuchsanordnung. Von der realen Ohnmacht, die die Dichter ins Ideale flüchten hieß, um dort eine ästhetisch überhöhte Sittlichkeit zu kultivieren, drang im verklärten Rückblick auf Novalis' Muse im blauen Kleid wenig durch. Stattdessen wirkte in den 1830er Jahren, als die Generation der Frühromantiker schon verstorben war, allein die Semantik der idealisierten Sphäre nach. Clara Wieck verwischte in ihrer mädchenhaften Selbststilisierung auf dem Podium bewusst die Linien zwischen Fiktion und Realität, um eine bestimmte Bühnenillusion hervorzurufen. Ebenso spielte die Selbstausstattung des Studenten Robert Schumann in Lord Byronschen Attitüden mit durchlässigen Grenzen, und er transformierte die frühromantische, auf das Unendliche zielende Sprachtheorie in eine musikalische Poetik. Nicht die Apologie des Königshauses, sondern dessen selbst propagierter Anstrich von Verbürgerlichung inspirierte Novalis' Wunsch, der »Karakter6
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
zug der Neupreußischen Frauen, ihr Nationalzug« möge sich in der Ähnlichkeit mit der »liebenswürdigen« Königin ausdrücken (in: Link/Wülfing 1991, S. 239ff). Die in seinen schwärmerischen Artikeln mitschwingende Hoffnung auf ein Senken der Standesschranken oder gar die Humanisierung von Herrschaft, die eine Revolution auf deutschem Boden überflüssig machen würde, zerschellten an der Realpolitik. Stattdessen geriet der unter dem Pseudonym Novalis schreibende Friedrich von Hardenberg ins Visier der Uberwachungsorgane und machte sich des verbotenen »Politisierens« verdächtig. Den letzten Teil seine Louisen-Eloge kassierte die Zensur. Zwar pflegte der Potsdamer Hof ein bürgerliches Image und stellte mit den Jahrbüchern der Preußischen Monarchie sogar ein entsprechendes Publikationsforum für Nachrichten aus dem königlichen Familienleben bereit. Doch bedeutete diese Geste nicht, dass die bestehende ständische Hierarchie aufgehoben und die vom Herrscher auf die Untertanen gerichtete vertikale Kommunikation tatsächlich durch eine horizontale bürgerliche soziale Verständigung abgelöst würde. Das Königshaus pickte sich aus dem neuen bürgerlichen Humanitätsideal das heraus, was dem eigenen Wohlbefinden half, ohne die darin enthaltenen sozialen und politischen Konsequenzen zu ziehen. Während Johann Gottfried Schadow aus der Garderobe der jungen Damen antikisierende zarte Gewänder für seine Doppelplastik, die Prinzessinnengruppe, wählen durfte und die Schwestern in Sandalen auftreten ließ, behielt der König auch auf dem Sofa sitzend seine ordenbesetzte Uniform an. Das mit der freizügigen Griechenmode assoziierte Natürlichkeits- und Humanitätsideal, die Vision einer veredelten Menschheit, beanspruchte das Königspaar vor allem für sich selbst und im Umgang untereinander. Herzenswärme und Güte sollten die menschenfeindliche Starre der Hofetikette durchbrechen, liebevolle Zuwendung den drastischen, an Sadismus grenzenden preußischen Drill ersetzen, dem der König selber als Kind ausgesetzt war. Gleichwohl schickte auch Louise ihre Prinzen Friedrich Wilhelm und Wilhelm, den späteren Kaiser Wilhelm I., mit zehn Jahren auf die Kadettenschule. Die Kindheit war damit beendet. Nicht zuletzt bot die überschaubare, wohl geordnete, unpolitische, familiäre deutsche Innerlichkeit auch ein wirksames propagandistisches Gegenbild zum öffentlichen politischen Getöse des nachrevolutionären Frankreich. Bei der Verwandlung der Königin zur Schutzheiligen des deutschen Reichs nach 1871 musste daher in den Hintergrund rücken, dass die inzwischen auch orthografisch eingedeutschte Luise französisch sprach und schrieb (Link/Wülfing 1984, S. 269ff). Die bürgerlichen Intellektuellen und Künstler in Deutschland profitierten zunächst kaum vom Liebäugeln der Aristokratie mit den hohen Idealen. Bürger
Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne
7
galten nicht als ebenbürtige Gleichgesinnte und erst recht nicht als politisch gleichrangige Kraft im Sinne der französischen Citoyens. Die Oberschicht bediente sich zwar bürgerlicher Moden, änderte indessen ihre auf Privilegien gegründete Lebensform freiwillig nicht. Stattdessen entmündigte sie Dichter und Denker, beschränkte sie auf ästhetische Diskurse und knebelte sie dabei durch rigide Zensur. Seit den 1820er Jahren kämpfte Grillparzer in Wien gegen Beanstandungen der »Polizei- und Zensurhofstelle«, die seine Werke zurückhielt und die deren Rezeption behinderte (Grillparzer 15, S. 284). Auch die Entlassung und Ausweisung von sieben Göttinger Professoren (darunter Jacob und Wilhelm Grimm sowie Georg Gottfried Gervinus), die 1837 gegen die Aufhebung der Verfassung durch den hannoverschen König Ernst August protestiert hatten, fiel darunter. Musik verfügte über den Vorteil, unmittelbar, flüchtig und unbestimmt zu verhallen. Sie entführte ins unendliche Reich der Tone und musste stets neu generiert werden. Mit dieser Kunst konnte man reüssieren. Hier öffnete sich nicht bloß ein ästhetischer Freiraum für die autonome Instrumentalmusik, sondern auch ein sozialer und ökonomischer Bereich für den Aufbau einer Existenz. Allerdings behandelte man - auch über die 1840er Jahre hinaus - in den feudalen Salons Virtuosen wie Clara Wieck oder Franz Liszt, die diese neue Musik verbreiteten, ungeachtet ihrer großen Erfolge im Konzertsaal oft noch wie Dienstleister, selbst wenn sie sich äußerlich gar nicht mehr von den anwesenden Herrschaften unterschieden. »Welche Rolle hat man uns Musikern dabei zugedacht«, fragte Liszt schon 1834. Was sollte man halten von »Bedienstetentreppen, welche Künstler und Künsderinnen ersten Ranges wie Moscheies, Rubini, Lafont, Pasta, Malibran usw., in aristokratischen Häusern Londons benutzen mussten?« (Liszt, Sämtliche Schriften, 1, S. 13). In der Berufs- und Klassen-Gesellschaft der Gründerzeit konzertierte Clara Schumann unter wesentlich veränderten politischen, sozioökonomischen und mentalen Voraussetzungen. Nicht mehr die Sehnsucht nach einer durch Ideale transzendierten Existenz, sondern die biedere Verklärung eines einfachen Lebens im trauten Familienkreis bildete den Horizont bürgerlicher Selbstkonstruktion, dokumentiert schon an der schmucklosen, hochgeschlossenen, schwarzen oder anthrazitfarbenen Mode. Korsagen sorgten für züchtige Haltung. Hemden, Mieder und Unterkleider, weit schwingende, über ausladenden Krinolinen (steifen Rockstützen aus Rohr, Draht und Rosshaar) in üppige Falten gelegte lange Röcke verdeckten die tatsächliche Körpersilhouette. Luxus zeigte sich als Understatement lediglich in den dezenten, aber kostbaren Stoffen, Krägen und Manschetten (Bertz 2004, S. 14f.) bezie8
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
hungsweise dem »Putz« (Hauben, Bändern, Knöpfen und Taschchen). Man wollte nicht auffallen. Selbst die Tisch- und Flügelbeine wurden durch dicke Decken den Blicken entzogen. Neben einer moralisch fundierten Bescheidenheit und einem veränderten Verhältnis zum eigenen Körper bot die Modellier- und Verhüllungsmode aber auch einen gewissen Schutz. Es kursierte nämlich eine neue evolutionsbiologisch ausgerichtete Charakterforschung, nach der man die innere Konstitution eines Menschen an seinen äußeren Merkmalen, einschließlich der gewählten Kleidung, ablesen könnte. Sie bot trivialpsychologischem Klatsch ein breites Feld. Daher verhielt man sich besser vorsichtig und bemühte sich um Dezenz, Zügelung des Temperaments und Körperkontrolle. Bloß keine Emotionen preisgeben. Nach Richard Sennett lag hier der Ursprung der verkniffenen viktorianischen Prüderie mit ihren gehemmten körperlichen Gesten (Sennett 2004, S. 220ff). Die kollektive Furcht, zuviel von sich zu entblößen, beeinflusste stark die Lebensgefühle und Verhaltenscodices. Das spiegelte sich im Konzertsaal in einer rigideren Kontrolle des Hörerverhaltens wider. Man beobachtete sich gegenseitig, versuchte möglichst konzentriert zu lauschen, klatschte nicht zwischendurch, sondern wartete mit dem Applaus bis zum Schluss, kommentierte nicht lautstark die Darbietung und blieb auch bei tiefster Rührung oder mitreissendem Aufruhr sittsam sitzen. Auch auf die Virtuosen selber wirkte ein derartiges Verhalten zurück. Clara Schumann, die als Mädchen sehr temperamentvoll agitiert hatte, nahm nach zeitgenössischen Beschreibungen später eine bemerkenswert kontrollierte Auftrittshaltung ein und vollführte nur mehr sparsame körperliche Bewegungen beim Spiel (de Vries 1996, S. 312). Den Prototyp der neuen schlichten Bürgerlichkeit repräsentierte die englische Königin Victoria (1819-1901). Sie verzichtete klug auf die Schönheitskonkurrenz zu den sich märchenhaft inszenierenden Kaiserinnen Eugénie, der Frau von Napoleon III., oder Elisabeth von Osterreich, die sich zur Krönungsfeier als Königin von Ungarn im Pariser Mode-Atelier von Charles Frederick Worth ein verschwenderisches Illusionsobjekt aus »tulle étoilé« schneidern ließ, dessen Modell einige Jahre zuvor als Kostüm der Königin der Nacht gedient hatte (Vogel 2002, S. 229f). Jahrhundertelang war das Königshabit symbolisch mit magischer Macht aufgeladen gewesen, so dass allein seine Berührung etwas davon vermittelte. Noch 1861 ließ sich die abwesend trauernde Queen Victoria bei der Parlamentseröffnung durch die auf dem Thron liegenden Staatsgewänder symbolisch vertreten (Weis-
Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne
9
brod 2002, S. 249ff). Nun wurden sie zum Modeartikel. Das aus der Oper kopierte Krönungskleid zeigt, wie durchlässig die gesellschaftlichen Schranken in der Mode längst waren. Dresscodes nutzten Geburts- und Geldadel gleichermaßen. Doch steckte hinter der königlichen Hieatralisierung auch ein politisches Kalkül. Sie diente der Popularisierung der Monarchie in einer Zeit neuer bürgerlicher Masseninszenierungen. Victoria wählte indessen nicht bloß ein puritanisches Outfit. Sie besetzte auch erfolgreich das Bild einer »Family-Queen« der »Middleclasses«. Ihr Habitus versprach eine volkstümliche Monarchin von behaglicher »Gemütlichkeit« (die Queen benutzte den deutschen Ausdruck), die das Modell Familie als Hort intimer Humanität verteidigte. Damit verdeckte sie die tatsächlichen imperialistischen und kapitalistischen Verhältnisse (Sennett 2004, S. 36). Paradoxerweise gelang es ihr gerade durch diese bürgerliche Selbstmystifikation, jahrzehntelang die Macht zu behalten, trotz Wahl- und Parlamentsreform, dem krisenhaften sozialen Wandel der Industriegesellschaft und dem eruptiven Kräftefeld der sich neu ordnenden politischen Weltkarte. Hierbei spielte nicht zuletzt die Wirkung öffentlicher Bilder eine wichtige Rolle. Die Königin nutzte eine Popularisierungsstrategie, um das Mitsprachebegehren und die Teilhabe der Bevölkerung an der Macht aufzufangen und im Interesse der Monarchie zu steuern. Auf gemeinsamen Porträts blickte die Queen andächtig zu ihrem stattlichen Prinzgemahl hoch, nicht nur aufgrund ihrer kurzen Gestalt, sondern weil diese geschlechterhierarchische Paaransicht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Staatsporträt favorisiert wurde, obwohl sie die royalistische Rangordnung umkehrte. Der Prinzgemahl hatte hinter der Königin zu stehen. Dagegen entsprach der Figurenaufbau im Porträt vollkommen dem bürgerlichen Familienbild der Gründerzeit. Ähnlich arrangierte Bildmotive verteilten auch die Schumanns von sich, wie etwa das biedermeierliche Paarporträt, das Eduard Kaiser 1847 in Wien anfertigte, oder die einzige bekannte, in Hamburg 1850 aufgenommene Daguerreotypie des Paars. Sie bekräftigten einerseits den Anschein bürgerlicher Familienhierarchie. Andererseits verbreiteten die Schumanns mit Ernst Rietschels Doppelmedaillon von 1846 eine davon abweichende visuelle Information über sich als gleichrangiges Künsderpaar (Abb. 8,10 und 7). Im Unterschied zur louisenhaften Muse im blauen Kleid, die Clara Wieck repräsentiert hatte, zeichnete Clara Schumann sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äußerlich durch ein eher bescheidenes Auftreten in meist schwarzer Kleidung und inhaltlich durch eine imperialistische künstleri10
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
sehe Souveränität aus. Als Witwe ähnelte sie mehr dem von Queen Victoria repräsentierten Modell. Im selben Jahr als die gleichaltrige junge Königin den englischen Thron bestieg, 1837, gelang der Virtuosin der internationale Durchbruch als Star. Beide verstanden es auf ihre Weise, die öffentlichen Bühnen zu nutzen, um Massen zu begeistern: die Queen durch die publikumswirksame Inszenierung ihrer Krönung, Clara Wieck durch ihre Auftritte in den damals größten europäischen Konzertsälen. Beides wurde von der Presse lebhaft popularisiert. Abgesehen vom Kleiderstil finden sich zahlreiche weitere Entsprechungen zwischen Clara Schumann und der englischen Königin. Die Königin repräsentierte (im juristischen Sinne) einen öffentlichen politischen Körper, Clara Schumann einen durch ihre Kunstausübung definierten öffentlichen sozialen. Damit waren zugleich zwei unterschiedliche Macht- und Handlungsspielräume verbunden, ein politischer und ein kultureller. Obwohl beide anfangs noch zwei getrennte Sphären bezeichneten, überschnitten sich die politische und kulturelle Öffentlichkeit im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr. Schon Clara Wieck legte Wert darauf, dass bestimmte Nachrichten über sie in »politischen Blättern« verbreitet würden. In der zweiten Jahrhunderthälfte herrschte Clara Schumann auf dem Gebiet der Kunst, die längst nicht mehr auf die kulturelle Infrastruktur der Aristokratie angewiesen war, so souverän wie die Queen in der Politik. Mit einem Publikum von viertausend Zuhörern hatte die Schumann im Londoner Chrystal Palace 1865 ein Maximum erreicht, das sich quantitativ nicht mehr steigern ließ, weil selbst die großen Broadwood-Flügel den Ton nicht weit genug trugen, um noch größere Räume zu beschallen. Hart arbeitend, uneitel, sparsam und genügsam kümmerten sich beide Frauen - Clara Schumann wie die Queen - in straffer Organisation zugleich um ihre familiären Angelegenheiten. Alles blieb unter strenger Kontrolle. Beide Frauen überhöhten ihr Glück durch die sichtbare Verehrung der geliebten Ehepartner, um die sie beide 40 Jahre lang öffentlich trauerten und deren Hagiographie sie erfolgreich betrieben. Clara Schumann plante nach dem Tod ihres Mannes 1856 sogar, selbst eine Biografie über ihn zu schreiben (Litzmann 3, S. 14). Weder Clara Schumanns lebenslange Freundschaft zu Johannes Brahms, noch das jahrelange Verhältnis der Queen mit ihrem Diener John Brown beeinträchtigten ernsthaft den Witwennimbus. Im Fall von Brahms hat die im Laufe der Jahrzehnte sichtbare Belastbarkeit der in der Öffentlichkeit idealisierten Zuneigung den ehrbaren Status von Clara Schumann eher noch gefördert, weil ihr Gelingen als Zeichen eines wertvollen persönlichen Charakterzugs galt. Die Zeugnisse Herrscherinnen auf öffentlicher Bühne
11
ihrer Affäre mit Theodor Kirchner vernichtete sie allerdings vorsichtshalber (Kirchner, S. 5ff). Unermüdlich verbreitete die Künstlerin Robert Schumanns Musik, während Queen Victoria nachdrücklich auf den »beloved and perfect Papa« Prinz Albert verwies, dem sie fortwährend - zumindest rhetorisch - in Demut die Hände lcüsste. Sich selber beschrieb sie in einer »anomalous and trying position« (in: Schulte 2002, S. 182 und 185) und blendete damit sowohl ihre reale Macht als auch den Rangunterschied aus. Die größte Ubereinstimmung lag aber in der beispiellosen Dauer öffentlichen Wirkens beziehungsweise Regierens, Muster einer »triumphalen Beständigkeit und moralischen Verlässlichkeit« politischer Herrschaft (Weisbrod 2002, S. 237). Ein Jahr, nachdem die Queen ihr goldenes Thronjubiläum zelebrierte, feierte Clara Schumann 1888 ihr 60jähriges, »diamantenes« Auftrittsjubiläum. In der Musikszene garantierte die Schumann in einer Zeit dramatischer Veränderungen und rasanter Entwicklungen allein durch ihre fortwährende Präsenz ein Moment von Kontinuität und Stabilität. Als herausragende Zeugin der musikalischen »romantischen Schule« (Schumann, Mendelssohn, Chopin) verkörperte sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Beispiel lebendiger Tradition, die bereits nostalgisch verklärt erschien. Uber 60 Jahre hinweg verbreitete Clara Schumann artifizielle Musik und vermittelte kulturelle Werte, die im Ranking symbolischer Nationalgüter zu höchster Bedeutung aufrückten. Sie schaffte durch ihr Repertoire einen klassischen Musikkanon von Klaviermusik, dessen Inhalt als Teil des kulturellen nationalen Erbes galt. Das persönliche Zusammentreffen von Clara Schumann und Queen Victoria im April 1872 lud man die längst international prominente Pianistin in den Buckingham Palace ein - verlief allerdings katastrophal. Fassungslos registrierte die Virtuosin den kulturellen Analphabetismus und die in ihren Augen ungebührliche intellektuelle Schlichtheit der Königin. Vor allem kränkte sie der rigide Snobismus, durch den sie und ihre Kunst entwertet wurden. Hier prallten zwei Königinnen aufeinander. Im Licht bildungsbürgerlicher Ideale verkörperte Clara Schumann aufgrund ihrer Kompetenz und ihres professionellen Auftretens Souveränität, während sie nach standeshierarchischen Kategorien eben bloß eine Bürgerliche war. In den biederen Königsgewändern steckte eine ungebrochene herrschaftliche Arroganz. Schon der Anblick der korpulenten Queen, in »ganz gewöhnlichem schwarz-seidenem Kleide« und mit einer schlichten »Mullhaube« angetan, empörte Clara Schumann. Wie »sah sie aus!« Von den 700 geladenen Gästen 12
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
befanden sich bloß 100 im Saal, hinter ihren Stühlen stehend, während der Rest sich in den Nebenräumen vergnügte. Mit Hintergrundgemurmel begann die Vorstellung. Und während die Queen in der Pause eine Tasse Tee zu sich nahm, platzte im Nebensaal die Royal Band mit einem Potpourri herein. »Dann legten zwei Backpipers« los, in »schottischen Kostümen«. Man klärte die konsternierte Clara Schumann darüber auf, dass dies die Lieblingsmusik der Königin sei. »Ich war außer mir, wäre am liebsten gleich fortgelaufen.« Doch das Konzert war noch nicht zu Ende. Mit einem beiläufigen »sehr schön gespielt« eröffnete die Queen den zweiten Teil. Am Schluss gab es nicht einmal »ein Wort des Dankes. Das war mir im Leben noch nie passirt«. Stattdessen bot man den Künstlern in der Garderobe einen kleinen Imbiss, auf den Clara Schumann dankend verzichtete. »Mich sieht diese Königin nicht wieder bei sich, so viel weiß ich!« (in: Litzmann 3, S. 274).
Ohrringe oder Honorar Soziale und wirtschaftliche Aspekte Die Königinnen dienen als Referenz, um Clara Schumanns öffentliche Erscheinung im 19. Jahrhundert zu verorten. Gleichzeitig skizziere ich damit die besondere Mischung aus kontrollierter weiblicher Selbstkonstruktion, kollektiven Vorstellungen, kalkulierter Mythenbildung und Macht. Bei allen Ähnlichkeiten der öffentlichen Präsentation und dem einflussreichen Wirken klaffte jedoch zwischen der Königin und der aus der bürgerlichen Intelligenzschicht stammenden Pianistin ein fundamentaler Unterschied: Herrscherinnen verfugten kraft ihrer Geburt über eine statusgesicherte, repräsentative Autorität, deren Attribute sie öffentlich entfalteten (Habermas 1990, S. 60ff), während die Künstlerin ihre Reputation marktabhängig aufbauen und erhalten musste. Clara Schumann tat das durchaus selbstbewusst auf der Grundlage einer als angeboren verstandenen Gabe beziehungsweise Befähigung zur Kunst, deren außergewöhnlich effektive Beherrschung sie sich in einem weitgehend selbst bestimmten Bildungsprozess angeeignet hatte. Damit setzte sie der auf dem Geburtsrecht basierenden höfischen »upper-class paranoia« (Weisbrod 2002, S. 252) nicht nur die neuen bürgerlichen Werte einer Selbstbefähigung durch Fleiß und Arbeit entgegen. Vielmehr beanspruchte die Virtuosin hier stellvertretend für das Bürgertum die Kunst insgesamt zu vertreten. Der monarchistischen Genealogie, die die politische Herrschaft verankerte, Soziale und wirtschaftliche Aspekte
13
trat eine im neuen bürgerlichen Geschichtsbewusstsein konstruierte kulturelle Tradition gegenüber, als deren idealer Zweck die ästhetische Menschenbildung angesehen wurde. Sie sollte zugleich den Grundriss eines nationalen Profils bilden. Diese Aufgabe übernahmen die Bürger in eigener Regie. Daraus bezogen sie ihr Selbstverständnis und ihr Selbstbewusstsein. Aufgrund des allgemein wachsenden Kunstanspruchs und der gestiegenen Anforderungen führten schon im frühen 19. Jahrhundert anstelle von mehr oder minder befähigten Dilettanten zunehmend professionelle Künstler Musik öffentlich auf. Hier entstand ein neuer Arbeitsbereich für einen gewandelten Typus von Berufsmusikern, der gute Aufstiegschancen bot. Die allgemeine Aufwertung von Kunst im öffentlichen Ansehen und ihre durch eine ethische Implikation gestärkte Funktion im Interesse eines neu begründeten Nationalbewusstseins machten künstlerische Tätigkeiten attraktiv. Schon Clara Wieck verstand ihren Beruf als quasireligiöse Berufung zur Kunst. W i e ein Leitmotiv durchzieht daher der Satz »Meine Kunst lasse ich nicht!« ihre Tagebücher und Briefe. Er enthält sowohl die Selbstverpflichtung, sich ständig geistig weiter zu bewegen und ästhetisch voranzuschreiten, als auch die Aufgabe, Kunst zu vermitteln, das heißt die eigenen Erkenntnisse mitzuteilen und zu verbreiten. Dass ein Musikexperte wie Theodor Ave-Lallement nach einem sehr erfolgreichen Auftritt der Virtuosin in Hamburg 1840 »nicht eine Sylbe übers Spiel« verlor, sondern »meine Ohrringel« lobte, brachte sie wahrhaft in Rage. »Ich hätte ihn mögen prügeln!« (Bw, S. 917). Die Auftritte von Königinnen und bürgerlicher Künstlerin ereigneten sich in unterschiedlichen Foren von Öffentlichkeit. Politische Herrscher präsentierten sich bei Paraden auf Plätzen und Prachtstraßen vor ihren Untertanen, Künstler auf Bühnen oder in semiprivaten Salons. Theater, Galerien und Opernhäusern, aber auch allgemein zugängliche Parks und Musikpavillons gehörten zu Orten, an denen politische und künstlerische Öffentlichkeit zusammentrafen. Sie waren beliebte Begegnungsstätten, wo man sehen und gesehen werden konnte. Für die neue bürgerliche Kultur stand noch ein weiterer, soziologisch etwas anders gelagerter Aspekt im Vordergrund. Öffentlichkeit bedeutete hier die »Sphäre der zum Publikum versammelten Privatleute« (Habermas 1990, S. 86). Man traf sich als Gemeinschaft Gleichgesinnter, deren Interessen Kultur und Bildung hießen. Die Grenzen zwischen privat und öffentlich blieben in der bürgerlichen Sphäre fließend, da die Gemeinschaft aus der Vielzahl von kulturell gebildeten Individuen bestand (Koselleck 1990, S. 15f.; MeyerDrawe/Egbert 2007, S. 62). Zwischen dem intimen Familienkreis, den man 14
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
um einige Freunde erweiterte, und den Salons oder Musikveranstaltungen, in denen sich diese Freunde versammelten, bestand nur ein gradueller, dagegen zur politischen Öffentlichkeit auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach wie vor ein prinzipieller Unterschied. Noch die von den Schumanns in den 1840er Jahren bei sich zu Hause und im Gewandhaus veranstalteten »Quartettmorgen« zeigten die Uberschneidung zwischen privater und öffentlicher bürgerlicher Kultur. Die im häuslichen Salon vor geladenen Gästen privat gegebenen Konzerte wurden zur öffentlichen Angelegenheit und von der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung rezensiert. Grundsätzlich waren diese Veranstaltungen allen zugänglich. Doch in der Realität galt die Öffnung zwar gegenüber einer kunstsinnigen Aristokratie, also nach oben, nicht jedoch für die unteren Stände. Die Schäferin, deren Strohhut eine Zeitlang Mode war, zählte so wenig dazu wie ein im Bergwerk arbeitender Hauer. Literarisch wurde er zwar mystifiziert, weil er aus dem Urgestein unter der Erde wertvolle Schätze zutage förderte. Damit lieferte der Bergbau die Vorlage für eine der prominentesten deutschen M e taphern für die Arbeit von Künstlern, nämlich die in der Tiefe verborgenen Edelsteine freizulegen. Schumann nutzte sie auch zur Charakterisierung von Clara Wieck: »Wo Sebastian Bach noch so tief eingräbt, daß das Grubenlicht in der Tiefe zu erlöschen droht, [ . . . ] von all diesem weiß die Künstlerin« (GS 1, S. 251). Doch schloss man nicht nur Schäfer und Hauer selbst, sondern auch Arbeitslieder und Bergmannskapellen aus der sich herausbildenden bürgerlichen Hochkultur aus. Schon im 18. Jahrhundert gründete man in den Städten Musikvereine und -gesellschaften, in denen Mitglieder standesübergreifend auf unterschiedlichem Niveau in eigens dafür gemieteten Lokalen selbst musizierten. M a n traf sich in verschiedenen privaten bürgerlichen oder aristokratischen Salons zum Tee, spielte, las, unterhielt und bildete sich. Bei diesen semi-öffentlichen Veranstaltungen überwog Geselligkeit oft das Kunstinteresse. Ein gewichtiger Teil der Musikvereinsaktivitäten war ohnehin wohltätigen Zwecken gewidmet. Gleichwohl konnten die Vereine aufgrund ihrer Mitgliedsbeiträge auch aufwändigere Konzerte veranstalten. Allerdings boten die deutschen Städte selbst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch kaum Räume für ein größeres Publikum. Man nutzte Theater- oder Tanzsäle. Die Leipziger Konzertkultur war besonders ausgeprägt. Dort veranstaltete die Kaufmannschaft schon vor 1750 Konzerte. Seit 1763 leitete Johann Adam Hiller im Gasthaus »Zu den drei Schwanen« semiprofessionelle Aufführungen vor zwei- bis dreihundert Zuhörern. Auch Clara Wiecks Urgroß-
Soziale und wirtschaftliche Aspekte
15
vater, der Flötenvirtuose Johann Georg Tromlitz, wirkte bei Hiller mit. Durch die Einrichtung eines Konzertsaals im Gewandhaus besaß Leipzig seit 1781 einen eigens für Musik reservierten öffentlichen Aufführungsraum. Selbst das habsburgische Wien stand dahinter zurück. Erst 1831 (vier Jahre nach Beethovens Tod) stand der Konzertsaal der Gesellschaft der Musikfreunde als repräsentativer Aufführungsort zur Verfugung. In Leipzig abonnierte man zu dieser Zeit bereits Konzertreihen. Sie waren allgemein frei zugänglich für ein zahlendes Publikum. Dagegen praktizierten bürgerliche Salons in den aufstrebenden Städten ein halböffentliches Verfahren mit wechselnden Musizierenden, die ohne Gage spielten. Um teilnehmen zu dürfen reichte die Reverenz eines Freundes oder Bekannten. In kleineren Städten und in ländlichen deutschen Gegenden war dagegen auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Musikdarbietungen ohne die Mitwirkung des regierenden Adels nicht zu denken. Dessen Veranstaltungen behielten mitunter etwas Gönnerhaftes. Ins Schloss musste man eingeladen werden. Dazu waren in der Regel Beziehungen nötig. Außerdem spielte in den Kleinstaaten die ständische Gesellschaftsordnung nach wie vor eine wichtige Rolle. So blieben die an Kunst und Musik interessierten Gemeinschaften insgesamt klein und konnten, trotz bester Absichten, kaum professionelle Konzerte organisieren. Rein quantitativ fehlte ein Publikum, das die Kunst hätte tragen können. Und nicht immer fanden sich spielbare Instrumente. Daher zerschlug sich 1831 ein von den Wiecks in Töplitz geplantes Konzert, weil weder der Bürgermeister, noch der Apotheker des Ortes sein Instrument zur Verfugung stellen wollte, obwohl der preußische König gerade zur Kur weilte und seine Anwesenheit einer musikalischen Vorführung besonderen Glanz verliehen hätte (Jb, 24. Juli 1831). Noch war man auf die Aristokratie angewiesen, wollte man als Virtuose Karriere machen, denn die Auftritte in prestigereichen Adelshäusern trugen viel zur Bekanntheit bei. Dort gespielt zu haben bedeutete eine wichtige Werbung für die Virtuosen. Tatsächlich verhielten sich die aristokratischen Gastgeber keineswegs professioneller als die enthusiastischen Kaufleute, Lehrer oder Wirtshausbetreiber. Zwischen den Städten und den teils winzigen Fürstenhöfen zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Entstehung einer Kultur tragenden Öffentlichkeit. Vieles befand sich im Deutschland der 1830er Jahre im gesellschaftlichen Umbruch. Die verglichen mit England nur zögerliche Verbreitung bürgerlicher Konzerstrukturen hing mit der besonderen, regionalisierten, politischen Landschaft des vormärzlichen Deutschlands zusammen. Zu den 41 Staaten des Deutschen Bunds zählten vier Reichstädte und 37 Königs16
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
beziehungsweise Fürstentümer, oft konservative Monarchien. Dazu kamen unterschiedliche Wahrungen, verschiedene Zeit- und Maßeinheiten, eigene Zoll- und Steuersysteme sowie souveräne Zensurbestimmungen. Die miserabel gepflasterten Routen der in Postkutschen herumreisenden Virtuosen säumten Schlagbäume und Währungsgrenzen. Eine Münztabelle aus Sachsen-Meiningen-Hildburghausen rechnete 1830 für einen (preußischen) Reichstaler: »1 1/7 Meißnische Gulden; 1 1/5 Fränkische Gulden; 1 Vi Rheinische Gulden; 1 11/21 Markwährungsflorin; 18 Batzen; 24 Gute Groschen; 25 1/5 Leichte Groschen; 90 Kreuzer; 288 Leichte Pfennige; 576 Heller« (Otto 2002, S. 48). Hinzu kamen Goldmünzen wie die nach den Herrschern benannten Louisdor oder Friedrichsdor, die mit etwa fünf Reichstalern verrechnet wurden. Mit der Einrichtung des Zollvereins 1834 wurde der Warenverkehr erleichtert. Ein gesamtdeutsches Eisenbahnnetz, dessen Entwürfe Friedrich List in den 1830er Jahren ausarbeitete, befand sich gerade im Aufbau. Doch erst die Gründung des Deutschen Reichs 1871 und der Reichsbank 1876 schaffte einheitliche Maße sowie eine einheitliche Währung in Mark und Pfennig. Für die Wiecks spielten aber auch noch ganz andere Probleme eine Rolle: »Wir müssen doch gar mit großen Hindernissen kämpfen«, trug Friedrich Wieck 1832 ins Tagebuch ein, »in Deutschland die Revolution«, beziehungsweise deren Nachwirkungen, und in Paris »die Cholera« (Jb, 28. März 1832). Musikvereine wie durchreisende Musiker veranstalteten ihre Konzerte in der Regel auf eigenes Risiko. Um dafür ein öffentliches Publikum zu animieren, bedienten sie sich eines Subskriptionsverfahrens, einer Übergangsstufe zwischen exklusiven Privataufführungen und der späteren Praxis, an der Abendkasse eine Eintrittskarte zu erwerben. Auch Clara Wieck organisierte ihre Auftritte noch überwiegend so. Sie nutzte ein Netzwerk von Kontakten, um Empfehlungen für eine oder mehrere angesehene Familien in einer Stadt zu erhalten. Diesen Gastgebern bot sie Soireen im hauseigenen Salon an, immer vorausgesetzt, dass ein halbwegs funktionierendes Instrument zur Verfügung stand. Man lud dann den privaten Freundes- beziehungsweise Interessentenkreis zu einem geselligen Abend ein. Jetzt mussten die Künstler frappieren, damit sich möglichst viele Gäste während der nächsten Tage in die Subskriptionslisten eintrugen, die in bestimmten Buch- oder Musikalienhandlungen auslagen. Kamen genug Besucher zusammen, so lohnte es sich, ein Konzert zu wagen. Manchmal passierte es allerdings, dass die Zuhörer sich mit dem privaten Vorspiel begnügten und sich die Eintrittskosten für ein öffentliches Konzert sparten. »Von nun an müssen wir strenger seyn«, so Friedrich Wieck Soziale und wirtschaftliche Aspekte
17
in Braunschweig. »Der Virtuos muß nur vor Kennern privatim spielen - die Neugierigen mögen wenigstens Entrée bezahlen«. Trotz W i e c k s Bedenken kamen fünf Tage später doch 700 Menschen ins »Liebhaberconcert« (Jb, 10. und 15. Januar 1835). Nicht nur die gesamte Logistik leisteten die Künstler selbst, auch die anfallenden Betriebskosten für Saal, Beleuchtung, Heizung, Stühle, Instrumentenbeschaffung, das Engagement von Mitwirkenden, die Herstellung von Eintrittskarten, Programmzetteln oder Ankündigung mussten bezahlt werden. »Das Orchester hat abgesagt zu spielen, und so muß ich die Caprice von Thalberg noch schnell studieren, die ich gar nicht mehr in den Fingern hab. Alle Briefchen (was so zum Concert gehört) muß ich selber schreiben, Freibillette herumschicken, [ - ] Stimmer, Instrumententräger besorgen und dabei studieren?«, so beschrieb Clara W i e c k 1839 den Organisationsstress während der Reise (Bw, S. 352). Spätestens seit ihrem internationalen künstlerischen Durchbruch 1837 lag Clara W i e c k mit ihren Eintrittspreisen im oberen Segment. Ihre Tarife konnte ein Publikum in kleineren Städten nicht immer aufbringen. W e n n sie trotzdem in Gotha, Eisenach oder Stettin konzertierte, dann nicht zuletzt aus Gründen der Werbung. Als Alleinunternehmerin musste sie ständig im Gespräch bleiben. Noch während Clara W i e c k im August 1840 auf einer kleinen A b schiedstournee vor ihrer Hochzeit (»K.W. zum letzten M a l « , Bw, S. 1061) durch sächsische und thüringische Länder tingelte, war es aus Prestigegründen wichtig, von der örtlichen Aristokratie wahrgenommen zu werden. A n den Höfen zu spielen machte allerdings nicht immer Vergnügen. M a n lud die Künstler privat ins Schloss, stellte Salon und Instrument zur Verfügung, nahm aber ansonsten die Musizierenden wenig zur Kenntnis, unterhielt sich, las, spielte Schach oder trieb Unfug. Künstler boten meist nur eine akustische Tapete zur Unterhaltung. Selten gab es ein Honorar, öfters abgelegten Schmuck, den man dann versetzen konnte, manchmal ein Sandwich. Ausnahmen von diesen Erfahrungen waren so selten, dass Clara W i e c k sie sich extra notierte. So wurde sie im Februar 1839 vom Karlsruher Hof eingeladen. »Als ich spielte, stellte sich die ganze Fürstliche Familie um das Ciavier, und die Herzogin äußerte nun immer was zu hören sie wünschte. Sie kannte alles Neuere von Liszt, Chopin ect. Sie spielte selbst sehr gut. Das war der erste Hof, wo ich begeistert war - das will viel sagen«. Drei Stunden musste sie spielen. Als Dank schickte man ihr »ein hübsches Andenken« (Jb, 2. Februar 1839). »Keine Ohrbummeln«, erhoffte Clara W i e c k auch in Weimar: Sie erhielt ein »solides, schweres, sehr geschmackvolles Armband« von der Großherzogin M a r i a Pavlovna. Doch nicht nur deswegen »war's« in 18
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Weimar »so schön« und so ungewöhnlich, dass Clara Wieck den Abend ausfuhrlich dokumentierte. Vielmehr gelang es ihr im Sommer 1840 auch dort, die zerstreuungsbedürftige feudale Gesellschaft zum Zuhören zu bewegen. Anfangs strickten die Damen noch, »die Prinzeß Wilhelm«, die spätere deutsche Kaiserin, »besah Bilder, der Großherzog haschte sich mit dem kleinen Prinzen.« Doch dann horchte man auf, ließ die Handarbeiten sinken und zog nach und nach die Stühle heran, »um mir so zu sagen jeden Ton« abzulauschen. Auf Thalbergs »Mosesfantasie« (Fantaiesie sur des thèmes de l'opéra Moise de Rossini, op. 33) folgten Henselts Variationen über »Wenn ich ein VSglein wär'« op. 1, ihr eigenes Scherzo op. 10, danach noch eine Mazurka von Chopin, ein Mendelssohnsches Lied ohne Worte und Schuberts Erlkönig in der Klavierfassung von Liszt. Das wünschte der Großherzog sogar dacapo. Clara Wieck bot durchweg zeitgenössische Musik sowie eine Sonate des weitgehend unbekannten und von ihr erfolgreich verbreiteten spätbarocken Komponisten Domenico Scarlatti. An diesem Abend stimmte das Ideal Clara Wiecks, nämlich Musik als Kunst mit einem eigenen, hohen ästhetischen Wert zu vermitteln und nicht als bloß angenehmes Hintergrundsgeräusch. Zusammen mit dem wunderbaren Hörerlebnis registrierte man auch die Künstlerin als Persönlichkeit und begann sich freundlich nach ihr und ihrer Arbeit zu erkundigen, hakte nach, ließ sich etwas demonstrieren. »Ich war nicht mehr am Hof sondern in einem Familienkreis; fortwährend sprach man mit mir«, zeigte auch privates Interesse und gratulierte am Ende zur bevorstehenden Hochzeit. Die Großherzogin beschwor sie, ihre Kunst nicht aufzugeben, »was ich verneinte« (Bw, S. 1072f). In diesem speziellen Fall zog Clara Wieck es sogar vor, kein Geld, sondern ein persönliches Andenken zu bekommen. Die Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach und Schwester des russischen Zaren Alexander, Maria Pavlovna, galt selbst als ausgezeichnete Pianistin und komponierte auch. Aufgrund ihrer liberalen Ansichten zog sie viele Künstler an den Weimarer Hof, die unter Metternichs Zensur geflohen waren. Clara Wieck begeisterte die kunstsinnige Monarchin. Die in Weimar in der prestigereichen Abendgesellschaft gemachte Erfahrung bestärkte Clara Wiecks Hoffnung auf eine neue Hörerschaft, die sich standesübergreifend musisch weiterbildete. Darüber hinaus konnte der persönliche, einvernehmliche gute Kontakt bloß vorteilhaft sein. Allerdings nutzte Clara Schumann ihn später kaum aus, da die Großherzogin 1842 ihren Konkurrenten Franz Liszt als künstlerischen Berater an den Weimarer Hof band. Mit Clara Wieck, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Robert Schumann traten in den 1830er Jahren junge KünstSoziale und wirtschaftliche Aspekte
19
ler neuen Typs auf, die die Zeichen einer anbrechenden »poetischen« Zeit (Schumann) selbstbewusst definierten und mit profunder Professionalität nicht mehr nur ihre stupende Virtuosität vermarkteten, sondern zugleich ästhetisch hochwertige Musik vorstellten. Sie sahen sich als die aktiven Vertreter des Fortschritts und als die Kultur bildenden Kräfte der Nation an. In diesem Sinne übernahmen die neuen bürgerlichen Künstler Aufgaben, um die sich traditionell die Aristokratie gekümmert hatte. Man gedachte, deren Rolle zu ersetzen. Dementsprechend beanspruchten sie einen prominenten Platz in der bürgerlichen Gesellschaft. Dazu gehörte auch, ein angemessenes Honorar für die musikalischen Leistungen zu bekommen. Das neue Berufsfeld »freischaffender Künstler und Künstlerin« etablierte sich in dem Maße, wie sich die Kunst als sinnstiftende Instanz neben Religion, Philosophie, Wissenschaft und Moral zu behaupten wusste (Nipperdey 1998,1, S. 255ff). Dabei beeinflussten sich wechselseitig die ästhetische Aufwertung von Musik sowie die zunehmende Institutionalisierung der Kultur durch Konzerthäuser, Ausbildungsstätten oder Musikverlage, die zuverlässiges Auffiihrungsmaterial herstellten. Zur Etablierung von Kunst im allgemeinen Bewusstsein trug auch die dauerhafte mediale Präsenz der Stars bei. Sie wurde von der begleitenden Fachpublizistik und der einschlägigen Editionspolitik der Verlage wesentlich unterstützt. Das Publikum der Musikveranstaltungen bildete zugleich die Leserschaft der Tages- und Fachpresse. Sie garantierte schon seit dem 18. Jahrhundert eine dritte Form von bürgerlicher Öffentlichkeit. Bei der geselligen Konversation im Salon durfte jede und jeder über Kunst reden und die eigenen Empfindungen darüber mitteilen. Um der Unterhaltung ein sachliches Fundament zu geben, publizierte man eine Fülle von Nachschlagewerken zu Selbstbildungszwecken. Auch das von Carl Herloßsohn seit 1834 herausgegebene DamenConversations-Lexikon gehörte dazu. Robert Schumann steuerte einige musiktheoretische Artikel bei, wie »Ausdruck« und »Charakter« (GS 2, S. 204ff). Die Auflage von 1838 erhielt bereits einen Personenartikel über Clara Wieck. Musikzeitschriften überwanden die Kleinstaatigkeit, indem sie länderübergreifend auf deutsch verfasste Informationen für eine nur durch sie vernetzte Interessengemeinschaft boten. Gleichzeitig trugen Zeitschriften wesentlich dazu bei, eine »Nationalkultur« zu verbreiten. Kritik bekam dadurch einen anderen Stellenwert als im Pausengespräch. »Verherrlichung durch Worte« nannte Schumann als eine ihrer Funktionen (GS 1, S. 166). Sie artikulierte nicht nur die Stimme des Publikums, sondern enthielt (oder sollte enthalten) wesentliche Informationen zur Weiterbildung. Über Musi20
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
kalien, gehörte und gedruckte, schrieben herausragende Experten. Essays zur Musikgeschichte und Ästhetik ergänzten das Spektrum. Deutschlandweit bekannte Musikautoren und Kritiker wie Johann Friedrich Rochlitz (17691842), E.T.A. Hoffmann (1776-1822), Ludwig Rellstab (1799-1860) oder später Eduard Hanslick (1825-1904) besaßen eine profunde Ausbildung und umfassende Kompetenzen, oft auf mehreren Gebieten. Sie prägten eine bestimmte Metaphorik beim Sprechen über Musik aus. Kommerziell sich selbst tragende Zeitschriften ermöglichten eine wirtschaftlich eigenständige Existenz. Vom hohen Marktwert der auf das neue Bürgertum zielenden Publizistik profitierte auch Robert Schumann, als er 1834 die Neue Zeitschriftfür Musik {NZfM) gründete. Für die nächsten zehn Jahre sicherte die Zeitschrift dem noch kaum bekannten Komponisten zwar nicht den Lebensunterhalt, aber doch eine stabile Einnahme. Das Rückgrat der NZfM bildete die ausfuhrliche Besprechung neuer Musikalien. Außerdem bot sie programmatische ästhetische, musiktheoretische, aber auch historische und Personenartikel, berichtete durch Korrespondenten von Musikveranstaltungen aus anderen Städten und rubrizierte Kurzinformationen über Neuerscheinungen oder musikalischen Gesellschaftsklatsch. Wie Heinrich Laubes parallel erscheinende Zeitung für die elegante Welt beherzt in politische und gesellschaftliche Belange eingriff, so übernahmen die Musikzeitschriften im Vormärz eine ausgesprochene Vorreiterposition in musiktheoretischen und ästhetischen Fragen. Beflügelt durch den Auftrieb der Künste im allgemeinen Bewusstsein instruierte die Musikkritik das Publikum aktiv. Damit steuerte sie zugleich den ästhetischen Diskurs. So rebellierte Robert Schumann erfolgreich gegen Rellstabs konservative Enge und verfocht konsequent seine eigenen Utopien. Schumanns Proklamation einer neuen »poetischen« Zeit, in der Kunst und Politik auf höherer Ebene verschmelzen würden, begann als schwärmerisches Experiment. Hier erschien Musik nicht allein autonomieästhetisch aufgewertet. Sie wurde außerdem als eigene Rubrik in den bürgerlichen Bildungskanon eingegliedert. Mit seinen programmatischen Entwürfen und zugespitzten Positionen setzte Schumann Maßstäbe und lieferte literarisch unterhaltsame, ansprechende Beschreibungen samt kritischen Vergleichen und vertiefenden Analysen von Musik. Musikalische Beilagen, oft Auftragskompositionen, machten Werke junger Komponistinnen und Komponisten bekannt. Clara Wieck steuerte für die Septemberausgabe 1839 ihre g-Moll-Romanze op. 11 Nr. 2 bei. In dieser Aufbruchstimmung bot die Zeitschrift eine öffentliche Schnittstelle von Musikinformation und Selbstbildungsmöglichkeit. Schumanns Artikel ziel-
Soziale und wirtschaftliche Aspekte
21
ten auf eine qualitative Steigerung des allgemeinen Musikverständnisses. Damit unterstützte die Musikpublizistik theoretisch, was in der Öffentlichkeit umschwärmte Künstler wie Clara Wieck oder Felix Mendelssohn Bartholdy wirkungsvoll im Konzertsaal umsetzten, nämlich eine ästhetische Erziehung des Publikums. Beide Ansätze spekulierten mit dem geschichtlichen Potential einer in der Zukunft sich entfaltenden Wirkung von musikalischer Erziehung und ästhetischer Selbstbildung. Vorerst erklang die in der Neuen Zeitschrift fiir Musik kommentierte »avantgardistische« Musik zwar nur in kleineren Expertenkreisen, da ein gemischtes Publikum, wie Clara Wiecks Erfahrung in Berlin zeigte, noch überfordert war. Doch später - so jedenfalls die Vision - würden auch die Zuhörer allgemeiner öffentlicher Konzerte über größere Kompetenzen verfugen und die jetzt noch »hieroglyphische« neue Musik verstehen und genießen lernen. Autonome Kunst musste sich behaupten zwischen einer uneingeschränkten ästhetischen Freiheit und pragmatischen Kompromissen, die auf ein zahlendes Publikum reagierten. Den Zuhörern einen Zugang zur neuen Musik zu ermöglichen war notwendig. Das Zutrauen eines zahlenden Publikums gehörte zur Voraussetzung, wollte man durch Kunst eine verlässliche materielle Sicherheit erwirtschaften, um Familien zu gründen. Sukzessiv verschwand mit den gesteigerten ästhetischen Ansprüchen der gesellige Anteil bürgerlichen Musizierens. Anstelle der begeisterten Musikliebhaber und Förderer, die noch bei Uraufführungen von Beethovens Sinfonien an den ersten Pulten spielten (oft allein aufgrund ihres höheren gesellschaftlichen Stands), etablierten sich jetzt professionell ausgebildete Spezialisten. Sie führten M u sik Kultus gleich auf einer Bühne aus, während das Publikum seine Konversation einzustellen und so diszipliniert wie andächtig zu lauschen hatte. In den neuen Konzertsälen zelebrierte man anspruchsvolle Musik. Gesellige Musizierbedürfnisse mussten andernorts erfüllt werden, in Tanz- und Blaskapellen, Chören, Musikvereinen oder in der Hausmusik. In dieser Kette von ästhetischen Entwürfen, Aufführung und Vermittlung von Kunst sowie Bildung des Publikums funktionierten Virtuosen wie Clara Wieck Schumann als wichtige Bindeglieder. Sie profitierten dabei ganz erheblich vom Werbeeffekt, den Presseartikel über sie und ihr Wirken verbreiteten. Die Stimmen der jungen Intellektuellenschicht des Vormärz drangen erfolgreich im öffentlichen Diskurs durch, trotz einer allgemeinen, in den einzelnen Ländern allerdings unterschiedlich streng ausgelegten Zensur. Deren Aufhebung forderte der Deutsche Börsenverein 1842 vergeblich. Gerade die Verbote erregten indessen auch eine besondere Neugier, wie die Rezeption
22
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
von Heines Schriften nach 1835 zeigte. Tatsächlich bestand die Gruppe von Intellektuellen nur aus einer kleinen Minderheit. Schumanns Neue Zeitschrift ßir Musik verzeichnete 1838 nach seinen eigenen Angaben 450 Abonnenten (Bw, S. 117). In Städten wie Weimar und Leipzig mit ihrem reichhaltigen Kulturspektrum dürfte der Anteil der Bildungsbürger etwa zwei bis drei, in der deutschen Gesamtbevölkerung weniger als ein Prozent betragen haben (Charle 1997, S. 37ff). Nicht nur gegen die politische Ohnmacht, sondern auch als bewusste Abgrenzung vom Gebaren der Aristokratie praktizierten die bürgerlichen Intellektuellen einen verstärkten Privatkult. Man deklarierte die Intimität der bürgerlichen Familie zum wahren Hort von Humanität und zur Keimzelle eines sich in diesem Sinne entfaltenden menschlichen wie künstlerischen Fortschritts. Dort pflegte man eigene Rituale im Umgang mit Kunst. Insgesamt begann sich die bürgerliche Musikszene in den 1840er Jahren allmählich zu institutionalisieren. Diese Entwicklung setzte sich in der frühen Gründerzeit nach 1850 fort. Aus dem labilen Netzwerk künstlerischer Verbreitung bildeten sich deutlich festere Strukturen heraus. Mit der Eröffnung des Leipziger Konservatoriums 1843, die Mendelssohn Bartholdy initiierte, erfolgte ein bedeutender konkreter Schritt zur Verwirklichung der proklamierten Bildungsideen. So begannen in Leipzig 33 Männer und elf Frauen ein professionelles Musikstudium und ließen sich zu Berufsmusikern ausbilden. Auch privat gelang es Künstlern wie den Mendelssohns oder Schumanns, achtbare bürgerliche Existenzen aufzubauen. Ihr wachsendes Prestige wurde etwa daran sichtbar, dass man Biografien über sie lesen konnte. Franz Liszt entwarf 1849 eine erste Chopin-Biografie, und Wilhelm von Wasielewski bat Clara Schumann schon drei Wochen nach dem Tod ihres Mannes 1856 um Unterstützung für eine Schumann-Biografie. Die Begräbnisse dieser Künstler waren bereits öffentliche Ereignisse. Allerdings blieb der Verteilungskampf um die Verdienstmöglichkeiten auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hart. »Kultur« wurde zum Markenzeichen des Bürgertums. Man besuchte Konzerte, ging in die Oper, sah Theaterstücke und bestaunte Ausstellungen. W i e schon die Wiecks während der Tourneen in den 1830er Jahren, so besichtigten auch die Schumanns, ausgerüstet mit den ersten »Baedekern«, in den 1840er und 50er Jahren auf ihren Reisen Sehenswürdigkeiten. Außerdem gehörte nun Hausmusik zu den neuen, selbst auferlegten bürgerlichen Pflichten. Daher studierten am Konservatorium nicht nur künftige Sängerinnen und Sänger oder Orchestermusiker, sondern auch Musiklehrerinnen (Lehrer kamen erst später hinzu), für die sich ein neues Berufsfeld öffnete. Soziale und wirtschaftliche Aspekte
23
Mit der Entwicklung der neuen Musik konnte das Publikum dennoch nicht mithalten. Dieser Teil der Bildungsutopie erfüllte sich nicht. Stattdessen genoss man es, das Repertoire, das man zu Hause in leichteren Fassungen am Instrument probierte, im Konzertsaal vollendet aufgeführt zu hören. So ergänzten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Kammermusikreihen und Liederabende das Spektrum der Veranstaltungen. Tatsächlich gelang es erst in den 1860er Jahren, die »klassische« und »romantische« Musik früherer »Avantgardisten« einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Von da an wurde ein Teil der Stücke dauerhaft im Repertoire verankert, wie Beethovens Streichquartette, Schumanns Klavier- und Kammermusik oder Schuberts Liederzyklen. Hierbei spielte Clara Wieck Schumann eine zentrale Rolle. Mit 59 Jahren nahm die Virtuosin erstmals eine feste Stelle am 1878 neu gegründeten Hochschen Konservatorium in Frankfurt am Main an. Frühere Angebote hatte sie platzen lassen, weil sie sich nicht entschließen konnte, ihre Freiheit aufzugeben. Bis dahin boten Konzertreisen der international geschätzten Virtuosin bessere Verdienstmöglichkeiten. Ihre hervorragende Position in Frankfurt spiegelte die gewandelte Lage bürgerlicher Künstler und Intellektueller wider. In der Gründerzeit besetzten die einst rechtlosen freiberuflichen Idealisten nun oft entscheidende Posten in einschlägigen Kommissionen oder Bildungsinstitutionen und entfalteten von dort aus ihre einschüchternde Macht. Ähnlich wie Johannes Brahms in Wien oder Joseph Joachim in Berlin wurde auch Clara Schumann zur bewahrenden Instanz, aus deren Schatten die junge Avantgarde des Fin de siècle dann nur durch vehementen Protest ausbrechen konnte. Für die Frankfurter Hochschule galt Clara Schumanns Anwerbung als Attraktion. Mit ihr kamen internationale Meisterschülerinnen und -schüler, vor allem aus England und teilweise aus den USA. Gleichzeitig bescherte ihr Zuzug den vor sich hin dümpelnden Museumskonzerten fortan Glanzlichter durch ihre Auftritte. Dazu zählten in den 1880er Jahren vor allem Aufführungen in Anwesenheit von Brahms. Was Clara Schumann spielte, galt als sakrosankt. Man verglich ihre Rolle für die Frankfurter Hochschule mit derjenigen Mendelssohn Bartholdys in Leipzig. In Wirklichkeit war die Schumann an der Gründung der Frankfurter Institution gar nicht beteiligt. Immerhin repräsentierte sie aber wie Mendelssohn ein Vorbild, das »späteren Generationen von Lehrern und Schülern das Gefühl einflößte, in einer geschichtlichen Kontinuität zu stehen, ein Gefühl, das mit Stolz, aber auch als Verpflichtung empfunden werden konnte« (Cahn 1979, S. 66). Diese immense Vorbild24
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
funktion bezog sich indessen nicht auf die Karriere von Frauen. Vorsorglich wehrte Joachim Raff schon im Vorfeld Bewerbungen von Künstlerinnen ab. »Mit Ausnahme von M m e Schumann ist und wird im Conservatorium keine Lehrerin angestellt. M m e Schumann selbst kann ich ebenso wohl als M a n n rechnen« (in: Cahn 1979, S. 51).
M ä d c h e n und Monster Zeitgenössische Wissensdiskurse Die Zuschreibung »männlich« begleitete Clara Wieck Schumann ein Leben lang. Schon die Zwölf j ährige entlockte Goethe das etwas eigentümliche Urteil, sie habe mehr Kraft als sechs Knaben zusammen, nachdem er die Bravour-Variationen op. 20 von Henri H e r z und eigene (nicht erhaltene) Variationen Clara Wiecks gehört hatte. E r fugte hinzu, über ihr Spiel vergäße man die Stücke. Goethes Kompliment enthält nicht nur bezeichnende Hinweise auf die Wirkung der jungen Virtuosin, sondern auch auf ihre performativen Qualitäten und die Auftrittspräsenz. M a n lud sie noch einmal ein, und dabei erregten nicht allein Chopins Variationen über »La ci darem la mano« op. 2 »besonderes Aufsehen«, wie Friedrich Wieck festhielt, sondern noch mehr, dass Clara »dieselben spielen kann«. Chopins Variationen zählten damals zur neuesten Musik und galten als ungeheuer schwer. Goethe schickte zum Dank eine Medaille mit der W i d m u n g »der kunstreichen Clara Wieck« (Jb, 7. und 9. Oktober 1831). Überraschung löste (nicht nur in Weimar) das Auseinanderklaffen von äußerem Eindruck, nämlich dem eines zarten, noch sehr jungen Mädchens, und seinen virtuosen und mentalen Fähigkeiten aus. D e m Mädchenhaften auf der einen standen auf der anderen Seite männlich konnotierte Zuschreibungen wie kraftvoll, energisch, geistreich oder ernsthaft gegenüber. Dieser Effekt war gerade bei der jungen Clara Wieck, die noch vom Wunderkindstatus profitierte, durchaus kalkuliert. E r funktionierte, weil hier mit konträren Bildern gespielt wurde. Sie produzierten Erstaunen und machten das junge Mädchen interessant, gerade wenn es komplexe Stücke darbot. E s gab allerdings auch Grenzfalle. Schließlich evozierte die weibliche Selbstinszenierung, das Spiel mit ephemeren Elementen wie der mädchenhaften seidenen Auftrittsgarderobe und den angesteckten Blumen auch bestimmte, kollektiv als weibliches Verhalten verstandene Erwartungen. Dazu gehörten vor allem Sentiment und Innigkeit. Wurden sie nicht erfüllt, so
Zeitgenössische Wissensdiskurse
25
konnten die stupenden Darbietungen auch negativ ausgelegt werden. So lobte der Rezensent der Allgemeinen musikalischen Zeitung 1837 an Clara Wieck zwar, dass sie Chopins »theilweise excentrische, doch originelle Compositionen« »fast am gelungensten« ausgeführt habe. Doch fehlte ihr seiner Meinung nach fur »Beethovens Tongebilde« die »Tiefe der Empfindung, besonders im Adagio« (Sp. 257f). Ihr Spiel erinnere »an Felix Mendelssohns geistreichen, humoristisch kecken, scharf accentuirten Vortrag«, hatte der Rezensent der Preußischen Staatszeitung 1837 behauptet und dann einen Vergleich zwischen ihr und dem Pianisten Theodor Döhler gezogen, der zu dem bemerkenswerten Ergebnis führte, dass »dem männlichen Naturell des einen ebenso soviel weibliche Ingredienzien beigemischt« wären, wie »das weibliche Naturell seiner Kunstgenossin mit männlicher Kraft und Phantasie durchdrungen« wäre. Im Urteil über beide überwogen deswegen »die graziöse Leichtigkeit, die weiche Elasticität« bei Döhler sowie »der mächtige Schwung, der leidenschaftliche Ausdruck des Spiels« bei Clara Wieck. Die Künstlerin schätzte solche Charakterisierungen nicht sonderlich. Sehr »schön geschrieben bis auf den Vergleich mit Döhler«, kommentierte sie (Jb, 27. Februar 1837). Gerade bei den Bewertungen ihrer Beethoven-Interpretationen spielte die Genderfrage, das heißt die Einteilung in weibliche und männliche Kategorien, eine wichtige Rolle. Beethovens Musik war im kollektiven Urteil besonders mit Attributen von Männlichkeit verknüpft. Dass eine Virtuosin sie spielte, erschien manchen schon unangemessen, weil allein der Widerspruch zwischen der Bühnenfigur und den hörereigenen Vorstellungen von einer männlichen musikalischen Persona in Beethovens Stücken zu weit auseinander klaffte. Man schwankte zwischen Bewunderung fur die gelungene musikalisch-technische Präsentation und einer grundsätzlichen Ablehnung, dass eine Frau die heroische Musik Beethovens öffendich spielte. Staunend rühmte die Londoner Times Clara Schumann 1856 als »intellectual player of the highest class«, deren Spiel atemberaubend sei. Trotzdem blieben Vorbehalte, ob das »mans concerto« (gemeint ist Beethoven fünftes Klavierkonzert Es-Dur op. 73) tatsächlich in den Händen einer Frau gut aufgehoben sei. Paul Scudo vermisste 1862 in Paris bei aller respektablen »énergie masculine« unverhohlen Clara Schumanns »grâce féminine« (in: Kat., S. 239 und 162f). Dem schloss sich François-Joseph Fétis in seinem 1864 publizierten Clara Schumann-Artikel in der Biographie Universelle des Musiciens an. Darüber hinaus kritisierte er ihre unweibliche Körperhaltung am Klavier (Fétis 1972, S. 531). »Sie erschien uns durchweg nicht als weibliche Künstlerin«, hatte schon 1847 der Kritiker der Berliner Musikalischen Zeitung den Leserinnen und Lesern mitgeteilt (10,1847). 26
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Das Genderkriterium weiblich-männlich fehlte auch in den Urteilen über die eigenen Werke Clara Wieck Schumanns selten. Sie »komponiert wie ein Mann«, rief Hermann Hirschbach erstaunt aus. »Wir sehen noch die Zeit kommen, wo sie ein Oratorium aus eitel kontrapunktischen Sätzen und aus lauten strengen Fugen bestehend herausgeben wird« (Hirschbach 1845, S. 309). Das Lob zielte hier offenbar auf die gedankliche Durchdringung der anspruchsvollen Satztechnik ihrer Präludien und Fugen op. 16 und setzte stillschweigend voraus, dass Frauen generell unfähig seien, kontrapunktisch strenge Sätze zu konstruieren. In den ästhetischen Schriften der Zeit hatten derartige Gedanken bereits Tradition. Friedrich Schiller hatte in seiner Schrift Anmut und Würde die Ausnahmeposition einzelner »schöner Seelen« unterstrichen, die ihren Verstand zu nutzen wüssten, denn generell galt: »Selten wird sich der weibliche Charakter zu der höchsten Idee sittlicher Reinheit erheben und es selten weiter als zu affektionierten Handlungen bringen« (Schiller 2004, 5, S. 470). Darauf griff Ferdinand Hand in seiner Ästhetik der Tonkunst 1837 zurück. »Weibliche Seelen sind selten fiir eine anhaltende Beschäftigung mit dem einfach Grossen und rein Idealen geschaffen«, behauptete er schlicht (Hand 1837,1, S. 310). Auch Kritiker von Clara Schumanns Klaviertio op. 17 gingen davon aus: »Bis zur reiferen Komposition erheben sich die Damen deswegen nur selten, weil sie zur Festhaltung dessen, was das inner Ohr hört, eine Kraft der Abstraktion voraussetzt, die überwiegend den Männern gegeben ist«, hieß es etwa in der Allgemeinen musikalischen Zeitung. »Zu den wenigen aber, die sich dieser Kraft wirklich bemächtigt haben, gehört vorzugsweise Clara Wieck« (AmZ 1848, Sp. 223f). Joseph Joachim gestand der Schumann später, dass er es zuerst »nicht glauben wollte, eine Frau könne so etwas componiren, so ernst und tüchtig«, nachdem Mendelssohn ihm das Trio privat vorgeführt hatte (Joachim 1, S. 79). Zunächst war die Komponistin sehr zufrieden mit ihrem Trio und fand es »auch in der Form ziemlich gelungen«. »Es geht doch nichts über das Vergnügen, etwas selbst komponiert zu haben«. Ein Jahr später gefiel ihr das Stück allerdings doch nicht mehr. Verglichen mit Robert Schumanns neuem Klaviertrio d-Moll op. 63 klänge es »weibisch sentimental« (in: Litzmann 2, S. 139f). Hier geriet das spontane Hochgefühl des eigenen Handelns offenbar gleich in doppelter Weise in Konflikt mit der Umwelt, einmal im hausinternen künstlerischen Wettbewerb und dann, genereller, in Hinblick auf das kollektive Bild über weibliche Kreativität. Wie das aufmunternde Feedback der Fachpresse auf sie wirkte, hat Clara Schumann nicht mitgeteilt. Später revidierte sie aber ihre Selbstkritik, denn sie übernahm das Klaviertrio in ihr Zeitgenössische Wissensdiskurse
27
Repertoire und führte es noch in den 1870er Jahren in London öffentlich auf. Die Regeln, nach denen Künstlerinnen als »Ausnahmefrauen« erschienen, wurden durch Wissensdiskurse der Zeit formuliert. Dabei beeinflussten sich theoretische Konzepte, Traditionen und Lebenspraxis wechselseitig. Theoriemodelle erfordern bekanntlich ein exaktes, komplexitätsreduzierendes Raster, um anwendbar zu sein. Sie dienen methodisch zur Einordnung von Beobachtungen, bilden aber nicht selbst die Wirklichkeit ab. Auch historisch bestand zwischen den theoretisch definierten weiblichen und männlichen Polen der symbolischen Geschlechterordnung, ihrer semantischen Codierung in schriftlichen Quellen und den wirklich gelebten Rollen immer ein dehnbarer Spielraum. Friedrich Schlegel mühte sich vergeblich darum, an der Figur der Diotima aus Piatons Symposion einen Begriff von »reine[r] Weiblichkeit oder Männlichkeit« herauszuarbeiten. Er wollte sie von überladenen und übertriebenen Attributen befreien, »die aus der Erfahrung geschöpft« seien. Romanfiguren wie etwa die Diotima in Hölderlins Hyperion folgten konkreten Vorbildern, in diesem Fall dem der Susette Gontard, und taugten daher nicht als Muster. Nach Piatons Entwurf - wie Schlegel ihn las - sollten Frauen wie Männer gleichberechtigt am öffentlichen Leben Anteil nehmen und die gleiche musische und sportliche Erziehung erhalten. Schlegel ging es um diese Gleichheit, allerdings ohne dass die Geschlechter dabei ihre spezifisch weiblichen oder männlichen Vorzüge verlören. Getrieben wurde Schlegel von der Suche nach Vorbildern für die Veredlung seiner eigenen zeitgenössischen Gesellschaft »zur höheren Menschlichkeit«, die er in der griechisch-antiken »Zivilgesellschaft« und ihrem idealtypischen Weiblichkeits- und Männlichkeitskonzepten zu finden hoffte. Nach Schlegels Definition blieben jedoch nur je zwei Merkmale für das rein Weibliche wie für das rein Männliche übrig, nämlich »Innigkeit und Zartheit« sowie »Umfang und Bestimmtheit« (Schlegel 1980,1, S. 32f). Damit ließ sich noch keine Gesellschaftsordnung konstruieren. Schlegel legte ein bipolares Geschlechtermodell zugrunde. Man führte es auf Piaton zurück, da dessen Dialog Symposion den archaischen Mythos überlieferte, dass Frauen und Männer ursprünglich eine Einheit gewesen seien, die Zeus im Zorn »wie eine Frucht« in zwei Hälften zerschnitt. Beide Geschlechter suchten deswegen ihren verlorenen Teil, um sich wieder zu vereinen, nach Piaton das Movens der Liebe. Mit diesem paritätischen konkurrierte im zeitgenössischen Diskurs des frühen 19. Jahrhunderts noch ein 28
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
zweites hierarchisches Konzept, nämlich der auf Aristoteles zurückgeführte Defiziensmodus. Danach galten Frauen nur als unvollständige Männer (Honegger 1991, S. 168ff). Dieses Modell ließ sich instrumentalisieren, um ein im Blick des 19. Jahrhunderts als natürlich eingestuftes hierarchisches Gefälle zwischen den Geschlechtern zu behaupten. Frauen wurde dabei generell die Denkfähigkeit abgesprochen. Auf derartigen Vorstellungen fußte auch Hirschbachs Erstaunen über Clara Schumanns Fugen. Beide Konzepte waren zwar theoretisch unvereinbar, da das eine auf einer Gleichwertigkeit, das andere auf einer Ungleichwertigkeit von Frauen und Männern beruhte. Bei näherer Sicht zeigt sich jedoch, dass auch die Annahme einer Geschlechterpolarität um 1800 nicht automatisch auch Gleichrangigkeit garantierte. Die beiden Pole weiblich und männlich konnten nämlich mit jeweils unterschiedlichen Valenzen aufgeladen werden. Als fortschrittliches Element enthielt die Vorstellung einer komplementären Symmetrie der Geschlechter die Existenz zweier gleichberechtigter, geistig autonomer Individuen. Doch gleichzeitig spaltete das Modell Frauen und Männer in Gegensätze, obwohl im aufklärerischen Konzept das Geistige, wodurch sich Menschen von Tieren unterschieden, kein Geschlecht hatte, sondern nur die materiellen Körper. Stand dagegen die Biologie im Vordergrund, so konnte man daraus eine grundsätzliche Unvereinbarkeit von Frauen und Männern folgern, deren Ursache immer intensiver in den körperlichen Unterschieden gesucht wurde. Der Schlüssel für eine derart partikuläre, in Frauen und Männer gespaltene Naturauffassung lag in der Anbindung des Menschenbildes an die aktuelle medizinisch-biologisch fundierte Anthropologie und der damit einhergehenden Veränderung des Naturbegriffs. Dadurch verschob sich die Begründung des Menschseins radikal. Anstelle philosophisch oder theologisch verankerter erkenntnistheoretischer Bestimmungen, wie Vernunftbegabung oder Gotteserkenntnis, zog man nun vorzugsweise psychophysische Argumente heran. So konnte auf der Basis einer nach Geschlechtern geteilten Menschheit eine spezielle »Weibsnatur« kreiert werden. Auf die weiblichen und männlichen Pole ließen sich in populäreren Diskursen des 19. Jahrhunderts auch ältere Begriffspaare wie Leib-Seele oder Herz-Verstand applizieren und mit wertenden Eigenschaften verknüpfen, wie die Zuordnung von Körper und Frau, mit irrational oder unkontrolliert. Diese mehr oder weniger willkürlichen Attribute wurden dadurch dass sie in medizinisch-biologischen Traktaten auftauchten, objektiviert und durch die Wissenschaftlichkeit gleichsam »naturalisiert« (Honegger 1991, S. 13fF). Im Grundsatz basierte das aufgeklärte bürgerliche Selbstverständnis zwar auf der Idee der Menschenwürde. Sie implizierte eine universalistische ForZeitgenössische Wissensdiskurse
29
derung von Freiheit und Gleichheit aller Menschen als Grundlage für eine allgemeine Humanität. Wenn man aber Frauen und Männer als Gegensätze ansah, die unterschiedlichen Bereichen zugeordnet waren, etwa dem privaten und dem öffentlichen oder dem kulturellen und dem politischen, so schuf man neue Asymmetrien. Während die politische Öffentlichkeit und der Handel weitgehend ohne Frauen stattfanden - zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung - und dort sich dementsprechend spezifische Strukturen herauskristallisierten, bildeten zumindest im Publikum der kulturellen Öffentlichkeit wie in den Lesegesellschaften oder bei Musikveranstaltungen Frauen die Mehrheit. Folgt man zeitgenössischen Beschreibungen, so verteilte sich die Quote 1834 in Leipzig auf drei Viertel Hörerinnen zu einem Viertel Hörer (F. Schmidt 1912, S. 197f.; Habermas 1990, S. 121). Indessen rückte der Kunstgenuss auf gesellschaftlicher Ebene im 19. Jahrhundert insgesamt in den Freizeitbereich. Als Arzt könnte er sich das Vergnügen, »ins Schauspielhaus zu gehen«, eigentlich nicht leisten, resümierte ein Berliner Mediziner. Er fürchtete, dass seine »Kranken darunter leiden würden« (in: Frevert 1998, S. 194). Die Anwesenheit von Frauen erhöhte indes den sozialen Status der Veranstaltungen. Das bedeutete, dass es gelungen war, Konzertsäle als »anständige« öffentliche Orte zu etablieren. Dagegen dürfte das proportionale Verhältnis von Künstlerinnen zu Künstlern eher umgekehrt zu dem des Publikums gewesen sein, wie die Programme des Leipziger Gewandhauses zeigen. Danach traten zwischen 1794 und 1881 dreimal so viel Pianisten wie Pianistinnen auf (in: Reich 1991, S. 383). Je stärker Kultur etabliert und institutionalisiert wurde, desto interessanter schien sie für Männer zu werden. Am Ende des 19. Jahrhunderts galt der öffentliche Bereich der Kultur als männliche Domäne, während Frauen den heimischen Salon dekorierten, um darin zu musizieren. Wilhelm Dilthey beschrieb, dass nicht etwa Hermann von Helmholtz, der die systematischen Grundlagen der Musiktheorie erforschte, die künstlerische Bedeutung seines Hauses im wilhelminischen Berlin aufbaute, sondern seine Frau Anna. Sie verfügte selbst über eine umfangreiche Bildung, benutzte sie aber offenbar lediglich zur Verschönerung des häuslichen Ambientes (in: Möhrmann 2000, S. 200; Frevert 1999, S. 206f). Im sozialen bürgerlichen Familienprogramm wirkten sich die widersprüchlichen Prämissen der unterschiedlichen Genderkonzepte ebenfalls aus. Familie stand nämlich für beides, sowohl für die Idee einer modernen paritätischen Gemeinschaft von Frauen und Männern auf der Basis von Liebe als auch für das traditionellere fürsorgliche hierarchische Hausvatermodell. Als idealisierter Hort menschlicher Intimität und Humanität, zu dem die Literaten um 1800 die Familie stilisierten, funktionierte sie auf der 30
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Basis einer horizontalen, das heißt auf der Gleichheit der Partner basierenden Struktur. Mit diesem Modell wollte sich das Bürgertum (nach eigenem Selbstverständnis) von der Aristokratie und deren verkrusteten hierarchischen Kommunikationsformen absetzen. Den adeligen Damen sprachen die bürgerlichen Frauen »natürliche Herzenswärme« rundweg ab (Vinken 2007, S. 139ff). Indessen spiegelte die Idee einer Arbeitsteilung in öffentliche männliche (für die Bürger vor allem Handel und Wirtschaft) und private weibliche kulturelle Sphären eine in der Tradition von Luthers Hausvatermodell stehende patriarchalische Struktur wider. Nur sie — und nicht die Gleichrangigkeit der Partner - bildete die zeitgenössische Rechtsordnung des 19. Jahrhunderts ab, nach der der (männliche) Hausvorstand über die Familie bestimmte. Als fortschrittlich verstand man beide Sphären der bürgerlichen Welt, die ökonomische aufgrund der bürgerlichen Handelsfreiheit und die der Familie aufgrund der humanitären Ideale (Habermas 1990, S. llOff). Im Rückblick von heute führten die paradoxen Konzepte von partnerschaftlichem Gleichheitsideal sowie die Aufspaltung in eine vom wirtschaftlichen Fortschritt geprägte »äußere« Welt und eine der sozialen Kälte trotzende innere familiäre Schutzzone in eine fatale Abhängigkeit bürgerlicher Frauen. Sie bezahlten mit dem Verlust an ökonomischer, sozialer und rechtlicher Souveränität. Innerhalb des privaten Hausstands griffen zivilbürgerliche Rechte wie der Vermögens- oder Gewaltschutz nicht eine Einschränkung, die in Deutschland erst ab 1920 allmählich aufgebrochen wurde. Für Frauen und Männer galten unterschiedliche Maßstäbe. Die Behauptung einer spezifisch weiblichen Biologie wurde instrumentalisiert, um Frauen abzuwerten. Damit verkehrte sich das, was Schlegel wie Humboldt an der »griechischen« gleichberechtigten Symmetrie der Geschlechter fasziniert haben mochte, ins Gegenteil. Die Gewissheit einer Unteilbarkeit des Geistigen rückte in den Hintergrund. Verbreitete Adam EÜas von Siebold 1811 noch die ältere Theorie, dass die Frau »in physischer Hinsicht das umgekehrte Männliche« sei (in: Honegger 1991, S. 204), so konzentrierte sich in den folgenden Jahrzehnten das Interesse bei der Suche nach den Unterschieden immer intensiver vor allem auf die biologische Beschaffenheit von Frauen, repräsentierten sie allein doch in vielen Köpfen jüngerer Forschergenerationen eine körperliche Naturgebundenheit, während der Mann inzwischen »endgültig zum modernen Menschen der Humanwissenschaft verallgemeinert« wurde (Honegger 1991, S. 6). Ein weiteres zentrales Moment der Aufklärung, nämlich die rationale Überwindung der Sinnlichkeit, wandelte sich im frühen 19. Jahrhundert in
Zeitgenössische Wissensdiskurse
31
eine männliche Eigenschaft. Zwar gehörte Sinnlichkeit zum Stofflichen aller Menschen dazu. Doch fokussierte sich das medizinisch-biologische Interesse in dieser Frage hauptsächlich auf Frauen, genauer auf die weibliche Sexualität. Man hielt Frauen für ohnmächtig ihrer Sexualität ausgeliefert. So spukte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine durch nichts belegte Vorstellung von ungezügelter weiblicher Begierde in den Phantasien herum. Sie ging auch in einschlägige Kunst und Pornographie ein. Eine der auflagenstärksten erotischen Grafiken Deutschlands, Wilhelm von Kaulbachs um 1840 entstandene Lithographie Wer kauft Liebesgötter?, nach Goethes gleichnamigem Gedicht, stellt eine Alte dar, die mit Flügeln versehene Phalli jungen Frauen feil bietet und deren Vergnügen daran abbildet (in: Biedermeier, S. 593). Vor derartiger sinnlicher Gier sollte die Ehe schützten, indem sie die Frauen durch keusche Sexualbeziehungen domestizierte. Beide Partner errangen so gleichsam einen kulturellen Sieg, der sie moralisch erhöhte. Um einem Kontrollverlust vorzubeugen, galt daher für Frauen, sich schamhaft und tugendsam zurückzuhalten. Anstandsbücher wie Adolph Freiherr von Knigges Über den Umgang mit Menschen von 1788 vermittelten der bürgerlichen Gesellschaft die entsprechenden Verhaltensregeln dazu. Gelang Frauen die Kontrolle, dann gewannen sie durchaus moralische Überlegenheit. Sie trugen dadurch - in der Semantik des 18. Jahrhunderts - zur Verfeinerung der Sitten bei (Geschichte der Frauen 4, S. 178f). Clara Schumanns stete Furcht, als »coquette« zu gelten, sowie ihre Abstinenz gegenüber zeitgenössischen Frauenbewegungen, denen Gegner Nymphomanie unterstellten, dürfte hier ihre Wurzeln haben. Darüber hinaus diente der Vorwurf als Vorwand, um mächtige und einflussreiche weibliche Führungsfiguren zu denunzieren. Welches der Genderkonzepte kollektiv bevorzugt wurde, hing von vielen verschiedenen Faktoren ab. Im Laufe von Clara Schumanns Lebenszeit veränderten sich die Sichtweisen auf die Geschlechtsunterschiede grundlegend. Inwieweit die hier skizzierten generellen sozialen und genderspezifischen Muster tatsächlich auch auf das Leben von Künstlerinnen zutrafen, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Schon die Gruppe der Bildungsbürger war klein und die Künstlerinnen darin marginal. Der Vergleich zwischen Fanny Mendelssohn Bartholdy und Clara Wieck Schumann zeigt, dass die Hürden, überhaupt öffentlich aufzutreten, schon innerhalb bürgerlicher familiärer Ordnungen schier unüberwindlich sein konnten. So protestierte Fanny Mendelssohn zwar gegen ihren beschränkten weiblichen Handlungsradius, wagte ihn aber ohne das Einverständnis der Herkunftsfamilie selbst nach ihrer Heirat erst am Ende ihres kurzen Lebens schrittweise zu erweitern. 32
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Clara Schumanns Selbsteinschätzung ihrer Rollen bleibt undeutlich. Einerseits idealisierte sie die Vorstellung einer bürgerlichen Kleinfamilie, die in einer von Liebe, Einfachheit und Naturnähe geprägten Idylle lebte. Andererseits war sie von Kindheit an gewohnt, auf öffentlichen Bühnen präsent zu sein und selbst zu handeln. Daher kam ein Rückzug aus dem Berufsleben nach der Heirat für sie nicht ernsthaft in Frage, wie ihre mehrfachen Bekundungen im Jugend- und in den Ehetagebüchern demonstrieren. Allerdings folgen die Maßstäbe, die ich zur Distinktion ihrer Rollen anwende, einem Raster, von dem nicht garantiert werden kann, dass es auch für die Künstlerin von Bedeutung war. Clara Schumann spielte erfolgreich mit dem kollektiven Einverständnis dessen, was von Frauen zu erwarten sei, indem sie durch die Art ihrer Auftrittsinszenierung bestimmte Weiblichkeitsbilder bediente, in jungen Jahren etwa einen »Louisentypus«. Das heißt, ihr Selbstkonzept enthielt aktive und passive Anteile, innere, psychologische, und äußere, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte, anerzogene und angeeignete Verhaltensweisen. Künsderinnen wie Clara Wieck Schumann präsentierten sich mit Eigenschaften, die sich nicht schlicht in weibliche und männliche Anteile dividieren ließen. Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und die von Kindheit an geforderte Fähigkeit, stundenlang zu üben, sowie Durchsetzungskraft und Darstellungsvermögen gehörten zu berufsspezifischen Komponenten. Sie dürften genderübergreifend gegolten haben. Vermutlich beeinflussten sie die Persönlichkeitseigenschaften erheblich (de la Motte 2005, S. 532f). Jedenfalls genoss die Virtuosin offenbar lebenslang lustvoll ihre Macht und den berauschenden Effekt, ein Publikum zum Schmelzen bringen zu können. Das verschaffte ihr ein intensives Hochgefühl und war die Basis ihrer großen Arbeitszufriedenheit. Nach Schuberts Erlkönig (in Liszts Klavierfassung) und Thalbergs Mosesfantasie »wurde das Publikum so ins Feuer gejagt, daß es, oh Wunder klatschte und schrie. Ich war stolz darauf!«, so Clara Wieck 1840 in Hamburg. Und noch 1886, nach einem Auftritt im Populär Concert in London, notierte sich die inzwischen 66jährige Künstlerin zufrieden, »enormer Empfang, ein Theil des Publicums [...] schrie Hurrah« (Jb,21. Februar 1840; Litzmann 3, S. 476). Auf dem Podium handelte sie offensiv, kämpferisch und selbst bestimmt, alles Kategorien, die man heute im Hinblick auf ein gelungenes Leben für besonders wertvoll ansieht. In den Rezensionen aus dem 19. Jahrhundert galten sie als ausgesprochen männlich. Indessen spielten auch männliche Virtuosen in der Öffentlichkeit mit flexiblen Rollenklischees. Als Künsder sollten sie andere, schillerndere Persönlichkeitsspektren bieten, als ein Börsenmakler. Neben Genialität und Elan erwartete man Sensibilität, Empfindsamkeit und
Zeitgenössische Wissensdiskurse
33
Hingabe, also im literarischen Spektrum des 19. Jahrhunderts ausgesprochen weiblich konnotierte Eigenschaften. Chopin und Liszt spiegelten in den 1830er Jahren einen entsprechenden Typus erfolgreich wider: nämlich sehr schlank und bleich, Liszt sogar mit langen Haaren und im »Dandy-Anzug« (Fashion 2, S. 210), mit seidener, floral gemusterter Weste, Schal aus Seidenponge und dunklem Rock mit Samtkragen. Auch Schumann skizzierte sein literarisches Alter-Ego Eusebius als »etwas schlank u. blaß« {Tb 1, S. 365). Im zeitgenössischen literarischen und journalistischen Diskurs wurden die genderspezifischen Hinweise durchaus flexibel instrumentalisiert, um Werturteile zu formulieren. Vor dem Hintergrund eines Gesellschaftsmodells, das Frauen der Sphäre des Privaten zuordnete, boten gerade die öffentlich wirkenden Künstlerinnen auch eine stete Angriffsfläche. Die als männlich hervorgehobenen Anteile konnten das Bewundernswürdige ihrer Darbietung unterstreichen, umgekehrt aber auch den Ruf als Frau beschädigen. Der Grad zwischen Muse, Monster und Nymphomanin war in der öffentlichen Wahrnehmung nur sehr schmal. Die exponierte Situation als Künstlerin auszuhalten, fiel nicht immer leicht. »Mich betrachteten die Anwesenden wie ein fremdes Thier«, notierte sich die 20jährige Clara Wieck in Stargard (Jb, 8. November 1839). Als zwitterhaftes Wunderwesen skizziert zu werden, verletzte und entwertete die Frauen. Auch Clara Schumann schreckte davor zurück, zum bestaunten »Mannsweib« ä la Lola Montez zu mutieren. Deren politische Skandale und freizügigen Eskapaden verfolgten die Schumanns mit Kopf schüttelnder Neugier. In Riga übernachteten sie im selben Hotel und erlebten 1844 Montez' »Bacchanalien« mit Offizieren und einer illustren Aristokratenschar quasi hautnah mit, »und zwar über uns, so dass wir kein Auge zu thaten« {Tb 2, S. 325). Offenbar wollte Clara Schumann weder nach außen allzu burschikos erscheinen, noch lag ihr daran, Robert Schumanns Position als Familienoberhaupt angekratzt zu sehen. So scheint sie zwar die für Frauen schicklichen Maximen verbal und visuell vertreten, allerdings durchaus nicht immer danach gehandelt zu haben. Um 1850 zeichnete sich in den wissenschafdichen Forschungen um Weiblichkeit ein Umschwung ab. Man konzentrierte sich nun hauptsächlich auf die Fortpflanzungsorgane und den Geschlechtstrieb, weil man darin die Grundlage der Unterschiede zwischen Frauen und Männern suchte. Während ältere Thesen von einer unbeherrschten weiblichen Sinnlichkeit, die durch männliche Vernunft reguliert wurde, ausgingen, lösten nun Vorstellungen von einer kalten, empfindungslosen weiblichen Sexualität neue wis34
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
senschaftliche Kontroversen aus. Folgt man den von Claudia Honegger, Peter Gay, Thomas Laqueur und Georg Breidenstein aufgearbeiteten zeitgenössischen Diskursen, so wurde Sexualität inzwischen als aktives, lebensspendendes, männliches Movens aufgewertet und mit Kreativität in Verbindung gebracht. Frauen kam dabei eine passive, handlungsunfähige Rolle zu, die man naturwissenschaftlich zu fundieren suchte. Der Hintergrund, warum die leitende medizinisch-naturwissenschaftliche Forschung sich überhaupt so gründlich mit weiblicher Psychologie und Physiologie befasste, dürfte vermutlich weitgehend politisch motiviert und von den immer lauter werdenden Forderungen von Frauen nach gleichberechtigter Teilhabe an Politik, Gesellschaft und Bildung provoziert worden sein. In der Gründerzeit setzten selbst europaweit geachtete innovative Forscher wie Rudolf Virchow ihre Energie und Fachkompetenz dafür ein, um Frauen von verantwortungsvollen Positionen fernzuhalten, indem sie den Nachweis einer »natürlichen« Ungleichheit zwischen Frauen und Männern zu erbringen gedachten. Die gesellschaftspolitisch brisanten Frauenfragen beantworte Virchow im weit gehenden Einverständnis mit allgemeinen zeitgenössischen Wissensordnungen ausschließlich medizinisch. So erklärte er alle psychophysischen weiblichen Merkmale zu Dependenzphänomenen der Ovarien. Danach seien Frauen aufgrund ihrer Menstruation sozusagen permanent einer »biologischen Achterbahn« (Laqueur 1992, S. 250) unterworfen und deswegen unfähig zu politischem Handeln. Das in der Aufklärung formulierte Ideal einer freien und gleichen geistigen Entfaltung der Menschheit kippte in diesen Diskursen vollständig um in einen behaupteten biologischen Determinismus der Frauen, durch den das alleinige Recht von Männern auf Besetzung der Schaltstellen der Macht legitimiert werden sollte. Carl Gustav Carus, Mediziner, musikbegeisterter Hofrat und RaffaelEnthusiast, der in Dresden zum Freundeskreis der Schumanns zählte, veröffentlichte 1820 das erste Lehrbuch der von ihm so bezeichneten Gynäkologie, zu der im weiteren Verlauf des Jahrhunderts die gesamte »Wissenschaft von der Frau« zusammenzuschrumpfen drohte. In einschlägigen naturwissenschaftlich-medizinischen Diskursen standen am Ende die Ovarien gleichsam synekdotisch für Frau (Laqueur). Sie galten als Sitz von Hysterie, Nymphomanie, Nerven- und diverser sonstiger Leiden. Auch Prostitution und die mit ihr verbundene Gefährdung durch venerische Krankheiten fielen darunter. Man bewertete sie als individuelles pathologisches und nicht als soziales Phänomen (Ansteckung, S. 78). Bei entsprechenden Diagnosen wurden die Ovarien möglichst operativ entfernt. Erst Jean-Martin Charcot und Sigmund Freud bremsten die vor allem von dem Freiburger Gynäkologen
Zeitgenössische Wissensdiskurse
35
Alfred Hegar verfochtene »weibliche Kastration«, indem sie deren Unwirksamkeit bei psychischen Krankheitsbildern herausstellten. Allerdings führte die Psychoanalyse mit ihrer wissenschaftlichen Beschreibung der Triebkräfte des Unbewussten und der kindlichen Sexualität dann insgesamt zu einer fundamentalen Krise des menschlichen Selbstbildes von Männern und Frauen. Den »Exorzismus der organischen Dämone undamenhaften Verhaltens« (Laqueur 1992, S. 201) sekundierten zahlreiche Nachbardisziplinen mit einschlägigen Theorien, die thematisch um die weiblichen Fortpflanzungsorgane und den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Trieben kreisten. Zu den populären evolutionsbiologischen Hypothesen gehörte die Annahme einer Uniformität aller Säugetiere. Danach wurde auch bei Frauen auf eine periodische »Brunst«-Phase geschlossen. Sie sollte sich während der Menstruation ereignen. Dass allerdings der »orgasme menstruel« so gar keine Lust auslöste, führte nicht zur Falsifikation, sondern zog weitere Hypothesen nach sich wie die eines geringeren weiblichen »sexuellen Appetits« oder noch verwegener - einer »sexuellen Anästhesie« (Laqueur 1992, S. 215ff). Solche Behauptungen sah man bestätigt durch die Phrenologie, die Schädelforschung, nach der Frauen über ein geringeres Kleinhirn verfugten, dem Zentrum des Geschlechtstriebs, oder der Ethologie, der biologisch fundierten Verhaltens- und Charakterforschung. Aus dem Paarungsgebaren von Tieren wollte man nun eine generelle weibliche sexuelle Passivität ableiten. Dazu lieferten Charles Darwins Forschungen das Argument einer aus Größe, Kraft, Dominanz, Lautstärke, Melodienvielfalt oder Farbenpracht von Alphatieren geschlossenen männlichen Überlegenheit. Während man die Libido nun den Frauen als »wesensfremd« (Hegar in: Breidenstein 1996, S. 220) absprach und weibliche Sexualität regressiv zum passiven, leidenschaftslos ertragenen Naturvorgang verkümmerte, interpretierte man den männlichen »Zeugungstrieb« als Zeichen besonderer Energie und Tatkraft und setzte ihn mit kreativem Schaffensvermögen gleich. Der Nervenarzt Paul J. Möbius, der eine eigene Untersuchung Uber Robert Schumanns Krankheit beisteuerte, erwog sogar, den »Kunsttrieb« als sekundäres Geschlechtsmerkmal des Mannes anzuerkennen (in: Breidenstein 1996, S. 223). Derartige Vorstellungen leiteten womöglich auch Clara Schumann, als sie sich entgegen den herrschenden Tabus am Ende ihres Lebens entschloss, Robert Schumanns chiffrierte und explizite Protokolle ehelicher Kohabitationen (»mit Kl.[ara] l a geschl.[afen]«, Tb 3, S. 454) unzensiert zu lassen, als sie die Tage- und Haushaltsbücher ihrer Tochter Marie vermachte. Schon Hanslicks Urteil über Liszts kompositorische »Impotenz« war diesem Denken verpflichtet. 36
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Sexualdiskurse konnte die Bilanz im Nachhinein auch als Bestätigung für Schumanns kreative Potenz gelesen werden. Wenn aber tatsächlich Kreativität und Tatkraft mit sexueller Aktivität in Verbindung stehen sollten, dann dürfte es für Frauen, denen in einschlägigen, die kollektiven Moralvorstellungen beeinflussenden Veröffentlichungen nur eine passive Hingabe zugestanden wurde, auch nicht immer erstrebenswert erschienen sein, in der Öffentlichkeit ihre als anstößig geltende »énergie masculine« provokativ herauszustellen. Die Literatin Fanny Lewald hat in ihrer Lebensgeschichte 1861 diesen gesellschaftlichen Druck als eine Form von automatischer Selbstbeschränkung beschrieben. Sie hätte ihre »literarische Beschäftigung immer noch wie ein mir Zugestandenes, gleichsam auf Widerruf Erlaubtes« getrieben, »an Abhängigkeit und Unterordnung mehr gewöhnt, als ich es selber wußte« (in: Geschichte der Frauen 4, S. 184). Lewald beeindruckte die Schumann. Beide lernten sich 1873 in Baden-Baden persönlich kennen und schätzen. Clara Schumann hörte nach 1856 gleich ganz zu komponieren auf. Dabei dürften neben den gesellschaftspolitischen ungünstigen Rahmenbedingungen auch private, wie der Verlust ihres musikalischen Dialogpartners Schumann, und organisatorische Gründe mitgespielt haben. Auf dem Podium verteidigte Schumann dagegen ihre fortwährende Präsenz ebenso hartnäckig wie erfolgreich, selbst gegen den Widerstand ihrer intimsten Freunde. Wie viele andere Künstlerinnen so nutzte auch Clara Schumann massiv rhetorische und optische Bescheidenheits- beziehungsweise Demutsgesten, um in deren Schutz dann doch recht effektiv öffentlich ihre Macht auszuüben. Das entsprach ihrem »Victoriafaktor«. In der Öffentlichkeit spiegelte Clara Wieck Schumann imaginierte Bilder von Frauenidealen, über deren Inhalt ein allgemeines Einverständnis herrschte. Sie entsprachen zeitgenössischen kulturellen Konstruktionen. Die kollektive Imagination von »Frau« (gender) wurde dann in der konkreten Konzertsituation auf den realen weiblichen Körper (sexus) der Künstlerin projiziert und durch diesen »Kloneffekt« (v. Braun/Stephan 2005, S. 22ff.) gleichsam zum Leben erweckt. Da man das fiktive Bild »Frau«, das die Künstlerin reflektierte, lebendig vor sich sah, konnte es als naturgegeben gelten. Die Überblendung von Wunschobjekt und Wirklichkeit funktionierte deshalb, weil die Attribute, mit denen Frauen literarisch beschrieben wurden (zart, gefühlvoll, innig) schon eine längere geschichtliche Tradition hatten und daher zeitlos schienen. Im Prozess wechselseitigen Beobachtens und Reagierens zwischen Star und Publikum multiplizierte und bestätigte sich das auf der Bühne verkörperte Frauenideal. Tatsächlich spiegelte die Künstlerin
Zeitgenössische Wissensdiskurse
37
bloß die gerade aktuellen Phantasiebilder von Idealen, wie die Königinnen Louise oder Victoria, und keine allgemeine oder gar ewig weibliche Natur.
Erinnerungen, B l u m e n - und T a g e b ü c h e r Lebensdokumente Sie »war etwas über mittelgroß, aber so stark und kräftig gebaut, dass sie groß erschien. Ihre Bewegungen waren, ohne unruhig zu sein, äußerst lebhaft, und kam sie zur Türe herein, so war mir immer, als ob alles an ihr flöge.« Ihr Gesicht veränderte sich im Nu, »wie Züge von Wolken«. »Arger und Kummer ließen die Muskeln sofort erschlaffen, und meine Mutter konnte dann plötzlich alt und leidend aussehen; ebenso aber konnte eine freudige Erregung ihr das Gesicht blitzschnell um Jahre verjüngen«. In Eugenie Schumanns Erinnerungen verklärt sich das Bild posthum fast zum auratischen Mythos. »Kam sie mir von weitem entgegen, so war mir immer, als ginge sanft strahlendes Licht von ihr aus.« Die Augen ihrer Mutter glichen »Sehsternen«. »Viele Farben hatte hier der Schöpfungskünstler zu einer von unendlicher Weichheit und Wärme verschmolzen und darüber den Glanz strahlenden Silbers gegossen«. Folgt man den Bildzeugnissen, so waren sie grau-braun. Hedwig Oldenbourg, die Nichte von Emilie List, hatte Clara Schumann zum ersten Mal 1858 gesehen. Sie beschrieb das Gesicht wie »etwas dem Meer Verwandtes, äußerlich eine große Stille, unter welcher sich eine leidenschaftlich bewegte Welt verbarg«. Eine »unaussprechliche Melancholie« habe auf ihrem »edlen Gesicht« gelegen (in: Wendler, S. 485). Heinrich Dorn, 1832 Claras Kompositionslehrer, erinnerte sich im senilen Rückblick von 1870 an eine »zierliche Gestalt, blühende Gesichtsfarbe, zarte weiße Händchen, üppiges schwarzes Haar, gluthvolle Augen«. »Alles an ihr war appetitlich«, schloss er (Dorn 1870-1886,2, S. 118). Clara Schumanns Hände sollen im Alter »den Händen Goethes« geähnelt haben, so die Tochter. Zumindest dachte der Bildhauer Adolf von Hildebrand, er hätte die Hand Clara Schumanns vor sich, als er einen Gipsabguss von Goethes Hand sah (Hildebrand, S. 291f). Den um 1875 gefertigten Gipsabguss von Clara Schumanns rechter Hand dürfte er nicht gekannt haben, da er sich in Privatbesitz der Gräfin Marie von Oriola befand. Heute wird der Handabdruck im Robert Schumann-Haus Zwickau aufbewahrt. »Mit großer Liebe, aber auch mit Scheu blickte ich zu ihr auf«, fuhr die Tochter fort. »Sie stand so hoch über dem armen, unentwickelten Pen-
38
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
sionsmädel, dass ein Gefühl der Fremdheit und Verzagtheit lange nicht von mir weichen wollte«. Diesen überhöhten Glanz begleiteten auch irdischere Aspekte. »Die Stimme war sanft und wohltönend. Ein leises Anstossen mit der Zunge gefiel uns Kindern außerordentlich, und ein Anflug von sächsischem Dialekt gab Anlaß zu manchen Neckereien, so, wenn die Mama ,Gohannes' statt , Johannes' sagte« (E. Schumann, passim). Marfa Sabinina, die Clara Schumann 1850 zum ersten Mal in Dresden sah und eine Zeitlang ihre Schülerin wurde, teilte mit, die Virtuosin hätte das »>R< schnarrend« ausgesprochen. »Für eine Deutsche war Clara Schumann schlank und graziös«, so erinnerte sich Sabinina an die Dreißigjährige. Sie »kleidete sich gut, einfach, doch mit Geschmack«. »Schön war sie nicht, doch attraktiv [...] und sehr mager; ihr Schädel war schmal und eckig; sie hatte eine krumme Nase, schmale Lippen, tiefliegende Augen; schwarze Haare säumten das blasse Antlitz, dessen Ausdruck ruhig und wehmütig wirkte«. Im Umgang mit anderen wäre sie »freundlich und zuvorkommend« gewesen, »mit Gefühl, ja Feingefühl begabt«. »Nur gegenüber ihr unsympathischen Personen benahm sie sich reserviert. Zu mir war sie stets sehr gütig und freundlich.« Sabinina verwunderte allerdings »ihre ernste, besorgte und manchmal nervöse Manier«, als deren Ursache die Schülerin »ihr Familienleben« ansah, vor allem »die häufig wiederkehrenden nervösen, hypochondrischen Launen ihres Mannes«, die die Virtuosin »belasteten« (in: Lossewa 1997, S. 202f). Dass die Künstlerin in ihrem musikalischen Element gleichsam aufblühte, überlieferte aus dem persönlichen Umfeld auch die Sängerin Marie Fillunger, Eugenie Schumanns Freundin. Sie lebte ab 1878 längere Zeit bei den Schumanns. »Am reizendsten finde ich an Mama die Kindlichkeit, die Ursprünglichkeit, wie jung und wie frische grünend ist dieses Gemüth. W i r sogenannten jungen Leute sind ihr im Alter weit voraus« (in: Rieger 2002, S. 133). »Denk ich nur an das sonnenüberstrahlte Gesicht, so wird mir ganz eigen zu Mut«, schrieb Elisabet von Herzogenberg nach einem Besuch der Schumann 1887 an Eugenie, »ihre Künstlerseele, ihre Kindeslauterkeit, ihre mütterliche Güte strahlt immer leuchtender aus den herrlichen Augen« (in: E. Schumann, S. 283). Berthold Litzmann, der die Künstlerin schon als Kind in seinem Elternhaus in Kiel kennen gelernt hatte, hielt als persönliches Andenken einen charakteristischen Zug von Schalkhaftigkeit fest (Erinnerungen, S. 163f). Diesen Eindruck bestätigte auch noch Josef Viktor Widmann, der Clara Schumann erst als 70jährige alte Dame persönlich kennen lernte. Sie hätte eine »so holdselig kindlich-himmlische Schönheit in ihrem sorgenvollen und dann doch immer wieder von einem Strahl der Heiterkeit verLebensdoku mente
39
klärten Gesicht, daß sie eigentlich die erste Frau ist, auf die Du mit Grund eifersüchtig sein dürftest«, schrieb er seiner Frau Sophie 1889. »Ich könnte mich für sie todtschlagen lassen, so gefällt sie mir. Leider ist sie arg schwerhörig« (in: R. Hofmann 2002, S. 266f). Friedrich Wieck bescheinigte seiner fiinfj ährigen Tochter »ein unruhiges Temperament«. Später beeindruckte den Studenten Robert Schumann die Lebhaftigkeit der Elfjährigen: »verlirt den Hut vom Kopf- rennt Tische und Stühle um«. »Launen und Laune, Lachen und Weinen, Tod u. Leben, meist in scharfen Gegensätzen wechseln in diesem Mädchen schnell«, notierte sich der junge Student. »Höre, Du hast doch viel von einer Spanierin«, schrieb er ihr 1839 (Jb, Oktober 1824; Tb 1, S. 334 und 345; Bw, S. 447). Bei einem Test durch einen Psychometer, einem Messinstrument, das Wärme- und Feuchtigkeitsgrade mit einer Temperamentskala verband, den die Wiecks 1833 machten, kam für Clara eine anschauliche Palette von Eigenschaften heraus, darunter: »Aufrichtig, bescheiden, unbescheiden, leichtsinnig, leidenschaftlich, eigensinnig, genial und originell«, dazu »freigiebig, eitel, gesellich, dienstfertig, lustig, zärdich, furchtsam und ängstlich« (Jb, 5. April 1833). Unruhe und Beweglichkeit waren allerdings nicht darunter. In der Verlobungszeit versprach sie Zügelung, »besonders in meiner Leidenschaft und Hitze! Ich folge jetzt mehr der Vernunft« (Jb, 12. November 1839). Noch die Siebzigjährige scheute sich nicht, mit ihrer Freundin Emilie List über Zäune zu klettern. W i e sie »das Kunststück fertig gebracht hatten, das war uns ein Rätsel«, so die Tochter (E. Schumann, S. 293). Wenige Jahre später war Clara Schumann allerdings in ihrer Beweglichkeit doch so eingeschränkt, dass sie sich 1892 in Heidelberg einen Rollstuhl bauen ließ, um nicht nur ihre täglichen Spazierrunden, sondern auch Ausflüge in die Schweizer Alpen fortsetzen zu können. »Ich kann dann doch länger in der Luft sein, als wenn ich gehe«. Sie verließe nur selten das Haus, schrieb sie dann im Januar 1895 an Maria Fellinger, »im Reisen bin ich so schwerfällig geworden«. Aber beim Klavierspielen, »da bin ich nicht ängstlich, haue auch wohl manchmal über die Schnur«. Clara Schumann blieb bis zuletzt kompetitiv. Beim Spiel des vierhändigen Arrangements von Brahms' Klarinettenquintett hängte die Fünfundsiebzigj ährige ihre Tochter einfach ab. »Unbarmherzig spielte sie weiter, sah lachend manchmal die Tante von der Seite an«, hielt ihr Enkel fest (in: Litzmann 3, S. 573 und 593; NZJM1917, S. 87). Im Allgemeinen galt Clara Schumann als unkomplizierter Gast. Das mochte sich mit zunehmendem Alter geändert haben. So berichtete der Basler Cel40
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
list Lutz-Stückelberger seiner Frau aus Spina-Bad Davos im Sommer 1877: »Clara Schumann mit 2 erwachsenen Töchtern sind gestern hier eingetroffen, leben sehr exclusiv und anspruchsvoll. Die ältere Tochter ist Robert Schumann wie aus dem Gesicht geschnitten« (in: Davoser Revue 1958, S. 93). Für sich wollten die Damen ruhige Zimmer mit Aussicht, sie brauchten aber auch einen Raum zum Musizieren. Dafür musste aus Bern extra ein Klavier herbei geschafft werden. Die Künstlerin war offenbar schreckhaft. Als junge Ehefrau schaute sie abends ängstlich unter das Bett und hinter die Schranktür, so dass Schumann ihr wünschte, es versteckte sich einmal ein Einbrecher, damit sie für ihre Mühe wenigstens belohnt würde (in: Lossewa 1997, S. 223). Wie Sabinina so berichtete auch Brahms 1855 über Clara Schumanns Nachtangst, die es ihr unmöglich machte, allein in einer Wohnung zu bleiben. Als im Februar 1885 dann tatsächlich in ihr Haus in Frankfurt eingebrochen wurde, ließ sie die Fenster vergittern und schaffte sich einen bissigen Hund namens Tuckily an. Sie plante sogar, »elektrische Klingeln« als Alarmanlage einzubauen. Doch »was sollen wir anfangen, wenn sie losgehen?« fragte sie Brahms. »Seit Jahren hatte ich schon immer die Befürchtungen, wurde aber mit meinen Ängsten immer aufgezogen«. Das »Gefühl der Unsicherheit und des Misstrauens« wären noch viel trauriger als der materielle Schaden, so die Schumann (Barth 1974, S. 2>7\Julchen, S. 167; Schumann-Brahms 2, S. 287ff). Warum »mich die Anderen lieben, das weiß ich nicht; ich bin kalt, nicht hübsch (das weiß ich auch) und nun die Kunst? die ist es auch nicht, denn unter meinen Verehrern sind die meisten keine Kunstkenner«, so charakterisierte die 18jährige Clara Wieck sich selber. Als Mädchen hätte sie hässlich ausgesehen, behauptete sie auch später noch (Bw, S. 114; E. Schumann, S. 299). Derart selbstkritische Bemerkungen gegenüber dem Bräutigam oder ihrer Tochter dürften nur für die privaten Adressaten bestimmt gewesen sein. In der Öffentlichkeit sollte dagegen ein positives Bild von der Künstlerin etabliert werden. Wie die unterschiedlichen Anforderungen zwischen privater und öffentlicher Figur gelebt wurden, gehört zu den spannendsten Momenten ihrer Künstlerbiografie. Offenbar besaß Clara Wieck Schumann die Fähigkeit, sich ohne weiteres den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Situationen anpassen zu können. Schon dem Kind gelang, seine Wahrnehmung so stark auf die Musik zu fokussieren, dass es sich vor der Umwelt verschloss. Im privaten Ambiente wirkte das allerdings sehr befremdlich. Schockiert notierte sich Schumann 1831 eine Züchtigungsszene im Haus Wieck, bei der der jüngere Bruder ver-
Lebensdokumente
41
geblich um Gnade wimmerte. »Zu allen diesen - lächelte Zilia u. setzte sich mit einer Weber'schen Sonate ruhig ans Ciavier. Bin ich unter Menschen?« Einige Zeit vorher hatte sich Schumann schon notiert: »Es kann Nichts kälteres beym Abschied geben als sie« (Tb 1, S. 354 und 364). Offenbar hielt das Mädchen auf diese Weise allzu hohe emotionale Anforderungen von sich fern, ein Modus, auf den Clara Schumann vermutlich ihr Leben lang zurückgriff. Als Kleinkind lebte Clara in ihrer Fantasiewelt. Sie hätte erst mit vier Jahren zu sprechen begonnen, wofür Friedrich Wieck das »nicht sehr sprachselig[e]« Kindermädchen verantwortlich machte (Jb, Oktober 1824). Das Kind weigerte sich, Sprache zu verstehen und zu benutzen, konnte aber nach Angaben des Vaters doch sehr gut Musik hören. Vielleicht reagierte es nur auf die Auseinandersetzungen seiner Eltern, die sich 1824 trennten. Auf jeden Fall half dieser selektive Autismus später auch der Virtuosin, sich über ihre eigene Befindlichkeit hinwegzusetzen und war Teil ihrer eisernen Auftrittsdisziplin. So wollte Clara Wieck ein Konzert in Berlin am 25. Januar 1840 auf keinen Fall ausfallen lassen, obwohl es ihr schlecht ging, weil »der Kronzprinz und die Kronprinzeß« im Publikum saßen. Alles lief »gut, ich stärkte mich in den Zwischenpausen mit Champagner«, schrieb sie Schumann. »Es gehört eine wahre Selbstverläugnung dazu, wie sie gerade besitzt«, so der Kommentar ihrer Mutter (in: Bw, S. 887). Selbstzeugnisse gehören zu attraktiven Dokumenten der Selbstkonstruktion. Clara Schumann hat zwar keine Autobiographie geschrieben, dafür umfangreiches Tagebuchmaterial und weit über 10.000 Briefe hinterlassen. Da die Künstlerin schon vor der Erfindung der Fotografie grafische Bildmaterialien zur Werbung nutzte, entstand während ihres gesamten Lebens eine Fülle von Porträts. Sie selber legte in den späteren Jahren auch Fotoalben an, in denen Familien-, Freundes- und Künstlerbilder gesammelt wurden (Synofzik/Voigt 2006). Erhalten sind außerdem ein Großteil ihrer Kompositionen. Leider schreckte sie vor den seit den späten 1880er Jahren möglichen Schallaufzeichnungen zurück, so dass keine Tondokumente angefertigt wurden. Dafür blieben zwei andere, besonders biedermeierlich-romantische Zeugnisse erhalten: die so genannten »Blumenbücher« für Robert Schumann und für Johannes Brahms. Briefe waren Clara Schumanns Hauptkommunikationsmittel. Da die Künstlerin einen großen Teil des Jahres auf Reisen und schon vor der Auflösung des Düsseldorfer Haushalts auch ihre Kinder, Eltern und Freunde an unterschiedlichen Orten verstreut waren, funktionierte das ganze Netz von Familienzusammenhalt und Freundschaften, aber auch von Geschäftsbe42
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Ziehungen und Konzertorganisationen hauptsächlich durch Briefe. Erst seit den 1860er Jahren nutzte sie die neuen Kommunikationsmedien Telegrafie, und später in Frankfurt schaffte sie sich dann, als die neu erfundene Technologie alltagstauglich wurde, auch ein Telefon an. Mehrere Stunden täglich verbrachte sie mit ihrer Korrespondenz. Lange Jahre antwortete sie persönlich. Erst als Uberlastungsbeschwerden sie dazu zwangen, delegierte sie ihren umfangreichen Schriftverkehr an Sekretärinnen und Sekretäre. Um während der wochenlangen Tourneen ihre Korrespondenzen weiter führen zu können, erwarb sie bei Asprey's in London einen tragbaren Klappschreibsekretär mit Fächern für Papier, Federn, Tinte und Visitenkarten - sozusagen ein Vorläufer heutiger Notebooks. Die erhaltenen Briefkonvolute lesen sich naturgemäß sehr unterschiedlich, den jeweiligen Funktionen und Empfängern, aber auch dem Lebensalter und den sich wandelnden Schreibkonventionen entsprechend. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte sich nicht bloß Clara Schumanns persönlicher Briefduktus. Aufgrund ihrer angespannten Berufstätigkeit wurde ihre Diktion deutlich knapper und direkter. Verglichen mit den Herzensergießungen der Frühromantik tendierte man indes in der Gründerzeit allgemein zu einem nüchterneren Stil. Aus jedem Briefwechsel blickt eine andere Clara Schumann aus den Zeilen. Die verhandelten Inhalte, aber auch die gewählte Sprache sind jeweils individuell auf den Dialog mit der oder dem Adressaten zugeschnitten. Auch entwickelten die Stile der Briefe an einzelne Personen über einen längeren Zeitraum hinweg ihre eigene Dynamik. Während die Korrespondenz mit Joseph Joachim im Laufe der Zeit einen geschäftsmäßigeren Tonfall annahm, färbten den Briefwechsel mit dem Verleger Hermann Härtel zunehmend persönlichere Töne. Clara Schumann fühlte sich den Härtels freundschaftlich verbunden und übertrug diese Herzlichkeit auch auf dessen Tochter Helene und den Schwiegersohn Richard Schöne. Man tauschte neben Organisatorischem auch Privates aus und nahm Anteil an persönlichen Freuden oder Katastrophen. Deutlich unterscheidet sich davon die Sprache in den Briefen an ihre Freundinnen Emilie List und Pauline Viardot-Garcia. Mit der ein Jahr älteren Emilie List freundete sich Clara Wieck 1833 an. Beide wurden zusammen konfirmiert. Die Lists lebten bis 1837 in Leipzig, wo Friedrich List, der sich dort als amerikanischer Konsul aufhielt, hauptsächlich am Ausbau eines gesamtdeutschen Eisenbahnnetzes arbeitete. Aus der Jugend- wurde eine stabile Lebensfreundschaft, die erst mit Clara Schumanns Tod endete. Die zwei Jahre jüngere Pauline Garcia lernte Clara Wieck 1838 als Künsderin kennen und Lebensdokumente
43
schätzen. Auch sie blieben lebenslang freundschaftlich verbunden. Mit List und Viardot-Garcia wurden inhaltlich andere Themen angesprochen, als in der Geschäfts- und Familienkorrespondenz. Man plauderte sozusagen auf Augenhöhe und noch im Alter in einem jugendlich vertrauten und oft bestechend nüchternen Ton miteinander. Etwas abweichend davon gestaltete sich die Kommunikation zwischen Clara Schumann und ihren Dresdner Freundinnen Marie von Lindemann und Emilie Steffens. Hier dominierte die große Virtuosin das Geschehen, deren aufreibender Alltag von den Freundinnen hilfsbereit unterstützt wurde. Gerade diese Korrespondenz mit der immer wieder kehrenden Auflistung der zahlreichen Botengänge und Besorgungen, die die Empfängerinnen in Dresden für Clara Schumann erledigen sollten, bietet einen plastischen Einblick in das aufreibende Schumannsche Familienmanagement. Familienbriefe erfordern einen besonders kritischen Umgang, beeinflussen dort doch sowohl von außen kaum einschätzbare innerfamiliäre Beziehungen, als auch bewusste Rollenklischees die inhaltliche Darstellung und den Stil. Die Reisebriefe, die Friedrich Wieck während der Tourneen mit Clara in den 1830er Jahren an seine Frau Clementine sandte, waren als vorlesbare Geschichten für einen begrenzten Hörerkreis aus Familienangehörigen und Freunden gedacht. Sie erzählen die Auftritte und Erfolge in den verschiedenen Städten aus Wiecks Sicht und bieten daher wertvolle Informationen über Claras Karriereaufbau aus der Veranstalterperspektive. Gleichzeitig enthalten diese Reisebriefe Anekdoten sowie Kopien von lokalen Zeitungsartikeln, die Clementine Wieck in Leipzig verbreiten sollte (Wieck Briefe, S. 82f). Darüber hinaus erfährt man vieles über das Verhältnis von Vater und Tochter. Friedrich Wieck schrieb temperamentvoll und plastisch. Einige seiner Mitteilungen allerdings sollten dennoch vertraulich bleiben, etwa Kommentare über Geschäftspartner oder über Personen seiner Umgebung. So musste die Empfängerin zu entscheiden wissen, was sie weitergab und was nicht. »Wie kannst Du aber unbedingt meine Briefe lesen lassen? das geht durchaus nicht«, so Friedrich Wieck im Januar 1838 aus Wien, »ich schreibe ja mannigmal Sachen unter 4 Augen u. meine Briefe sind ja zu eilig geschrieben.« In diesem Fall betraf es das bereits sehr angespannte Verhältnis zwischen Friedrich Wieck und Robert Schumann. »Was ich neulich über Schumann geschrieben, ist wahr, aber er soll nicht eben wissen, daß seine Gleichgültigkeit gegen Claras Ruhm mich so sehr kränkt« (Wieck Briefe, S. 78f). Um den künftigen Schwiegervater zu besänftigen, hat Robert Schumann offenbar 1838 die »Biographische Notiz über Klara Wieck« verfasst (in: GS 2, S. 287ff), in der er die fundierte Ausbildung der Virtuosin durch ihren Vater ausdrücklich würdigt. 44
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
In den (veröffentlichten) Briefen Clara Schumanns an ihre Kinder und Enkel nehmen disziplinierende Mahnungen einen großen Raum ein. Darin dürften sie sich kaum von anderen bürgerlichen Elternbriefen dieser Zeit unterscheiden. Auch Liszt spornte seine Kinder unentwegt zur Leistung an (Walker 1989,2, S. 459ff). Sicher muss man davon ausgehen, dass diese Briefe nicht nur von dem jeweiligen Kind, sondern auch von Geschwistern, Freunden oder anderen, an Ausbildung und Erziehung beteiligten Erwachsenen gelesen wurden. Es lässt sich daher schwer einschätzen, inwieweit Clara Schumann tatsächlich so strikt war, wie es aus den Briefen heraustönt, oder ob sie hier vorrangig sich als Instanz darstellt, die es als ihre wichtigste Aufgabe ansah, den Kindern und Enkeln feste bürgerliche Werte einzuprägen (Julchen 1990, S. 8f). Zumindest zeigt diese Korrespondenz ihre unerbittliche Seite. Gehorsam, Leistung und gutes Benehmen wurden eingefordert. »Meine Mutter erschien mir streng, und war es wohl auch in dem Sinne, dass sie die höchsten Anforderungen an Fleiß, Pflichttreue, liebevolle Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung an uns stellte« (E. Schumann, S. 159). Die andere, warmherzigere Mutter, die für ihre Kinder im Berliner Tiergarten Schokoladenmaikäfer vom Baum regnen ließ, mit ihnen Ausflüge machte und im Rhein badete, oder die Großmutter, die ihre Enkel mit Pralinen für die Zwischenaktpausen im Theater und in der Oper versorgte, bleibt in den Briefen weitgehend verborgen. Darüber berichten die Tochter Eugenie und der Enkel Ferdinand Schumann in ihren Erinnerungen. Die Briefe, die Clara Schumann mit ihrer eigenen Mutter gewechselt hat, sind nur auszugweise veröffentlicht. Hier konnte der im Archiv des RobertSchumann-Hauses in Zwickau aufbewahrte Bestand hinzu gezogen werden. Nach den offenbar vom Vater diktierten kindlichen Beiträgen werden die Zeugnisse in den 1840er Jahren persönlicher und aussagekräftiger. Clara Schumann hatte zu diesem Zeitpunkt inzwischen ein eigenes, selbst bestimmtes Verhältnis zu ihrer Mutter geknüpft. Thematisch drehen sich die Briefe überwiegend um traditionelle Mutter-Tochter-Themen wie Ratschläge zu Schwangerschaft, Geburt und Erziehung, manchmal auch vertrauliche Seufzer über die Eigenheiten des Ehemanns. Oft bittet Clara Schumann um personelle Unterstützung. Sie kam allerdings nicht immer zustande, weil M a riane Bargiel das Fahrgeld nicht selber aufbringen, und die Tochter ihre Mutter auch nicht immer subventionieren konnte oder wollte. Insgesamt schien die Tochter indessen auch vor ihrer Mutter bemüht, ihr Ehe-, Familien- und Berufsleben so positiv wie möglich darzustellen. So finden sich neben familiären Nachrichten immer wieder auch Erfolgsbilanzen ihrer Auftritte oder von gelungenen Aufführungen Schumannscher Werke.
Lebensdokumente
45
Liebesbriefe bilden eine spezielle Gattung. Für sie gelten besondere Kommunikationsregeln, die sowohl die Inhalte als auch die verwendeten Sprachcodes beeinflussen (Luhmann 1994, S. 21fF. und 163ff). Zwischen den Partnern Clara Wieck und Robert Schumann entwickelte sich erst nach und nach eine nur für sie geltende Liebessemantik in einer wechselseitigen Dynamik. Zunächst dürften bei den Formulierungen auch poetische Vorbilder für dieses Genre eine Rolle gespielt haben. Auch die Tatsache, vor den Augen der Öffentlichkeit als ideales Liebespaar zu stehen, beeinflusste die Schreibenden, selbst wenn die Briefe nicht vorrangig zur Veröffentlichung verfasst wurden. Sie spiegeln mehr als bloß romantische Herzensergüsse wider. Vielmehr geben sie einen umfassenden Einblick in das Innenleben der Protagonisten, die um ihre gemeinsame Zukunft verhandeln. Zur literarischen Selbstfindung gehörte die Übung, dem anderen gegenüber Gefühle zu formulieren, sowie die Erfahrung, kleine Zeichen, Andeutungen und Gesten des Gegenübers zu deuten. Außerdem musste getestet werden, wo Grenzen verliefen, an welcher Stelle Tabuzonen begannen und wie hoch oder niedrig Frustrationsschwellen lagen, etwa wenn es darum ging, wie und wovon man in gemeinsamer Zukunft leben wollte. Die persönliche Stilisierung, das Erschaffen einer eigenen, nur für das Liebespaar geltenden Tonart und die aus der intimen Zweisamkeit hervor gehenden individuellen Metaphern und Anspielungen erfolgten zwar auf der Grundlage konventionalisierter, literarisch bekannter Liebesformeln, sie enthielten aber auch einen privaten, nur für die Adressaten bestimmten Sinn. Er ist von heute aus wenn überhaupt, dann nur sehr begrenzt zu erschließen, weil die in den Mitteilungen enthaltenen Metamitteilungen, das heißt, das ganze Beziehungsgeflecht von erlebten Emotionen sowie die dahinter stehenden Geschichten, die für die Liebenden präsent waren, weitgehend unbekannt sind. Im so genannten »Brautbriefwechsel«, den Clara Wieck und Robert Schumann zwischen ihrer heimlichen Verlobung 1837 und der Heirat 1840 führten, erwarteten beide Seiten vom anderen Liebesbestätigung und Verständnis, artikuliert in einer emotionalisierten »Herzenssprache«. Kamen rationale oder organisatorische Dinge zur Sprache, so konnte der Stil sehr schnell als »kalt« gelesen werden. »Sey mir aber nicht bös, daß ich so einen vernünftigen Ton angenommen habe«, entschuldigte sich Clara Wieck. Anlass war die Frage nach dem künftigen Lebensunterhalt, ein die Briefe durchziehender Reizfaden, an dem sich immer wieder Kränkung und Missverständnis entzündeten. »Das gerade jetzt, wo ich jetzt gerade dieses Trostes bedarf, mich bald mit Dir vereinigt zu denken. Geh, Du bist kalt«, wehrte der Bräutigam frustriert ab (November 1838, Bw, S. 285ff). 46
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
Aufgrund des emotionalen Engagements stand sehr viel mehr auf dem Spiel, als allein die Wörter mitteilen. Insofern gehören die Liebesbriefe in Bezug auf emotionale Bedürfnisse und die Rekonstruktion subjektiver Befindlichkeiten zu Quellen ersten Ranges. Man erfährt aus ihnen, in welcher Idealkonzeption beide durch die Augen des anderen gesehen und bekräftigt werden mochten. Gerade in diesen Texten gilt es daher, den Einfluss von Wünschen und Projektionen, von Herzensöffnung und extremer Verletzlichkeit bei der Lektüre einzubeziehen. Neben den Liebesbeteuerungen enthalten die Briefe eine Fülle von Informationen über das, was in der jeweiligen Umgebung geschah, um den anderen am eigenen Leben möglichst umfassend teilhaben zu lassen. Dabei ist die Perspektive auf eine durch Liebe getragene Zweisamkeit ausgerichtet, bei der beide in allem Fühlen, Erleben und Handeln immer den anderen gleich mitdenken und davon ausgehen, dass das Gegenüber ähnlich oder gleich empfinde wie man selbst. Indessen zeigen Vergleiche zwischen Briefen und Tagebüchern, dass zwischen schriftlicher Emphase und mündlicher Kommunikation ein Unterschied bestand. So beginnen beide sich in den Briefen zu duzen, nachdem Schumann im September 1837 seinen Antrag gestellt hatte. Doch sich so vom anderen auch angesprochen zu hören, bedeutete noch einmal eine qualitative Steigerung. »Das Du zum erstenmal oft und aus ganzem Herzen«, trug Schumann am 8. Juni 1838 nach einem Besuch seiner Braut ins Tagebuch (Tb 2, S. 57). Die als Insel im Strudel der übrigen Welt jeweils literarisch fantasierte Gemeinsamkeit erforderte auch immer wieder einen mutigen und ehrlichen Klärungs- und Aushandlungsprozess. Clara Wieck und Robert Schumann führten ihn erfolgreich über lange Strecken miteinander und thematisierten neben den Liebesbezeugungen auch immer wieder ihre Frustrationen und gegenseitigen Verletzungen, um sie auszudiskutieren. Auf diese Weise gelang tatsächlich die glückliche Wandlung des idealisierten Bräutigams vom Prinzen zum Frosch und der Braut vom ephemeren Wunschbild zur gelebten Wirklichkeit. Diese Kommunikationsfähigkeit im Zeichen einer krisenerprobten Liebe bildete eine stabile Basis ihrer Auseinandersetzungen. Die Brautbriefe boten Clara Wieck Schumann Halt und Selbstvergewisserung nicht nur während des Prozesses um den Heiratskonsens gegen ihren Vater, sondern auch später während Schumanns Hospitalisierung und immer wieder in Phasen des Lebensrückblicks, in denen sie begann, ihren Nachlass zu sortieren. Als sie 1885 die Redaktion von Robert Schumanns Jugendbriefen abschloss, plante sie, auch »Auszüge aus Briefen an mich aus der Brautzeit« anzuhängen. »Diese haben wir noch nicht geordnet. Herzogenberg hat
Lebensdokumente
47
sie mitgenommen. Ich habe recht gesehen, wie schwer solch eine Herausgabe ist, wenn der Inhalt intimer wird«, notierte sie im Tagebuch. »Man empfindet das erst, wenn man einem Dritten vorliest« (in: Litzmann 3, S. 467). Die »Brautbriefe« haben für die Künstlerin den hochrangigen Stellenwert als Dokumente einer verflossenen Zeit und als symbolischer Schatz ihrer eigenen Biografie offenbar nie verloren. Sie wurden erst im 20. Jahrhundert, zwischen 1984 und 2001 von Eva Weissweiler und Susanne Ludwig ediert. Ihre Briefe an Theodor Kirchner, mit dem sie Anfang der 1860er Jahre ein Liebesverhältnis einging, sowie seine an sie gerichteten aus der Zeit zwischen 1857 und 1864 hat Clara Schumann vernichtet. Sie bot Kirchner im Austausch für die Rückgabe ihrer Briefe unter anderem das Autograph von Schumanns Abendlied op. 85 Nr. 12 an, das Kirchner sehr schätzte. Dass Renate Hofmann dann 1996 aber doch wenigstens einige von Clara Schumanns Briefen herausgeben konnte, ist Kirchners späterer Betreuerin zu verdanken. Diese hatte vorsichtshalber Kopien angefertigt (Vorwort, S. 5ff). Kirchner lernte Robert Schumann bereits 1837 kennen. Er gehörte zu dessen ersten Studenten im neu gegründeten Leipziger Konservatorium, und Schumann zählte ihn zu den hoffnungsvollen Talenten. Kirchner verkehrte ab und zu in der Familie, verehrte den Meister zutiefst und bot Clara Schumann 1857 Hilfe bei einer geplanten Tournee durch die Schweiz. Die Freundschaft intensivierte sich offenbar zu einem Liebesverhältnis im Sommer 1863. Ein Jahr später beendete Clara Schumann es definitiv (Brief vom 21. Juli 1864). Im Nachhinein hielt sie ihre Beziehung zu Kirchner für einen kapitalen Fehler: »Könnte ich doch diese Freundschaft ganz aus meinem Leben streichen, denn ich gab das Beste meines Herzens einem Menschen, den ich wähnte, durch diese Freundschaft vom Untergang zu retten [... ] Es war eine sehr traurige Erfahrung«, liest man 20 Jahre später im Tagebuch (in: Litzmann 3, S. 454). Als Elisabet von Herzogenberg 1884 auch bei Clara Schumann um eine Gabe für den notleidenden Kirchner anklopfte, verwies Clara Schumann unter dem Siegel der Verschwiegenheit auf dessen Spielsucht. Sie hätte ihn damals darin unterstützt, als Komponist und Musiker weiter zu kommen. »Er nahm das Geld, und - verspielte es!!! Und als ich kein Geld mehr gab, wie hat er sich da benommen!« (in: Kirchner, S. 21). Trotzdem spendete sie anonym hundert Mark. An die Marginalisierung dieser Freundschaft haben sich ihre Töchter als Nachlassverwalterinnen und auch der von ihnen zensierte Biograf, Berthold Litzmann, gehalten. In den Erinnerungen Eugenie Schumanns wird Kirchner nur gestreift, obwohl er sich wochenlang in Baden-Baden aufge48
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
halten hatte, und den Näherstehenden das Knistern zwischen ihm und Clara Schumann kaum entgangen sein dürfte. Die Affäre mit Kirchner (sofern sie überhaupt erwähnt wurde) blieb bis 1996 ein Gerücht. In den wenigen erhaltenen Briefen an Kirchner tritt Clara Schumann als fördernde und fordernde Künstlerin hervor, die jederzeit bereit war, ihren Partner zur musikalischen Arbeit anzuspornen und ihre Kontakte für ihn zu nutzen. Der Brahms-Briefwechsel ist ohne Vorbild. Die Basis ihrer Beziehung bildete ein Amalgam aus Musik, Liebe und Desaster. Sie wurde mit der existentiellen Krisenerfahrung von Robert Schumanns finaler Krankheit geboren und blieb unlösbar in diesem Dreierpakt verankert. Er wollte ihr beistehen, so lange sie allein wäre, versprach Johannes Brahms Clara Schumann am 24. Oktober 1854. »Herrscht erst wieder die Zweieinigkeit«, das heißt, kehrt der Gatte zurück, »dann bleibe ich erst recht«, fährt Brahms fort. »Ich träume und denke nur von der herrlichen Zeit, wo ich mit Ihnen beiden leben kann«. Wie wollte er das aushalten? Auf die Schumanns wirkte der jungenhafte Zwanzigjährige mit seiner hohen Stimme 1853 wie eine Erscheinung, die sie in jeder Hinsicht auf seinem Weg in die musikalische Welt hinaus zu fördern gedachten. Nur wenige Monate später kippte mit Schumanns Suizidversuch und der anschließenden Hospitalisierung die Situation völlig um. Nun unterstützte Brahms, half, fuhr nach Endenich, heiterte Clara Schumann und die Kinder auf, fahndete mit Joachim zusammen nach einer alternativen Klinik für Schumann. Brahms wurde fester Bestandteil eines Vakuums, in dem sich alle Beteiligten aneinander klammerten. Offenbar trug gerade die Aussichtslosigkeit der Situation dazu bei, dass beide, Johannes Brahms wie Clara Schumann, sich derart emotional öffneten. Eindeutige Äußerungen, dass sie in dieser Phase ihr Verhältnis zueinander überhaupt reflektierten, fehlen, teils, weil auch hier im Nachhinein Dokumente zensiert beziehungsweise in großem Umfang vernichtet wurden, teils, weil derartige Gespräche (wenn sie denn stattfinden) in der Regel nicht schriftlich fixiert werden. Mit Schumanns Tod brach alles zusammen. Die in unmittelbarer Nähe gemeinsam durchgestandene Katastrophe bildete einerseits den Kitt, der Clara Schumann und Johannes Brahms lebenslang zusammen klebte, und sie verhinderte gleichzeitig, dass sich eine unbelastete Beziehung zueinander entwickeln konnte. Beide hatten in ihre wunden Herzen geblickt und womöglich jeweils etwas anderes darin gesehen. Nicht der Altersunterschied von 14 Jahren, sondern die mentale Uberforderung durch die rational nicht zu bewältigende Ausgangssituation dürfte allen weiteren gemeinsamen PläLebensdokumente
49
nen im Weg gestanden sein. Die Briefe bis Ende der 1850er Jahre sprechen - trotz heftiger Zensur - eine emotionalere Sprache als danach. Beide versicherten sich ihrer Zuneigungen, grenzten sich aber auch immer wieder abrupt gegeneinander ab. Die Ursachen für Verletzungen und Kränkungen, die sie einander zufugten, sind nicht immer zu rekonstruieren. Abgehandelt werden sie anfangs über die Unvereinbarkeit von Clara Schumanns Tourneeplänen mit Brahms' Wünschen nach Gemeinsamkeit, gekoppelt an die - noch raren - Präsentationen seiner Musik. Wenn beide es trotzdem schafften, kritisiert von Freunden und beobachtet vom Publikum, eine Lebensfreundschaft zu schmieden, so deshalb, weil sie Musik ins Zentrum ihrer Kommunikation rückten und - zumindest in den erhaltenen Briefen - die persönlichen Belange dadurch sublimierten. Erst in den 1860er Jahren legte sich für Brahms anscheinend der »innere Aufruhr in dem Freundschaftsverhältnis zu Clara Schumann«, so Otto Gottlieb-Billroth (Gottlieb-Billroth 1935, S. 22). Der Weg aus dem Alltag heraus in einen musikalischen Diskurs ermöglichte dann die Artikulation gegenseitiger Wertschätzung. So konnten sie in einer Art Fernbeziehung zwischen Hamburg, Berlin, Wien und Frankfurt die Freundschaft erhalten. Beide wussten um ihre Prominenz, und sie mussten damit rechnen, dass ihre Korrespondenz später publiziert werden würde. Vielleicht diente die thematische Verlagerung des Austausches auf musikalische Belange auch als literarisches Mittel, um das private Innere vor Blicken von außen abzuschirmen. Clara Schumann tritt in den Briefen mehr und mehr als Musikexpertin und Mentorin in den Vordergrund. Insofern ist die Korrespondenz auch eine herausragende musikhistorische Quelle für die Entstehung und Aufführung von Brahms'Werken. Dass sich Schumann und Brahms überhaupt lebenslang Briefe schrieben, verweist auf eine bewundernswerte Fähigkeit zur verbindlichen Kommunikation, zu der jede Seite beigetragen hat. Brahms'legendäre Schroffheit milderte das Medium Brief. Und Clara Schumanns Wunsch nach eindeutigen, direkten Aussagen über seine Befindlichkeiten richtete sie nicht an Brahms, der darauf unwirsch reagierte, sondern vertraute sie ausgewählten Freundinnen und Freunden sowie ihrem Tagebuch an. »Spräche er doch ein Mal nur so innig in Worten!«, so Clara Schumann, nachdem sie Brahms' Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester op. 53 erhalten hatte (in: Litzmann 3, S. 232). Als Brahms und Schumann 1887 beschlossen, sich wechselseitig ihre Briefe zurück zu geben, erlebten beide eine tief aufwühlende, emotionale Phase. Die Lektüre versetzte Clara Schumann noch einmal in die Anfangs50
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
zeit ihrer Freundschaft mit all den zwiespältigen Gefühlen, der Todesangst und Trauer um ihren Mann, dem Trost und der Liebe von Brahms. Und sie begann damit, die wertvollen Dokumente zu vernichten, bis die Tochter sie stoppten, so jedenfalls die offizielle Version. Da waren die ersten Jahrgänge ihrer Briefe (1854 bis 1858) schon weitgehend zerstört. Es wären »lauter Klagelieder« darin, »die ich aber nie der Öffentlichkeit preisgegeben sehen möchte«. Brahms musste auf die Rückgabe seiner Briefe wochenlang warten. »Du bist das Karnickel, Du fängst an von der Sache, schickst aber nicht und liest!« Bevor sie sich widerstrebend von den Briefen trennte, schlug sie ihm vor, aufgrund der musikhistorischen Bedeutung vieler Ereignisse wenigstens Auszüge für die Nachwelt zu exzerpieren. »Was zwischen uns Gutes, zuweilen auch Betrübendes war, gehört ja nur für uns, niemand braucht es zu wissen«. Brahms versenkte seine Briefe stilecht bei Rüdesheim im Rhein, Clara Schumann hatte gebeten, ein paar, die ihr besonders lieb wären, behalten zu dürfen. Sie bilden heute den Bestand des Briefwechsels (Schumann-Brahms 1, Vorwort; Schumann-Brahms 2, S. 313ff.; Litzmann 3, S. 490ff). Manches, was von den empfundenen Gefühlen nicht ausgesprochen werden konnte oder sollte, ist vielleicht in die Blumenbücher eingegangen. Blumen waren in der biedermeierlichen Innigkeitskultur Teil der Gefühlskommunikation. Sie gehörten zum Familien- und Freundschaftskult (Biedermeier, S. 147ff). Neben den konventionalisierten Bedeutungen wie Rose für Liebe, Myrten für Hochzeit oder Vergissmeinnicht, die in Blumenalphabeten und Almanachen verbreitet wurden, haben Blumen auch individuelle biografische Bedeutungen. Clara Wieck hatte Weihnachten 1829 von ihrem Vater ein eigenes Stammbuch erhalten, das konventionelle Blumenmotti schmückte: Rose - »Abbild deiner Jugendblüthe«; Veilchen - »Sinnbild deiner Herzensgüte«. Die Blumenkultur und Blumensprache spielten auch in der Kommunikation zwischen Clara und Robert Schumann eine wichtige Rolle. Im Haushalt der Schumanns schmückten Blumen den Alltag. Auf den Schreibtisch ihres abwesenden Mannes stellte Clara Schumann frische Blumen - eine kleine Aufmerksamkeit, wie sie im täglichen Zusammenleben offenbar auch üblich gewesen war. Schon in ihren frühen Briefen schickte die junge Künstlerin kleine Blüten oder Blätter aus Sträußen mit, die sie nach ihren Auftritten empfangen hatte. Das Blumenbuch für Robert legte Clara Schumann im Herbst 1854 an, nachdem langsam klar wurde, dass sich dessen Klinikaufenthalt in Endenich über mehr als nur ein paar Wochen hinziehen würde. Gepresste Blüten und Blätter von Konzertbouquets oder von Spaziergängen wurden dort eingeLebensdokumente
51
steckt und mit Datum, Ort oder Anlass dokumentarisch beschriftet, um ihren Mann an den Erlebnissen teilhaben zu lassen. Dieses bis zu Schumanns Tod am 29. Juli 1856 geführte Album hat der Adressat selbst nicht mehr gesehen. Das Vorsatzblatt enthält die Widmung: »Blumenbuch für Robert / in der Krankheit vom / März 1854 bis July 1856 / angelegt von seiner Clara. / Den Kindern aufbewahrt.« Offenbar hatte Brahms ihr ein leeres Buch geschenkt, um es in diesem Sinne zu nutzen, wie Clara Schumanns Zeilen auf dem ersten Blatt preisgeben: »Von Johannes erhalten zur / Aufbewahrung von Blumen / für meinen lieben Robert / Hamburg d. 16. Nov: 1854«. Ein zweites, das nach seinem heutigen Aufbewahrungsort so genannte Berliner Blumentagebuch enthält botanische Zeugnisse aus den Jahren 1857 bis 1859. Es entstand vermutlich für Johannes Brahms. Allerdings bleibt auch hier offen, ob der Adressat es tatsächlich jemals zu Gesicht bekommen hat {Blumentagebuch, S. 14). Clara Schumanns Blumenbücher enthalten weitgehend nonverbale, emotionalisierte semantische Zeichen. Ihre emblematische Anlage vereint oft botanisch unspektakuläre, dafür aber im intimen Austausch symbolisch hoch beladene Objekte wie die Efeublättchen von Schumanns Grab, die sie im Juni 1858 und Juli 1859 pflückte. Brahms erhielt einige zugeschickt. An ihn gerichtet dürfte auch das »am Tage Johannes!«, am 24. Juni 1858, gepflückte Sträußchen aus Rose, Schleierkraut und Gartenthymian gewesen sein. Doch selbst diese unschuldigen Zeugnisse emotionaler Verbundenheit hat Clara Schumann zu einem späteren Zeitpunkt ganz offensichtlich zensiert. Stiefmütterchen und Rosen, die Brahms zu seinem 25. Geburtstag (7. Mai 1858) von Clara und Elise Schumann in Berlin überreicht bekam, wurden zur Erinnerung ins Blumenbuch eingesteckt. Die dort hinzugefügte ursprüngliche Widmung, »in treuiniger Liebe«, ist später überschrieben worden durch die neutralere »in treuem Gedenken« (Blumentagebuch, S. 60/61). Tagebücher gehören wie Briefe zu Egodokumenten mit einer speziellen Form von Information in teils bewusster, teils unbewusster Selbststilisierung. Sie erfüllen gleich mehrfache Funktionen: Sich allabendlich Rechenschaft über den vergangenen Tag zu geben, übernahm das Bürgertum als säkularisierte Introspektion aus pietistischer Tradition. Es entsprach einem Akt selbstkritischer Lebensführung und rechtfertigte, dass man sich so ausgiebig literarisch mit sich selbst befasste. Schließlich verschlang das Führen von Tagebüchern viel Zeit. Friedrich und Clara Wieck scheinen sie eher abends, Robert Schumann als Pflichtübung morgens vor Beginn des Arbeitstages eingeräumt zu haben. Von Brahms sind keine entsprechenden Dokumente bekannt. Oft 52
Zwischen Königin Louise und Queen Victoria
wurden Tagebücher aber auch nachträglich aufgefüllt. Im mitteilsamen Konzept bürgerlicher Privatheit standen Tagebücher wie Briefe durchaus einem begrenzten Leserkreis offen. Das gilt auch für die so genannten Jugendtagebücher Clara Wiecks. Friedrich Wieck hat das erste Tagebuch am 7. Juni 1827 im Namen seiner Tochter begonnen und dann rückblickend die ersten acht Lebensjahre des Kindes nachgetragen. Zu diesem Zeitpunkt, 1827, dürfte schon klar erkennbar gewesen sein, dass das Mädchen über mehr als eine nur gewöhnliche Begabung verfügte. Vielmehr rechnete Wieck nun mit einer besonderen Rolle seiner Tochter. Deren Karriereweg festzuhalten, dürfte überhaupt der wesentliche Impuls gewesen sein, das Tagebuch anzulegen. Das heißt, schon zu diesem Zeitpunkt begann eine Medialisierung ihres Lebens. Anfangs schrieb nur der Vater, bisweilen im Namen der Tochter. Vom 16. März 1828 an finden sich die ersten Zeugnisse von Clara Wiecks Hand. In noch ungelenker Kinderschrift begann sie, eine vorgeschriebene Textpassagen zu kopieren: »Den 16. März den 16. März habe ich mit meinem Vater und Herrn Doktor Carus« - . Nachdem sie sich bis dahin schon zweimal verschrieben hatte, schien der Vater ihr ungeduldig die Feder aus der Hand gerissen zu haben. Er beendete den Satz selber: »die Oper Faust von Spohr gesehen und gehört«. Beide füllten die Jugendtagebücher wechselseitig aus, wobei Friedrich Wiecks Anteil anfangs deutlich überwiegt. Im Jugendtagebuch erzählen außer einem neutralen Berichter vier unterschiedliche Autoren-Ichs, nämlich einmal Friedrich Wieck als Vater und als »Clara-Ich«, zum anderen Clara Wieck als Tochter und als »FriedrichIch«. Dieser letzte Fall kommt hauptsächlich dann vor, wenn das Mädchen Briefe ihres Vaters in das Tagebuch kopiert oder der Vater ihr die Einträge diktiert. Beide schreiben sowohl als auktoriale und als Ich-Erzähler, mal in der eigenen, mal in der Rolle des anderen. »Von nun an werde ich mein Tagebuch selbst schreiben, wenn ich nur irgend Zeit habe«, schreibt der Vater als Clara-Ich (24. Mai 1831). »Den letzten Mittag aß ich unten an der table d'hote und brachte mir den Rest der Bouteille Wein« mit, so die Zwölfjährige als Friedrich-Ich (16. Oktober 1831). Mitunter wechselt die literarische Identität des Subjekts unmittelbar. Im Mai 1832 beschloss der Vater, dass Alwin Wieck Musikunterricht bei seiner Schwester Clara nehmen sollte. Im Tagebuch liest man: »Ich [= der Vater] will nun noch einen letzten Versuch machen ob er vielleicht zum Klavierspiel mehr Lust bezeugt. / d. 17. Fing ich [= Clara] an ihm Klavierstunden zu geben u. der Vater zahlt mir für jede Stunde 1 gr«, beides geschrieben von Friedrich Wieck (16./17. Mai 1832). Da von Friedrich Wieck nur für die Zeit zwischen 1800 bis 1810 ein eigenes Lebensdokumente
53
Tagebuch vorliegt (Köckritz 2007, S. 23), gehören die gemeinsam geschriebenen Jugendtagebücher nicht nur zu zentralen Lebensdokumenten von Clara, sondern auch von Friedrich Wieck. In dem von Friedrich Wieck angelegten Jugendtagebuch überlagern sich verschiedene Aspekte. Zur Tagesbilanz zählte hier nämlich nicht nur die Rechenschaft über ein geordnetes Leben. Vielmehr standen oft die Lernfortschritte Claras im Vordergrund. Damit dokumentieren die Einträge - zumindest in den ersten Jahren - auch Friedrich Wiecks künstlerisches Erziehungsprogramm und seine Strategien, das »Wunderkind« zur Virtuosin zu fuhren. Aufgezählt werden neu einstudierte Stücke, einschließlich ihrer eigenen Kompositionen, aber auch der Wissensstand des Mädchens, seine musiktheoretischen und seine Sprachkenntnisse oder welche Opern und Schauspiele es kennen lernte. In diesem Sinne sind die Jugendtagebücher Fortschrittsprotokolle der Schülerin, aber auch Erziehungsprotokolle des Lehrers, wie schon Wiecks Wöchentliche Bemerkungen über den Schüler Emil Metzradt von 1809. Vorbild könnte Johann Heinrich Pestalozzis Tagebuch über die Erziehung seines Sohnes von 1774 gewesen sein (Köckritz 2007, S. 86ff.; Brändle u.a. 2001, S. 10). Darüber hinaus dienten die Einträge über Auftritte, kleine und große Reisen, Ausgaben und Einnahmen sowie die zahlreichen Besuche und Bekanntschaften auch der Dokumentation der Karriereplanung. Viele Kommentare widmete Friedrich Wieck außerdem der Evaluierung von Klaviermethoden sowie der Beschaffenheit von diversen Klavieren und Flügeln, ihren Vorzügen und Nachteilen, Klangfarben und Mechaniken - heute eine wertvolle Quelle für die Aufführungspraxis. Durch die Einträge als Clara-Ich lenkte der Vater die Blickrichtung des Kindes, eine gezielte Erziehungsmaßnahme. An den Abschriften, die das Kind wiederum von väterlichen Briefen ins Tagebuch eintrug, konnte sowohl mechanisch als auch stilistisch Schreiben geübt werden. Zugleich impften sie dem Mädchen ein, was der Vater alles unternommen hatte, um die Tochter zu fördern und bekannt zu machen, gekoppelt mit impliziten und expliziten moralischen Ermahnungen. »>Vergiß nie, daß die größte Kunst die Tugend istDer Wanderer< mit« (Jb, 10. März 1831). Das Lied ist ein beeindruckendes Zeugnis früher Schubert-Rezeption und zeigt eine bemerkenswerte Umsetzung des Vorbilds, wie Michael Struck dargelegt hat (Struck 2001, S. 33ff). Zu den wesentlichen Eindrücken der Sechsjährigen zählte eine im »Großen Kuchengarten«, einem behebten Leipziger Ausflugslokal, gespielte Polonaise aus Louis Spohrs Oper Faust, die sie »hebgewonnen« hatte. Ähnlich wie im Wiener Prater wurde dort öffentlich Unterhaltungsmusik geboten (Dießner 2005, S. 68). Am Klavier sucht sich dann das Kind »einige Tänze« aus dem Gedächtnis zusammen (Jb, 1. Mai 1826). Neben Carl Maria von Webers Aufforderung zum Tanz op. 65 hatte Clara Wieck ab 1826 auch verschiedene Tänze von Schubert, Field und anderen zeitgenössischen Komponisten einstudiert. Dazu kamen Rondos, Duos, Trios sowie Kammermusik und Konzerte von Mozart, Hummel, Dussek, Kalkbrenner, Pixis, Moscheies und Spohr. Sie bildeten den Erfahrungshintergrund für das eigene Komponieren. Nur singulare Beispiele von den vielen im Jugendtagebuch erwähnte Stücken dieser ersten Jahre haben sich erhalten. Die 1830 erwähnten »Tyrolerlied«-Variationen, für die vielleicht Hümmels Air ä la tirolienne avec Variations op. 118 aus dem selben Jahr Pate standen, Scherzi in As- und in F-Dur (1832), Rondos, »einige Capricen« (Juli 1833), Walzer, Lieder und Chöre sowie ein »Elfentanz« (1834) sind ebenso wenig erhalten wie ein im Kasino von Chemnitz aufgeführtes »Scherzo für Orchester« und eine »Ouvertüre für Orchester« (Jb, 13. und 29. August 1833). Eine Polonaise in Es-Dur, die Clara Wieck am 4. Oktober 1829 Paganini vorspielte, könnte identisch sein mit der Polonaise op. 1 Nr. 1. Paganini lobte die Komposition und bestätigte zuvorkommend die künstlerische Veranlagung des Mädchens. Man plauderte mit Hilfe eines Dolmetschers (F. Schumann, in: NZJM1917, S. 85). Ihre Quatre Polonaises pour le Pianoforte op. 1, die 1831 im Verlag Hofmeister in Leipzig erschienen, spiegeln in ihrem unschuldigen Charakter den kindlichen Erfahrungshorizont. Bei den Stücken fällt indessen die großzügige tonale Disposition auf. Eine farbige Harmonik und die Lust an exponierten zwickenden Dissonanzen gehören zu ihren Besonderheiten. Dazu kommen Schwierigkeiten wie das Überschlagen der Hände, die zeigen, was die Elfjährige an Spieltechniken beherrschte. Gleich drei Rezensionen erhielt Erste Kompositionen. Werke 1 bis 5
83
die Komponistin auf ihr Opus 1, zwei ermunternde, beide im Allgemeinen musikalischen Anzeiger (1832, S. 143; 1833, S. 66), und eine tadelnde von Reilstab in der Iris (1831, S. 96). Rellstab störte nicht allein die »oft namentlich dissonirend[e]« Harmonik, vielmehr fand er grundsätzlich eine Veröffentlichung unangebracht: »Welcher Vernünftige wird Schulexercitia drucken lassen, auch wenn sie noch so gut ausfallen?« Die Vorliebe fur ausdrucksvolle harmonische Wirkungen steigert sich noch in den Caprices en forme de Valse pour le Piano op. 2, einer losen Reihe von neun kleinen Charakterstücken, deren Gemeinsames der Walzerrhythmus ist. Doch in der Klangwirkung überwiegt der Eindruck von »Caprice« (Laune), aufgrund der Individualität der Stücke. Man spürt das Vergnügen, die eigenen Kräfte auszuprobieren und über die Stränge zu schlagen. Die zweite Caprice in D-Dur lebt gänzlich vom Sog harmonischer Fortschreitungen und endet offen in einem leise verklingenden morendo in unaufgelöster Dissonanz - ein räumlicher Effekt, wie ihn zuvor Schumann am Schluss der Papillons op. 2 vorgeführt hatte. Auch im achten Stück, einem temperamentvollen raschen Satz (Allegro assai), stechen wiederum die ausdrucksvollen harmonischen Effekte hervor. »Ihre kindliche Originalität zeigt sich an allem«, hielt Robert Schumann fest und fand, sie spielte ihre Capricen, die eher Impromptus oder »Wiecksche moments muscials« wären, »wie ein Husar« (Tb 1, S. 383f). Die Capricen erschienen 1832 parallel bei Stoepel in Paris und bei Hofmeister in Leipzig. In Czernys Systematischer Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte op. 200 von 1829 finden die frühen Kompositionen ihren theoretischen Hintergrund. Czerny empfiehlt dort, »musikalische Tagesneuigkeiten« sowie »geschmackvolle Wendungen« aufzugreifen (in: de Vries 1996, S. 130f). Dazu zählen bei Clara Wieck charakteristische virtuose Terz-, Sext- oder Oktavparallelen, kühne Sprünge und gewagte Akkordverbindungen, komplexe Tonleiter- und Arpeggiofiguren oder so genannte »Fioreturen« (melodische Verzierungen). Zur Variation, so Czerny, eignete sich vorzugsweise ein »schöner Gesang« mit wenig Modulation, symmetrisch gebaut und in einem »verständlichen Rhythmus«. Dem entspricht Clara Wiecks schlichtes Thema der Romance variée op. 3, die zwischen 1831 und 1833 entstand. Die Melodie stammt womöglich aus einer noch früheren Phase, da Schumann das Thema bereits im Oktober 1830 notierte (Tb 1, S. 321). Ihre Variationen ordnete Clara Wieck paarweise und stellt je eine lyrisch-poetische und eine technisch-brillante zusammen. Die Herkunft dieses Stücks aus dem noch kindlichen improvisatorischen Spiel lassen sowohl die kurze Introduktion als 84
Tochter und Vater
auch virtuose Kadenzen erkennen (Variation 1 und Variation 7), sowie der »a piacere« zu gestaltende Schluss der fünften Variation. Als das Stück 1833 bei Hofmeister in Leipzig gedruckt wurde, dürfte Clara Wieck bereits über das hier fixierte Niveau um einiges hinaus gewesen sein. Die Romanze erhält ihren biografischen und musikhistorischen Wert erst durch die spätere gemeinsame Geschichte von Clara Wieck und Robert Schumann. Ihm ist das Stück nämlich gewidmet. Damit gehört die Romance variée op. 3 zu den ersten öffentlich dokumentierten Beispielen ihrer musikalischen Kommunikation. »Sosehr, wie ich es bereue, Ihnen beifolgende Kleinigkeit dedicirt zu haben, und sosehr wie ich wünschte, diese Variationen nicht gedruckt zu sehn, so ist das Unheil doch nun einmal geschehen, und ist folglich nicht zu ändern. Deswegen bitte ich um Verzeihung wegen des Beifolgenden«, lautete das Widmungsschreiben (Bw, S. 9f). Inzwischen hatte Schumann die Basstöne der Romanze zur Grundlage seiner Impromptus über ein "Thema von Clara Wieck op. 5 gemacht und die kindliche Vorlage in seinem eigenen Stil weiter entwickelt. An den 1835 gedruckten Valses Romantiques op. 4 lässt sich ablesen, wie der geistige, musikalische, aber auch der virtuose Horizont der Fünfzehnjährigen sich veränderte. Inzwischen hatte Chopin ihren Idolhimmel gänzlich erobert, was sich besonders an manchen Klangkombinationen bemerkbar macht. Formal knüpfen die Walzer in ihrer losen Reihung dagegen eher an Walzerketten von Lanner, Strauß oder Schubert an. Die Attraktion von Tänzen liegt in der Leichtigkeit der Bewegung im Raum. Tanzschritte sind nicht zielgerichtet, die Bewegungen nicht pragmatisch. Vielmehr bereitet Tanzen sinnliches wie ästhetisches Vergnügen und verweist nur auf sich selbst. Clara Wiecks Walzerketten erinnern an die Erfahrung eines gleichsam wirbelnden Vergnügens, und sie zeigen ihre Lust, voll in die Tasten zu greifen und die Töne springen zu lassen. Schwärmerisch wirken die geheimnisvollen »leisen Mondscheinakkorde« (Schumann) der Introduktion, gemeint sind drei über dem Orgelpunkt G geschichtete Septakkorde, die den musikalischen Tonraum der Walzer aufspannen. Mit dem Verfahren, in den Trios neues Material einzuführen, das dann in dem folgenden Walzer aufgenommen wird, stellt Clara Wieck Bezüge unter den einzelnen Abschnitten her, wenn auch nicht nach einem eindeutig erkennbaren Plan. Vielmehr wirkt der Zusammenhalt eher assoziativ. Außerdem kultiviert die Komponistin durch unkonventionelle Klangverbindungen, sprunghafte Ubergänge und überraschende Kehrtwendungen ein modernes Moment des Unvorhersehbaren, dessen Versuchscharakter Schu-
Erste Kompositionen. Werke 1 bis 5
85
mann diplomatisch in eine metaphorische Szene versetzte. »Auf dem Flügel lag aber ein Rosenzweig [...], der von der Erschütterung nach und nach in die Tasten geglitten war. W i e nun Zilia nach einem Baßton haschte, berührte sie ihn zu heftig und hielt inne, weil der Finger blutete« (GS 1, S. 202). Diese Erzählung korrespondiert mit Beschreibungen von Clara Wiecks quirligem Temperament und ihren rasch wechselnden Stimmungen. Doch zieht spätestens der konventionelle, pompöse Schluss die Walzer entschieden dahin zurück, wo ihr tatsächlicher Auffiihrungsort war: in den Musikpavillon des Leipziger »Großen Kuchengartens«. Dort erklang am 26. August 1835 Clara Wiecks Orchesterfassung ihrer Walzer op. 4. Partitur und Stimmen gingen verloren. Tanzformen prägen auch die Vier Charakterstücke op. 5, die vermutlich zwischen 1833 und 1836 komponiert wurden. Hier wird ein anderer Horizont aufgespannt, nämlich ein Widerschein von Clara Wiecks Opernbegeisterung. »Bei Marschner, der Essen usw. über Clara vergisst, und sie den musikalischen Engel nennt, waren wir gleich den 2ten Tag [ . . . ] Clara schwelgt mit ihm in lauter Teufeln, Hexen und Doppelgängern«, meldete Wieck aus Hannover 1835 ( Wieck Briefe, S. 56). In Opern wie Heinrich Marschners Vampyr von 1828, aber auch in dessen 1833 komponierten Hans Heiling, wo es um einen zwielichtigen Erdgeist in Menschengestalt geht, ist das Arsenal der Vertreter des Unheimlichen und Schauerhaften in den Libretti und Partituren präsent. Auch Louis Spohrs Faust-O-pzr von 1816, die Clara Wieck am 16. März 1828 in Leipzig sah, oder Paganinis Variationenzyklus Le Streghe von 1813 zeugen von der anhaltenden Attraktion des Hexensujets. Gleich zwei Nummern der Charakterstücke op. 5 widmen sich dieser Thematik, das erste Stück, »Impromptu. Le Sabbat«, und das vierte, »Scène fantastique. Le Ballet des Revenants«. Beide Stücke bestechen durch grelle Klangfarben und rhythmische Vehemenz. Das Impromptu (Nr. 1) beherrscht eine Figur, die von drei charakteristischen Elementen geprägt ist, nämlich einer knappen rhythmischen Formel aus zwei kurzen und zwei langen Schlägen, scharfen Sekundvorschlägen und extrovertierten Sprüngen, deren Betonungsakzent dem Taktmetrum zuwiderläuft. Sie beherrscht den wilden, spukhaften Tanzsatz in fortstürzendem Tempo (Allegrofurioso), den der Titel »Le Sabbat« (Hexensabbat) verspricht. Der Eindruck von Unrast steigert sich noch dadurch, dass im mittleren Abschnitt ein dualer Rhythmus das Dreiermetrum des Grundtaktes überlagert und man sozusagen den Boden unter den Füssen verliert. Im vierten Stück, einem »Scène fantastique« genannten Hexenballett, unterstreicht die durch Dynamik und Phrasierung hergestellte Illusion von 86
Tochter und Vater
Nähe und Ferne in Kombination mit grellen Klangfarben sehr wirkungsvoll den spukhaften malerischen Effekt. Anregungen könnte Clara Wieck aus dem 1835 erschienen Lisztschen Klavierauszug von Hector Berlioz' Symphonie fantastique bezogen haben, auch wenn sie sich konkret nicht nachweisen lassen. Zwei Momente prägen Clara Wiecks »Scène fantastique«, einmal die formale Gliederung in geschlossene, dreiteilige Tanzabschnitte und zum zweiten die inhaltliche Verbindung der Abschnitte untereinander durch eine wechselnde Kombination von fünf melodischen beziehungsweise rhythmischen Motiven. Die unterschiedlichen Tanznummern werden durch ihre schlagzeughaft eingesetzten Rhythmen charakterisiert, wie dem galoppartigen, pulsierenden Grundelement aus langem und zwei kurzen Impulsen. Dieser Rhythmus, den Schumann als Variante eines Fandango notierte, spielt auch im Kopfsatz seiner etwa zeitgleich komponierten Klaviersonate fisMoll op. 11 eine wesentliche Rolle. Auch Clara Wiecks schlagzeugartiges Tritonussignal aus dem Eingang des »Hexenballetts« taucht in Schumanns Satz auf, dort in Quinten. Am Schluss der »Scène« verflüchtigt sich der Spuk unter liegenden Harmonietönen im Diskant wie am Ende von Mendelssohns Ouvertüre zum Sommernachtstraum op. 21. Ein rascher Kastagnetteneffekt charakterisiert das zweite Stück aus Opus 5, die »Caprice à la Boléro«. Zwar ist das Stück scherzoartig angelegt, doch anstelle eines Trios enthält es einen kontrastierenden, lyrischen Mittelteil. Ruhiger als der dahinfegende Bolero und zart {più tranquillo e dolci) soll der Vortrag sein. Hier entströmt in einem gleichsam zäsurlosen Fluss ein bislang nicht gehörter lyrischer Aspekt. Soll er gelingen, so müssen die einzelnen, sich überlagernden Stimmen individuell artikuliert werden. Gleichzeitig durchzieht eine unterschwellig vibrierende Spannung den Part. Sie resultiert aus der rhythmisch-metrischen Faktur. Das Grundmetrum im Dreivierteltakt und die Gliederung der melodischen Phrasen in Zweiergruppen, die auf ein Sechsachtelmodell bezogen sind, halten sich gegenseitig in der Schwebe. Der neue lyrische Ausdruck entfaltet sich dann vollständig im dritten Stück, einer liedhaften »Romance« (Andante con sentimento). Ihre warme Klangfarbe entsteht durch den vollstimmigen Satz. Zwar klingen Melodie und eine Achtelbegleitung heraus, doch werden diese Elemente durch Liegetöne und akkordische Ausfüllungen klanglich verdichtet. Ungewöhnlich ist die tonale Dramaturgie. Dem Beginn in H-Dur folgt ein Mittelteil in D-Dur, doch die Reprise wechselt nach h-Moll, so dass das Stück gefühlvoll beginnt und mit einem Anflug von Melancholie und Ernst endet. Obwohl es sich anbietet, die vier Charakterstücke op. 5 als Zyklus aufzufuhren, scheint Clara Wieck sie nur einzeln vorgetragen zu haben. Mehrfach findet sich die Bezeichnung Erste Kompositionen. Werke 1 bis 5
87
»Hexentanz«, manchmal auch »Hexenchor« in den autobiographischen Quellen. Es ist nicht immer sicher, ob das erste oder das vierte Stück gemeint ist. Von ihrem Opus 1 an erhielt die junge Komponisten aufmerksame Rezensionen in der musikalischen Fachpresse. Dieses Feedback dürfte sie bestärkt haben, ihre kompositorische Arbeit fortzusetzen. Im Sommer 1835 beschäftigten Clara Wieck und ihre Freundin Emilie List allerdings vor allem die jungen Verehrer. Im Mittelpunkt ihres Interesses stand »Herr Schumann«. Der hatte sich inzwischen mit Ernestine von Fricken verlobt, schwelgte jetzt in Liebe und wäre ganz solid geworden, »geht um 11 Uhr ins Bett und steht um 7 Uhr auf, und nicht um 10 Uhr wie sonst«, so Clara Wieck (6. August 1835). »Herr Schumann kommt jetzt alle Tage hierher und ist glücklich« (7. August 1835). Sie hielt Emilie auf dem Laufenden und wünschte sie in Leipzig. »Ich hoffe an Dir eine verschwiegene Freundin zu besitzen« (in: Wendler, S. 47ff). Bekanntlich platzte die Verlobung, und Clara Wieck signalisierte Entwarnung, Schumanns bevorstehende Hochzeit wäre nur ein Traum gewesen (9. September 1835). An der Schilderung ihres 16. Geburtstags, deren Feier sie Emilie ausfuhrlich schilderte, kann man ablesen, wie attraktiv die junge Künsderin inzwischen war. Unter den Geburtstagsgästen scheinen sich ausschließlich männliche Fans aus der jungen Leipziger Kunstszene befunden zu haben. Clara Wieck wurde reich beschenkt, mit drei Kleidern, einem Umschlag- und einem Halstuch sowie Hausschuhen von den Eltern, was auf einen soliden Wohlstand schließen lässt. Die Freunde brachten Gedichte, diverse Bücher, darunter eine Ausgabe mit Edward Bulwer-Lyttons experimentellen Romanen (ein Geschenk von Schumann) und, als Höhepunkt, eine goldene Zylinderuhr von den »Davidsbündlern«, vertreten durch Schumann, dessen Freund Moritz Reuter, den Pianisten Louis Rakemann und Ernst Ferdinand Wenzel sowie ihrem Cousin Ernst Pfundt, Paukist am Gewandhausorchester. Das kostbare Stück befindet sich heute im Robert Schumann-Museum in Zwickau. Man frühstückte im Kuchengarten. Clara Wieck war so überwältigt von dem überraschenden Ereignis, dass sie »kein Wort hervorbringen« konnte. So bedankte sich der Vater »an meiner statt«, gestand sie Emilie. Das gemeinsame Mittagessen beehrte auch Mendelssohn, und zur Verblüffung aller wagte das Geburtstagskind dann doch noch einen Toast. Später wurde musiziert und getanzt. Das Fest beschloss ein Nachtspaziergang. Clara Wieck befand sich am Beginn ihrer internationalen Laufbahn. Der so ausgiebig gefeierte Geburtstag markierte den unbeschwerten Abschied von ihrer bewegten Kindheit.
88
Tochter und Vater
Wieck gegen Wieck Schritte in die Selbständigkeit
Das Skandalon, den Prozess, wollte sie zunächst auf gar keinen Fall. Lange hat sich Clara Wieck dagegen gewehrt, immer wieder gehofft, man würde sich einigen können und der Vater irgendwann nachgeben. Stattdessen verhärteten sich die Fronten 1838 und 1839 dramatisch, und die Nerven lagen auf allen Seiten bloß. Clara Wieck befand sich allein auf Tournee in Paris, als sie dem letzten Schritt, der Klage vor Gericht, zustimmte. Sie wohnte bei Familie List, fand dort aber wenig Entlastung, denn ihre Gastgeber hatten den Verlust ihres Sohnes zu verkraften. Robert Schumann kam aus Wien zurück und erfuhr vom Tod seines Bruders Eduard. Ihm schwankten die Fundamente unter den Füßen, weil alles zu misslingen schien. Friedrich Wieck diktierte Bedingungen für einen Ehekonsens, die beide nicht zu erfüllen bereit waren. Am 15. Juni 1839 unterzeichnete Clara Wieck schließlich die Vollmacht für den Anwalt Wilhelm Einert, der ihre Interessen vor dem Sächsischen Appellationsgericht in Leipzig vertrat. Wie stark sie unter Strom stand, verrät der Begleitbrief: »Der Augenblick des Unterschreibens war der Wichtigste meines Lebens, doch ich [... ] war unendlich glücklich, so glücklich, dass ich jetzt büßen muss, indem ich mir durch die Aufregung ein Unwohlsein zugefügt« (Bw, S. 572). Die moderne, seit 1835 praktizierte Rechtssprechung schränkte die Elternrechte bezüglich der Heiratsverweigerung ein und schaltete vor einen Prozess noch zwei Schlichtungstermine, nämlich einen »Sühneversuch« mit dem für die Trauung zuständigen Geistlichen und einen »Gütetermin« vor Gericht. Alle Beteiligten hatten persönlich zu erscheinen (Preiß 2004, S. 85ff). Sowohl Clara Wieck, die ihre Tournee deswegen abbrach, und Robert Schumann als auch Mariane Bargiel, deren Zustimmung ebenfalls erforderlich war, fanden sich zur ersten Schlichtung am 31. August 1839 beim Archidiakon Fischer in Leipzig ein. Nur Friedrich Wieck erschien nicht, sondern ließ wissen, »dass er seine Einwilligung nie geben werde« (G. Nauhaus, in: Tb 2, S. 497). Auch beim »Gütetermin« vor Gericht fehlte Wieck. Zur nächsten Sitzung, am 18. Dezember 1839, brachte er eine umfangreiche Erklärung mit und erhob neue Anschuldigungen gegen Schumann. »Alles das nutzte ihm nichts«, hielt Clara Wieck fest. Ihr Vater geriet dermaßen in Rage, dass er mehrfach zur Ordnung gerufen wurde, und die Tochter konnte es kaum ertragen, »diese Demütigung« mitzuerleben. »Ich war [...] wie festgenagelt auf meinem Stuhl«. Obwohl sie sturzwütend gewesen war, weil die Schritte in die Selbständigkeit
89
Wiecks ihren »Briefkasten erbrochen, und die Briefe gelesen« hatten, konnte sie doch ihren Vater »nicht erblicken, ohne das tiefste Mitleid zu hegen« (Jb, 18. Dezember 1839). Bei dem am 4. Januar 1840 ergangenen Urteil forderte man von Wieck Beweise fiir den behaupteten schlechten Lebenswandel seines Gegners und von Schumann Entlastungsbelege, um seinen Ruf zu verteidigen. Indessen konnte Wieck keine Zeugen aufbringen, wie er am 6. Juli 1840 dem Gericht mitteilte. Damit waren die Anklagepunkte hinfällig. Nun strengte Schumann umgekehrt eine Verleumdungsklage gegen Wieck an. Noch im Juli begann das Paar mit der Wohnungssuche. »Von unserer Trauung haben wir Niemandem gesagt — wir wollen die Sache ganz im Stillen abmachen [...] Ich zittere und bebe vor dem Tag, aus Freude und Angst«, so die Braut (Jb, 19. Juli 1840). Clara Wieck und Robert Schumann, beide bereits öffentlich bekannte Persönlichkeiten, wollten keinen lautstarken Triumph. Allein durch ihre bescheidene Zurückhaltung und die äußerliche Gefasstheit setzten sie Wieck und dessen cholerische Attacken ins Unrecht. »Unsere Trauung denken wir keinesfalls in Leipzig zu vollziehen, das kann ich Dir als gewiß versprechen« (Bw, S. 565), hatte Clara Wieck ihrem Vater im Juni 1839 noch zugesichert. Überhaupt wollte man Sachsen verlassen. Doch was zählten schon Beteuerungen im emotionalen Sturm? Am Ende blieben sie doch in Leipzig, und Friedrich Wieck räumte das Feld. Am 1. August 1840 erteilte das Gericht den Konsens. Zwei Wochen später erfolgte das erste Aufgebot. Die Virtuosin unternahm währenddessen noch ihre kleine »Abschiedstournee« unter ihrem Geburtsnamen. Die Hochzeit fand weder in der Nikolaikirche statt, in der Clara Wieck getauft, noch in der Thomaskirche, in der sie konfirmiert worden war, sondern ganz schlicht und ohne Aufhebens am Morgen des 12. September 1840 in der Gedächtniskirche von Schönefeld, damals noch ein außerhalb von Leipzig gelegenes Dorf. Eine auserlesene Schar von Freunden versammelte sich mittags im Haus von Claras Tante Emilie Carl, unternahm dann einen kleinen Ausflug in den englischen Garten von Zweinaundorf. Man feierte moderat und tanzte auch ein wenig. Der Tag blieb so andächtig hoch gestimmt, dass die frisch getraute Clara Schumann tatsächlich an der fröhlichen Feierlaune ihrer Freundinnen Emilie und Elise List Anstoß nahm. »Alles blieb in den gehörigen Schranken des Anstands; es herrschte keine Ausgelassenheit, und doch auf allen Gesichtern eine innere Zufriedenheit« (Jb, 12. September 1840). Schon während der Prozessjahre hatten sich die Brautleute vergeblich um Diskretion bemüht. »Unsere Sache scheint leider Stadtgespräch«, schrieb Schumann am 14. Januar 1840 (Bw, S. 871). Clara Wieck ließ sich in Leipzig 90
Tochter und Vater
nur blicken, wenn das Gericht auf ihre Anwesenheit bestand. Dann kroch sie bei ihrer Tante unter, da sie nicht nach Hause und - unverheiratet - natürlich auch nicht einfach bei Schumann einziehen konnte. W e n n sie nicht konzertierte, zog sie sich nach Berlin zu ihrer leiblichen Mutter zurück. Gerade durch das Vermeiden von Öffentlichkeit breitete sich der Klatsch rasch aus. Alle wussten es. Freunde und Feinde polarisierten sich schnell. Allerdings schlugen die Herzen doch mehrheitlich für die Verlobten. Chopin und Liszt bekundeten diskret ihre Sympathien für das Paar und versprachen Unterstützung. Als die Zeitschrift Unser Planet im August 1840 in einer Notiz wohlwollend, wenn auch im Detail nicht ganz korrekt, über den glücklichen Prozessausgang berichtete, schaltete Schumann sogar den Leipziger Zensor Friedrich Bülau dagegen ein, mit dem Argument, dass »Privatangelegenheiten überhaupt nicht für die Oeffentlichkeit, viel weniger gerade diese so zarte, deren Besprechung die Künstlerin, die es angeht, wie mich nur auf das Schmerzlichste verwunden muß« (in: Preiß 2004, S. 212 und Tb 3, S. 704). Clara W i e c k war eher entschlossen, Zeitungsnotizen einfach zu übergehen, und hatte Schumann schon früher beruhigt: »Lasse sie schreiben, bös oder gut, wir wollen der Welt am besten zeigen wie es mit uns steht« (Bw, S. 758). Obwohl sie den Prozess gewonnen und das Brautpaar sich im Blick der Öffentlichkeit vorbildlich verhalten hatte, kämpfte Clara W i e c k offenbar stark mit moralischen Skrupeln. Gegen die Eltern vor Gericht zu ziehen, verletzte ein starkes Tabu. Und zu erleben, wie ihr Vater demontiert wurde, wühlte auch tiefere Emotionen auf, als bloß Ungehorsam. Vielmehr stand die gesamte, fest mit dem Vater verbundene Kindheit auf dem Prüfstand. W i e c k nutzte diesen Aspekt im Psychokrieg auch aus und warnte verschiedene Veranstalter vor »diesem Mädchen, das sich auf so unnatürliche und empörende Weise ihrem Vater entgegenstellt«. » M i r steht aller Verstand stille«, so die Tochter, als sie das hörte, »wenn der Vater ihn nur nicht ganz verliert« (Jb, 12. November 1839). Das Gerichtsurteil bildete den Schlusspunkt im bestürzenden Finale eines heftigen Ablösungsprozesses. Er hatte sehr viel früher schon begonnen. Tochter und Schülerin sowie Lehrer und Vater waren in einer so engen und hoch komplexen Beziehung in einander verwoben, dass der Ausbruch nur mit geballter eruptiver Energie erfolgen konnte. Über lange Strecken gehörte das unbedingte Vertrauen der Tochter-Schülerin in die M a ß n a h m e n des Lehrer-Vaters zur Voraussetzung eines erfolgreichen Unterrichts. Sein Vorbild ahmte die kleine Clara eifrig nach. Im fantasievollen Umgang mit Musik, den W i e c k ausdrücklich anspornte, konnte die Schülerin den W e g
Schritte in die Selbständigkeit
91
zu einer autonomeren Position einschlagen. Beim Komponieren entwickelte sie ihre eigene innere musikalische Fantasiewelt und ein selbst bestimmtes Verhältnis zur Musik ihrer Umgebung. Gleichwohl hatte sie durch Wieck stets eine stützende Kontrolle im Hintergrund. Er blieb die Beratungsinstanz für die Lösung kniffliger technischer Anforderungen und war bei den Auftrittsvorbereitungen unentbehrlich. Noch in der Trennungsphase wünschte sie sich sehnlich eine Kontrollstunde beim Vater. Diesen Part konnte und wollte Robert Schumann nicht ersetzen. Der Lösung von Tochter und Vater aus der gegenseitigen Bindung war weit schwieriger und schmerzhafter als die der Schülerin vom Lehrer. Die Abnabelung vom Vater löste Schumann nicht aus, und sie fand auch nicht seinetwegen statt. Schumanns Person bietet aber die Möglichkeit, dem Auseinanderdividieren von Tochter und Vater einen Namen zu geben. Er vertrat sozusagen das Neue, das, was Clara Wieck nicht von ihrem Vater übernahm, sondern sich selbst suchte. Anstatt ihre Selbständigkeit anzuerkennen, wie sie gehofft hatte, begann Vater Wieck, verbissen dagegen zu kämpfen. Ab 1834 erwachte immer stärker Clara Wiecks Interesse für Flirts mit ihren zahlreichen jungen und älteren Verehrern, unter ihnen der Komponist Carl Banck, dessen Schmachten der Vater selber förderte, vermutlich in der Absicht, seine Tochter von Schumann abzulenken. Mit Banck und Emilie List wollte die Virtuosin 1835 ihren 16. Geburtstag nachfeiern. Sie komponierte auch »Bravour-Variationen über ihre G Dur Mazurka - mit Bank« (Jb, 20. Dezember 1836, Hs FW). Es ist kein entsprechendes Stück erhalten. Das ganze Manöver erreichte immerhin den Zweck, Schumann in Bezug auf Clara Wiecks Interessen stark zu verunsichern. »Er u. Banck conspiriren«, vermutete Schumann noch im Oktober 1839, während der Prozess schon begonnen hatte (Bw, S. 757). Der Pianist Louis Rakemann, zeitweise auch Mitarbeiter der NZfM, blitzte im August 1838 mit einem Heiratsantrag bei Clara Wieck ab. In Hamburg trat sein Bruder an die gleiche Stelle. »Er blickte mich gar zu zärtlich an. Ich begreife nicht, was in die Rackemänner gefahren ist«, notierte sie kopfschüttelnd (Jb, 22. Februar 1840). Auch Friedrich Truhn, Komponist und langjähriger Mitarbeit der NZfM, hatte eine Zeit lang seine Augen fest auf sie geheftet. Seine zähe Verehrung nervte Clara Wieck allerdings. »Truhn war heute wieder sehr lange bei mir [...] Dass nur so Mancher nie das rechte Maaß zu finden weiß. Unser Eines weiß es doch!« (Jb, 22. November 1839). Das galt auch für Otto Nicolai, der der jungen Virtuosin den Hof machte, und für den Fürsten von Schönburg. Er logierte in Wien im selben Hotel wie die Wiecks. Schönburg ließ Clara durch seinen Diener beschatten und belagerte sie, sobald Wieck ausging. »Ihr Männer seyd doch glückliche Leute«, 92
Tochter und Vater
schrieb sie Schumann, »Ihr braucht Euch nichts von den Mädchen gefallen zu lassen« (Bw, S. 106). Wiecks Versuch, den allzu intensiven Kontakt seiner Tochter mit Schumann zu unterbinden, bewirkte das Gegenteil. Er schürte bloß die Opposition. Einmal verstärkte sich Claras Interesse für Schumanns Musik. So ergänzte sie in Wiecks Konzertberichten Anfang 1836 beharrlich: »Toccata von Schumann«, »Schumanns Sonate«, »Impromptu von Schumann«, »einige Paganinische Etüden von Schumann« {Jb, 21. Februar bis 29. März). Der Umweg über die musikalische Kommunikation spielte für die wachsende Liebe eine wichtige Rolle. Zum anderen verlagerte sich das emotionale Interesse der Tochter mit voraussehbarer Konsequenz unaufhaltsam auf den gefährlicher werdenden Konkurrenten - eine Auswirkung, die im Tagebuch weitgehend ausgeblendet bleibt. Nur an sehr wenigen Stellen im Text zischte der zwischen Tochter und Vater herrschende Druck unter dem mühsam gehaltenen Deckel hervor, wie 1836, als Wieck hinter ein heimliches Treffen gekommen war. Einen entscheidenden Schritt unternahm dann Clara Wieck, als sie bei einer Matinee im Leipziger Börsensaal am 13. August 1837 eine intime Botschaft an den im Publikum anwesenden Komponisten Robert Schumann richtete. Eingebettet in ein zeitgenössisches Programm mit Stücken von Liszt, Chopin, Henselt und ihren eigenen Bellini-Variationen op. 8 präsentierte sie drei Sätze aus Schumanns Sinfonischen Etüden op. 13. Sie hätte ihm damit in der Zeit ihres Kontaktverbots ihr »Inneres« zeigen wollen. »Heimlich dürft' ich es nicht, also that ich es öffentlich« (in: Litzmann 1, S. 117). Diesen mutigen Appell verstand Schumann als Bestätigung ihrer Liebe, und das hatte Folgen. Sie verlobten sich - heimlich. Offensichtlich bekamen aber doch einige Besucher die prickelnde Brisanz mit. In einer Rezension ACT Allgemeinen musikalischen Zeitung las man nämlich unverblümt: »Alles wurde mit ausgezeichneter Bravour und mit besonderer Liebe die Etudes symphoniques von R. Schumann gespielt und mit großem Applaus aufgenommen« (AmZ 1837, Sp. 657). »Zu meinem Geburtstag kam unter Anderem ein Brief von Schumann. Darüber zu schreiben würde Bogen ausfüllen«, protokollierte Clara Wieck lapidar an ihrem 18. Geburtstag im Tagebuch (13. September 1837). Es war Schumanns offizieller Antrag (in: Litzmann 1, S. 123ff). Tagelang hatten sich die heimlich Verlobten vorher über den besten Zeitpunkt beraten. »Ich werde zittern wenn Vater den Brief liest! - Ich baue auf seine Liebe zu Ihnen und zu mir«, teilte Clara Wieck vorher schnell noch Schumann mit (8. September 1837). Doch erst einmal geschah nichts. Wieck nahm den Brief an sich, verSchritte in die Selbständigkeit
93
schwand mit der Stiefmutter im Nebenzimmer und ließ seine konsternierte Tochter im Ungewissen. Nicht einmal die an sie selber gerichteten Zeilen Schumanns rückte er heraus. Der 18. Geburtstag fiel damit buchstäblich ins Wasser. Davon liest man allerdings im Jugendtagebuch nichts. Es ist fast unbegreiflich, wie strikt Clara Wieck ihre Emotionen unter Kontrolle gehabt zu haben schien. Während sie im Tagebuch die täglichen Bilanzen von Besuchern, Geschäften, gespielter und gehörter Musik im gewohnten Tonfall weiterführte, rang sie innerlich mühsam mit der Fassung. »Einige Tage darauf konnte ich mich noch immer nicht beruhigen, immer standen mir die Thränen in den Augen«, gestand sie Schumann zwei Jahre später. »Da kam denn dem Vater ein wenig Mitleid an, und er fragte, was mir fehle, worauf ich denn sogleich die Wahrheit der Sache sagte«. Wieck legte ihr die Briefe vor. »Ich war zu stolz, und las sie nicht« (Bw, S. 555f). Verwirrung. Keiner wusste so recht, wie es nun weitergehen sollte. »Am Ende denkt er, wir vergessen uns«, so Schumann. Bis dahin hatte er auf den väterlichen Segen gehofft. Das war mit einem Schlag vorbei. Zunächst ging man sich allerdings erst einmal aus dem Weg. Friedrich und Clara Wieck starteten eine Tournee über Dresden, Prag und Wien, die den internationalen Durchbruch der Künstlerin bedeuten sollte. Innerlich verschärften sich dagegen für Clara Wieck die auszuhaltenden Spannungen erheblich. Sie stand zwischen den Kontrahenten und musste sich wappnen, nicht zerrieben zu werden. Zwar hatte sie sich für Schumann entschieden und verhielt sich tapfer loyal, doch war damit die emotionale Auseinandersetzung mit dem Vater noch lange nicht beendet, zumal beide trotz der verfahrenen Situation das ganze Jahr 1838 hindurch erfolgreich als Künstlerteam weiter arbeiteten, was wiederum Schumann misstrauisch machte. Als sie dann die Vollmacht zur Klage unterschrieb, dämmerte ihr langsam, welcher Preis tatsächlich für die Hochzeit bezahlt werden musste. In den nächsten eineinhalb Jahren bis zur Heirat war Clara Wieck ganz auf sich gestellt und durchlebte in dieser Zeit ein permanentes Wechselbad von Glücksgefühlen und Liebe, Verzweiflung, Zuversicht, Verlust- und Versagensängsten. Weder im quasi öffentlichen Jugendtagebuch noch in ihren Brautbriefen konnte sie rückhaltlos darüber schreiben. Auch Emilie List gegenüber blieb sie vorsichtig. Sowohl Wieck als auch Schumann hatten zu ihrer Freundin Kontakt aufgenommen, und jeder verbreitete seine Version der Geschichte. Wem sich anvertrauen? Clara Wieck musste als Zwanzigjährige lernen, existentielle Entscheidungen für ihr Leben allein zu treffen, ohne sich mit irgendjemandem beraten zu können. Schumann vertrug die den Ablösungsprozess begleitenden Ausbrüche kindlicher Vaterliebe begreiflicher94
Tochter und Vater
weise schlecht, und im Tagebuch konnten die emotionalen Spannungen so lange nicht artikuliert werden, bis die Einträge den quasi öffentlichen Charakter verloren. Erst als Clara Wieck auf der Rückkehr aus Paris im August 1839 mit Schumann zusammentraf, war für sie der endgültige Bruch mit ihrem Vater besiegelt. In manchmal mitreißenden und oft anrührenden Passagen ermöglicht das jetzt allein geführte Journal Einblicke in einen komplizierten und von Krisen begleiteten Prozess der Selbstfindung. »Möge der Himmel mir Kraft genug verleihen, den nächsten Kampf mit dem Vater noch zu überwinden. Er wird mir schwer werden, es möchte mir das Herz zerreißen, wenn ich an Alles denke, was der Vater an mir gethan«, gemeint ist hier die exklusive Ausbildung, »und daß ich ihm jetzt öffentlich gegenüber stehen muß - der Himmel wird mir verzeihen«. Die ungerechte Behandlung der letzten Jahre empfand sie allerdings als bitter. Doch täte dies ihrer »kindlichen Liebe zu ihm keinen Abbruch« (Jb, 24. August 1839). Aber der Stachel saß zu tief. Wiecks Aktionen gerieten immer mehr zu einer Schlammschlacht. Seine Reaktion auf Claras Selbständigkeit glich eher der eines verlassenen Partners. Die Enttäuschung darüber, das geliebte »Geschöpf« zu verlieren, schlug in unkontrollierte wütende Attacken um. Wieck schreckte nicht vor denunzierenden Briefen zurück, mit denen er die selbständig unternommenen Konzerte seiner Tochter zu boykottieren hoffte. Manche wirkten tatsächlich, wie die Warnung an den Berliner Stadtrat Behrens. Behrens, der noch ein Jahr zuvor die junge Virtuosin entzückt mit Blumen und Pralinen überschüttet hatte, stellte im Herbst 1839 zwar sein Klavier für Clara Wiecks Auftritt zur Verfügung, forderte allerdings danach offenbar eine Rundumerneuerung des Instruments. Er »raissonirte so furchtbar, daß wir, die Mutter und ich, grob wurden« (Jb, 3. November 1839). Insgesamt haben derartige Intrigen dem Ansehen Friedrich Wiecks immens geschadet. Während die Tochter immer noch glaubte, der Vater würde irgendwann wieder zur Besinnung kommen und sich seiner Elternpflichten erinnern, sah sie sich mit Vorwürfen konfrontiert, die sie zutiefst verletzten. Aus den Diffamierungen und den von Wieck diktierten Heiratsbedingungen las sie sozusagen das Antibild einer Clara heraus, das dem negativen, das Wieck von ihrer Mutter gezeichnet hatte, aufs Haar glich. Schon der unfolgsamen Sechsjährigen hatte der Vater suggeriert, den »Widerspruch« ihrer Mutter geerbt zu haben (Jb, 1. Mai 1825). Nun verbreitete er die Nachrede, sie wäre ein »demoralisirtes Mädchen ohne Schaam«, wie sich die Tochter betroffen aus einem Brief notierte, den Behrens ihr zu lesen gab (Jb, 12. November 1839). Schritte in die Selbständigkeit
95
Wiecks Briefe aus dieser Phase sind nicht erhalten. So erfährt man seine Schmährhetorik nur aus dem, was die Tochter sich als besonders empörend und verletzend daraus anheftete. Auch vor Gericht schien Wieck ein Bild von Clara entworfen zu haben, das in schrillem Gegensatz zu ihren eigenen Idealen stand. Davon, luxuriös, eigensinnig, wankelmütig und kokett sein, dabei völlig ungeeignet, einen Hausstand zu fuhren, hatte sich sie in ihrem Selbstkonzept stets vehement abgegrenzt. Sie versuchte den Vater davon zu überzeugen, dass sie sich zum »Besten geändert« habe, »besonders in meiner Leidenschaft und Hitze!« (Jb, 12. November 1839). Doch darum ging es gar nicht. Hier konnte sie nicht gewinnen. Vielmehr wirkt der Streit so, als wiederholte sich für Wieck die traumatische Erfahrung, von »seiner« Künstlerin betrogen und verlassen worden zu sein. Insofern durfte das Brautpaar gerade nicht auf die »väterliche Freundschaft« zählen. Folgt man der Schilderung von Nancy Reich (1991, S. 30), so ähnelte Schumann mit seinem eher sanguinischen Temperament sogar dem einstigen Konkurrenten Bargiel. Wieck wollte seine Tochter verletzen. Dass die Polemik gegen sie aber vor allem darauf abzielte, vor Gericht die Summe der Unterhaltsforderung an Schumann in schwindelnde Höhen zu treiben, kam ihr nicht in den Sinn. Ein Jahresverdienst von 2000 Talern, den Wieck als Konsensvorschlag ansetzte, war in der Tat luxuriös. Gemessen an Clara Wiecks Konzerteinnahmen 1837/38 zwar nicht unrealistisch, doch dürfte unter den in Deutschland lebenden Komponisten nur der Berliner Generalmusikdirektor Spontini eine vergleichbare Summe erwirtschaftet haben. Dagegen verfugte ein zeitgenössischer großbürgerlicher Haushalt um 1840 über durchschnitdich 800 Taler. Mendelssohns Jahresgehalt am Gewandhaus lag bis 1837 bei 600, danach bei 1.000 Talern (Zorn 1976, S. 442; Dörffel 1980,1, S. 84). Nach den Berechnungen von Friederike Preiß haben die Schumanns dann in den 1840er Jahren tatsächlich rund 1.800 Taler jährlich verbraucht (Preiß 2004, S. 128). Zur Verhärtung der Situation trug wesentlich bei, dass Wieck, der Schumann taktisch und juristisch unterlegen war, mit untauglichen Mitteln versuchte, seine - teils berechtigten - Bedenken gegen eine so frühe Bindung durchzuboxen. Das machte ihn blind für angemessenere Alternativen. Wieck hatte alles in Claras Ausbildung investiert, Teile seines Geschäfts bereits ab 1836 verkauft, um sich besser dem Karriereaufbau seiner ältesten Tochter widmen und die großen Tourneen dieser Jahre mit ihr durchfuhren zu können (Widmaier 1998, S. 121). Der übrigen Familie wurde dadurch viel entzogen. Alles drehte sich um den künftigen Star. Mit 55 Jahren konnte Wieck zwar der Öffentlichkeit das erfolgreiche Ergebnis seiner neuen Methodik auf 96
Tochter und Vater
dem Podium vorführen, er selber hatte aber nichts Konkretes in der Hand. Stattdessen verdrängten die jungen Schumanns ihn sogar vom Platz, so dass er in Dresden mit der Erziehung seiner damals achtjährigen zweiten Tochter Marie noch einmal von vorn beginnen musste. Clara Wieck belastete dieser Zustand mehr als sie Schumann gegenüber zugeben konnte. »Ich stehe so zwischendrinn!« Mit »mir hat er doch sein ganzes Hoffen verloren« (1. Oktober 1839). Der Vater repräsentierte für sie das emotionale Zentrum ihrer Herkunftsfamilie. Schnitt sie sich von diesen Wurzeln ab, so wurde sie heimatlos, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Friedrich Wieck selber vollzog diesen Akt, indem er ihr das Haus verschloss und bis auf weiteres ihr persönliches Hab und Gut sowie das erwirtschaftete Vermögen einbehielt. So vagabundierte die noch nicht volljährige Tochter über ein Jahr ohne festen Wohnsitz herum, angewiesen auf die Hilfe von Freunden und Verwandten aus der mütterlichen Linie. Auf diesen unhaltbaren Zustand hatte Emilie List Schumann noch vor Claras Rückkehr aus Paris hingewiesen und nachdrücklich gewarnt, er gefährde das Ansehen der Künstlerin moralisch wie sozial: »So lange sie in Paris ist, fällt nicht auf, daß sie getrennt von ihren Eltern lebt, ist sie aber in Leipzig u[nd] wohnt in einem fremden Haus, so werden Sie sehen, welche Lügen man erfinden wird« (in: Wendler, S. 71). Hinzu kam der kaum auszuhaltende emotionale Stress durch den abrupten Liebesentzug des Vaters. Die Mutter ersetzte den Vater nicht, dazu war das Verhältnis zu distanziert und das negative Vorbild der Mutter offenbar auch zu stark. Clara Wieck sprach sich deswegen bei der Suche nach einem alternativen Wirkungsort zu Leipzig gegen Berlin aus, weil es sie deprimierte, ständig die prekäre Situation ihrer Mutter vor Augen zu haben. Umso wichtiger wurde das Liebesversprechen der beiden Verlobten, die sich nach wie vor selten sahen, sondern sich vor allem schriftlich ihrer gegenseitigen Zuneigung versichern mussten. Ihr ganzes Hoffen richtete die Künstlerin nun auf den Beginn eines neuen, von Liebe und Kunst erfüllten Lebens mit Robert Schumann. Dadurch erhielt die eigene Familiengründung einen außerordentlich hohen Wert. Zwei Monate vor ihrem Tod 1896 gestand Clara Schumann ihrem Enkel Ferdinand, es wäre »die schrecklichste Zeit ihres Lebens gewesen« (in: NZflA 1917, S. 101). Aus dem Trennungsprozess und dem langen juristischen Entscheidungsweg für den Ehekonsens ging Clara Wieck am Ende gestärkt hervor. Als Künstlerin war sie inzwischen so autonom in ihren Entscheidungen, dass sie zwar einen umsichtigen Manager und Konzertbetreuer wie Friedrich Wieck vermisste, ihn aber nicht mehr wirklich brauchte. Auch die Ablösung vom Vater Schritte in die Selbständigkeit
97
bewies ihre persönliche Stabilität. Vielleicht darf man es sogar als besondere Reife ansehen, wie sie mit der Bewältigung der Zerreißprobe zwischen Vater und Bräutigam wuchs. Hier wurde kein Loyalitätskonflikt ausgefochten, denn mit ihrer Einwilligung in den Prozess hatte sich Clara Wieck eindeutig für Schumann entschieden. Vielmehr ging es um ihr Verhältnis zum Vater. Hin- und hergerissen zwischen Anhänglichkeit und tiefer Verletzung durch seine groben Kränkungen gelang es ihr, Dankbarkeit, Mitleid und Anklage nicht gegeneinander aufzurechnen. Als Tochter empfand sie »eine Beruhigung, dass mich das Gefühl für den Vater nicht verlassen hat, und das will ich mir auch bewahren« (Jb, 10. November 1839). Eine Annäherung von Tochter und Vater wurde später dann vorsichtig möglich, weil Clara Schumann zwischen ihren eigenen Versöhnungsbedürfnissen und der Gefühlslage ihres Mannes sorgfältig diplomatisch taktierte. Auf Wiecks mehrfache Einladung hin reiste sie im November 1843 nach Dresden, doch Schumann, der zunächst eingelenkt hatte, kam nicht nach, wie verabredet, sondern blieb zu Hause. »Du musst doch wissen, wie mir s geht, Klärchen. Desparat«, schrieb er ihr (Bw, S. 1214). Da musste er durch. Friedrich Wieck hatte seine Wünsche inzwischen artikuliert. Dass »wir von vergangenen 4 Jahren kein Wort sprechen, wirst Du wohl zufrieden sein« (in: Preiß 2004, S. 203). Ob er ihr Umblättern dürfte, frage er bescheiden, um wenigstens die langjährige vertraute Situation beim Musizieren noch einmal wieder herzustellen. Damals, 1834, als Clara konfirmiert wurde, hatte Wieck für sich eine Rolle als »rathender und helfender Freund« im künftigen Leben seiner Tochter entworfen (Jb, 12. Januar 1834). Nun machte er sich damit vertraut, in die Position des Großvaters zu wechseln, den später offenbar eine gewisse Altersmilde umgab. Seiner Enkelin Julie Schumann brachte er jedenfalls die bemerkenswerte Methode bei, kleine Süßigkeiten auf dem Klavier aufzureihen, mit denen jede Uberwindung einer Schwierigkeit belohnt wurde (E. Schumann, S. 16). »Ich habe den Vater sehr lieb gehabt«, schrieb Clara Schumann nach dessen Tod im Oktober 1873 an Emilie List, »in ihm ja auch eigentlich Vater und Mutter, unendlich viel verdanke ich ihm, nicht nur künstlerisch, sondern auch in praktischer Lebensanschauung, in Principien, naturgemäßer körperlicher Pflege, wodurch ich ja auch wieder auf meine Kinder günstig einwirken konnte.« Die Inspiration, »die Pietät, ich möchte sagen, Heilighaltung der Kunst, das danke ich ihm, er pflanzte diese Empfindungen schon in meine Kinderseele« (in: Wendler, S. 314).
98
Tochter und Vater
STARKULT
Torte und Lorbeerkranz Künstlerischer »Durchbruch« Souvenir de Vienne op. 9 »Der Clarakrieg ist hier losgegangen - alle Blätter sind voll«, so Friedrich Wieck am 27. Januar 1838 aus Wien. Im Mittelpunkt glänzte der neue Star: Clara. Ein Kaffeehaus warb per Zeitungsannonce mit einer »Torte ä la Wieck«, eine »ätherisch hingehauchte Mehlspeise die sich den Essern von selbst in den Mund spiele«, wie Clara Wieck in einem Brief an Robert Schumann amüsiert zitierte. »Alle Enthusiasten von mir gehen dahin« (Bw, S. 88). Die Torte war bloß ein Begleitprodukt, das geschäftstüchtige Gastronomen während des Wiener Aufenthalts von Clara Wieck auflegten. Doch zeigt das saisonale Produkt, welche Prominenz die junge Virtuosin durch ihre Auftritte zum Jahresanfang 1838 in Wien genoss. Das originale Rezept ging verloren. Zur Feier des hundertsten Todestages von Clara Schumann, 1996, wurde in Wien ein kleiner lokaler Konditorenwettbewerb ausgelobt und eine neue »Clara-Wieck«-Torte kreiert, aus luftigem Biskuit, nougatreich verziert und duftig parfümiert mit Orangenblütenwasser. Damals, zum Jahreswechsel 1837/38, überschlugen sich die Ereignisse. Mit einer Serie von sechs Konzerten zwischen Dezember 1837 und März 1838 eroberte Clara Wieck die Musikmetropole Wien. Das war ihr internationaler Durchbruch als Star. Sie machte Furore. In kürzester Zeit waren die Konzerte ausverkauft. Friedrich Wiecks gedrängte Schilderungen geben die Schlacht um die Karten plastisch wieder: »Falsche Billets, nachgemachte, ohne Billet sich hereindrängen«, Hunderte »mussten wiederum fortgehen«, weil die Konzertsäle nicht genug Platz boten. »Wo kommen nur die [vielen] Menschen her?« - »Clara wurde 18 mal gerufen, und jeder Beifall glich einem Donner.« - »Der Beifallssturm war fürchterlich - die Wagenburg unübersehbar.« Ihre Konzerte brachten den Wiener Innenstadtverkehr zum Erliegen, so viele Kutschen drängten hinein und verstopften den Hohen Markt. Aufruhr am Eingang, man stürmte die Kasse und prügelte sich um die Karten, so dass die Polizei einschreiten musste. Eine bessere Publicity hätte Clara Wieck nicht haben können. Sie war »Mode geworden« und hatte
Künstlerischer »Durchbruch«
99
alle Konkurrenten überflügelt. Einladungen, in fürstlichen Privataudienzen zu spielen, folgten ohne Ende. »Wir nehmen aber wenig an«, schrieb Friedrich Wieck nach Hause. »Clara wird zu sehr gemißbrauchet u. muß zu viel spielen«. »Ist die Clara ein Pferd?« - Berichte eines stolzen Vaters, Lehrers und Impressarios in eigener Sache (Jb, Dezember 1837 bis März 1838; Wieck Briefe, S. 80ff). Clara Wieck profilierte sich als Künstlerin mit einem die ästhetischen Ansprüche steigernden Programm. Neben vertrauten Publikum-Hits, wie dem Rondo Les trois Clochettes (»Glöckchenrondo«) op. 120 von Johann Peter Pixis, enthielt die Serie eigene Kompositionen, das Impromptu. Le Sabbat op. 5 Nr. 1, eine Mazurka (vermutlich op. 6 Nr. 5), das Klavierkonzert op. 7 und die Bellini-Variationen (Variations de Concertpour le Piano-Forte sur la Cavatine du Pirate de Bellini) op. 8. Auch Werke von ihren unmittelbaren Virtuosen-Konkurrenten wurden dargeboten, nämlich von Adolph Henselt ein »Lied ohne Worte« in As-Dur und seine Etüde über »Wenn ich ein Vöglein wär'« op. 2 Nr. 6, Franz Liszts Grandefantaisie sur des motifs de Niobe de Pacini, Divertissement sur la cavatine »I tuoi frequenti palpiti« sowie Opernfantasien von Sigismund Thalberg, und schließlich auch Stücke der jungen Avantgarde, Chopins Don-Juan-Variationen op. 2, Etüden (vermutlich aus op. 10), Mendelssohn Bartholdys Capriccio h-Moll op. 22 und am Ende sogar vier Stücke aus Schumanns Sinfonischen Etüden op. 13. Den Höhepunkt erzielte die Virtuosin allerdings mit der ersten öffentlichen Gesamtaufführung von Beethovens Klaviersonate f-Moll op. 57 (»Appassionata«), gespielt vor einem Publikum, das »nur Flitterwerk, Rondos, Fantasieen, Capriccio's« gewohnt war, wie ein Kritiker der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1838, Sp. 191) berichtete. Clara Wieck integrierte die Sonate in zeitgenössische Musik. Offensichtlich gelang es ihr, eine aktuelle Lesart der für damalige Gewohnheiten ziemlich alten, nämlich schon 1805 abgeschlossenen Komposition zu bieten und das Stück so dem Publikum zugänglich zu machen. Aus der Perspektive Chopinscher oder Schumannscher Entwürfe betrachtet, kann man eine Fülle moderner Aspekte in Beethovens hochvirtuosem Opus 57 aufdecken. Schon der geheimnisvolle Anfang in Oktaven im tiefen Register und im Pianissimo wirkt so romantisch wie der von Chopins g-Moll-Ballade op. 23. Auch das Ändante-^ntm'i (dolce und piano) erklingt in dieser fern gerückten Tiefe, in einem vollgriffigen, orchestralen Tonsatz, rhythmisch vielfältig und differenziert zu spielen. Adolf Bernhard Marx nannte es ein inbrünstiges »De profundis clamavi« (Marx 1863, S. 135). Die erste Variation, immer noch in der Tiefe, bringt im Bass beunruhigende synkopische Verschiebungen. Vollkommen geheimnisvoll wirkt dann das Ende
100
Starkult
des Satzes, ganz zurückgenommen und leise. Plötzlich steht man wie vor einem Schleier. Mit einem Trugschluss taucht der Satz fiir einen winzigen zeitenthobenen Moment in eine mysteriöse, statische Atmosphäre. Ein Fortissimoschlag holt die Hörer in die Gegenwart zurück und ohne Ubergang, »attacca«, bricht das Finale herein, aber wie: mit einer dreizehnmal hintereinander gehämmertem Dissonanz. »So fängt nur Chopin an [...], mit Dissonanzen, durch Dissonanten, in Dissonanzen«, so Schumann (GS 2, S. 13) - nein, vor ihm schon Beethoven. In den Ecksätzen tobt eine aufgewühlte Wildheit, mit grellen dynamischen Farbkontrasten, Lauf- und flächigen Akkordfiguren, fahlen, statt brillanten Trillereffekten - ein wildes, düsteres Nachtstück. Keine Spur von einer »klassisch« ausgewogenen Sonate. Das ganze Stück erfordert eine gut kalkulierte Tempodramaturgie, vom Anfang im Allegro assai muss über das Andante hinweg eine Spannung spürbar bleiben bis zum Finale, das nicht allzu schnell (Allegro ma non troppo) beginnt und am Ende rast: Presto. Im Kontext der Avantgarde der späten 1830er Jahre könnte der Komponist dieser Sonate unter Clara Wiecks Fingern erschienen sein wie ein Romantiker im Hoffmannschen Sinne, einer, der über die Schrecken und Abgründe der Finsternis jagt oder flammende Blicke sprüht, als Mentor jener »Genialitätsfrechen« in »phrygischen Mützen«, wie Schumann 1836 den musikalischen Fortschritt politisiert hatte (GS 1, S. 144). Mit ihrem Beethoven-Vortrag hatte Clara Wieck eine neue Ära begonnen und zwischen Enthusiasten und Gegnern eine heftige Diskussion entfacht. Man stritt, ob Sonaten überhaupt für den Vortrag im Konzersaal geeignet wären oder nicht. Die Gegner fanden sie künstlerisch zu komplex und auch als Musikform zu intim für diesen öffentlichen Rahmen. Außerdem entbrannten »hitzige Debatten« über Wiecks Klavierspiel und »über die Richtung«, die sie vertrat. »Ueberall hörte man darüber streiten, ob man die von Beethoven gestellte Gränze [der Virtuosität] überschreiten dürfe, oder nicht« (NZfM 1838, S. 3). Zudem begeisterten und befremdeten Clara Wiecks hart am Limit gewählte Tempi. Ihr Vortrag löste nicht allein technisch, sondern vor allem aufgrund der »stets individuell geistreichen Auffassung und Charakterisirung des gewählten Tonstücks jedes Mal eine Sensation« aus, »welche höchstens mit der enthusiastischen Verehrung für einen Paganini [...] verglichen werden könnte«, entschied der Wiener Korrespondent der Allgemeinen musikalischen Zeitung im März 1838. Die Auffuhrungsberichte geben bloß den Enthusiasmus wieder und den sofort beginnenden Streit über das Für und Wider, aber keine differenzierteren Details über die Wirkung oder Einzelheiten der Interpretation. Clara Wieck dürfte das virtuose Potential der Sonate voll ausgekostet und allein schon daKünstlerischer »Durchbruch«
101
durch das Publikum in Hochstimmung versetzt haben. Sicher strahlte etwas von der Attraktivität der damals 18jährigen Spielerin auch auf die Sonate ab, so wie umgekehrt der Nimbus Beethoven das Image der Virtuosin färbte. Im Publikum standen auch »Kenner«, die noch Beethovens eigene Auftritte im Ohr hatten, wie Franz Grillparzer oder der gesamte Tross von Beethovens selbsternannten Nachlassverwaltern, darunter Anton Schindler und Anton Halm. Sogar Zeitzeugen, die in der Öffentlichkeit selten hervortraten, wie Dorothea Freiin von Ertmann, die Widmungsträgerin von Beethovens Klaviersonate A-Dur op. 101, kamen. Dass Wiecks Vorgehen die Beethoven-Spezialisten in vehemente Enthusiasten und grimmige Gegner spaltete, steigerte die Sensation eher noch, zumal die Baronin Ertmann die junge Virtuosin gleichsam adelte durch ihren Kommentar, die Sonate wäre »noch nie in Wien so geistreich und großartig vorgetragen worden« (Wieck Briefe, S. 79). Ertmann wurde lange Zeit als Beethovens »unsterbliche Geliebte« gehandelt. Clara Wieck stattete ihr einen Ehrbesuch ab, und die Baronin spielte ihrerseits Beethovens cis-MollSonate op. 2 Nr. 2 (»Quasi una fantasia«) vor, die auch Clara Wieck inzwischen im Repertoire hatte. Im Stillen wunderten sich die Wiecks allerdings über die »merkwürdige Willkührlichkeit« der Interpretation (Jb, 9. April 1838). In Wien war Clara Wieck 1837 auf eine Situation getroffen, in der die intellektuellen Impulse nach wie vor durch die rigide Zensur der Polizeihofstelle und ihrer Spitzel gelähmt war (Hanson 1987, S. 46ff). Noch die Wiecks mussten ihre geplanten Konzert-Programme dem Grafen Sedlnitzky vorlegen, der seit 1817 die Zensurbehörde präsidierte. Selbst in semiöffentlichen Salons blieb die Unterhaltung aus Angst vor Spitzeln und Repressalien unverbindlich und belanglos. Keine Politik, keine Kritik am Kaiserhof, keine Unschicklichkeiten. Stattdessen frönte man dem Klatsch, konzentrierte sich auf das Essen, widmete sich den Extravaganzen der Sängerinnen, fabulierte über die Kostüme in der Oper und den letzten Schrei der Mode. Das intellektuelle Vakuum füllte eine exzessiv dominierende Ballhausund Walzerkultur sowie die Liebe zum italienischen Belcanto. Erstaunt hatte Chopin seinem Lehrer Józef Eisner 1831 berichtet: »Walzer nennen sie hier Werke! Und Strauß und Lanner [...] Kapellmeister« (Chopin 1984, S. 116). Auch Mendelssohn Bartholdy bestätigte ähnliche Erfahrungen. Die »besten Ciavierspieler und Clavierspielerinnen dort [hätten] nicht eine einzige Note von Beethoven gespielt« und kaum gewusst, »daß Mozart und Haydn auch für Ciavier geschrieben hätten; Beethoven kannten sie nur vom Hörensagen« (in: Koiwa 2003, S. 14 und 39). Als die Wiecks die Szene sondierten, registrierten sie verwundert die Kluft zwischen dem hohen artistischen Niveau und den ästhetisch oberflächlichen öffentlichen Darbietungen. »Die Großen 102
Starkult
Spielerinnen (hunderte an der Zahl, die im Stillen Beethoven, Chopin pp spielen) treten nicht öffentlich auf und [sind] gänzlich theilnahmslos geworden; nun erscheint Clara - bringt eine förmliche Ciavierrevolution hervor - und das Publikum ist da« ( Wieck Briefe, S. 84). Als Außenstehende waren sie nicht in die verhängnisvolle Dialektik von Zensur und Selbstzensur verstrickt. Vielmehr setzte Clara Wieck mit ihren Auftritten triumphierend neue Maßstäbe. Dieser befreiende Coup war Teil ihres durchschlagenden Erfolgs. Von Mendelssohn Bartholdy kannte man fast nichts. »Unbegreiflich!« so Clara Wieck im Dezember 1837 an Schumann. Sie zögerte daher, Mendelssohns h-Moll-Capricco op. 22 gleich aufs Pogramm zu setzen. Sie dürfe »es nicht eher wagen, als bis ich das Publikum auf - meiner Seite habe; ist der erste Eindruck gut, so kann der Künstler hier thun was er will« (Bw, S. 54f). Dementsprechend bot sie in der ersten Aufführung Hits, mit denen sie bereits auf früheren Tourneen gute Erfahrung gemacht hatte, um sie dann nach und nach gegen Stücke von Bach, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy und Schumann auszutauschen. Damit setzte sie in Wien ein Signal. »Sie hat zum erstenmal Compositionen aus der romantischen Schule öffentlich vorgeführt; keine geringes Wagnis einem Publikum gegenüber, das in keiner Weise darauf vorbereitet ist«, so kommentierte der damalige Literat und Klavierprofessor Josef Fischhof das Ereignis (in: Litzmann 1, S. 200). In auserlesenen privaten Kreisen wagte sie weit mehr. »In diesen Tagen spiele ich mehreren Kennern den Carnaval von Robert Schumann vor, ein schönes lebendiges Bild in Tönen. Darf ich Sie dazu einladen?«, so bat Clara Wieck Grillparzer zu einer kleinen privaten Soirée. Die dort versammelten »Kenner« waren nicht immer unbedingt Musikexperten. Vielmehr einte sie der Zusammenhalt als kleine Elite, die sich als eine Art Geheimbund betrachtete. Man beabsichtigte, den Kunstdiskurs zu steuern, sei es mit Werken, Schriften und Auffuhrungen, materieller oder ideeller Unterstützung. Von Franz Grillparzer erschien am 9. Januar 1838 in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Musik ein Huldigungsgedicht, »Clara Wieck und Beethoven«, das die junge Virtuosin öffentlich auszeichnete. »Das schlägt alle Recensionen« ( Wieck Briefe, S. 79). Es wurde sofort geschäftstüchtig von Johann Vesque von Püttlingen vertont. Grillparzers Gedicht bedeutete der Künstlerin sehr viel. Sie bewahrte die Abschrift des Autors bis ins hohe Alter. Noch 1890, als das Autograph leihweise für eine Ausstellung in Wien erbeten wurde, zögerte sie, die Reliquie aus der Hand zu geben (in: Kat., S. 338). Auch Simon Sechter beeilte sich 1838, eine Fuge für Clara Wieck aufzusetzen, nachdem er sie mit der Cis-Dur-Fuge aus Johann Sebastian Bachs WohlKünstlerischer »Durchbruch«
103
temperiertem Klavier (vermutlich BWV 848 aus Teil I) gehört hatte. Und wie gehofft spielte die Künsderin diese musikalischen >Fan-Grüßejungen Deutschland< und gaben einem Mädchenideal, wie Clara Wieck es verkörperte, Auftrieb. Obwohl die junge Virtuosin sich selbst hässlich fand, strahlte sie auf der Bühne doch eine Aura von mädchenhafter Anmut und Grazie aus. Dass sie nicht allein durch ihr Aussehen bestach, erhöhte die Ernsthaftigkeit ihrer Reputation. Dagegen war die damals gefeierte Kammervirtuosin Jenny Lutzer, deren »glockenreine« Stimme und »Gewandheit in Colloratur« Clara Schumann 1841 tief beeindruckte, offenbar so fett, dass sie »die Gunst des Publikums« verlor. Auch Clara Schumann hörte lieber mit geschlossenen Augen zu, »das, aber kann ich sagen, mit großem Vergnügen«, »wie herrlich ist ihr Triller«. Auch rassistische Argumente konnten eine Rolle spielen. So beschrieb die Schumann-Schülerin Marfa Sabinina ihre Mitstudentin Nanette Falk 1851 als »sehr hässliche Jüdin«, deren einzige Chance darin bestünde, »irgendwo Musiklehrerin zu werden, damit ihr Bemühen nicht vergeblich bliebe«. »So ist das Publikum: Um zu gefallen, ist ein vollkommener künstlerischer Vortrag zu wenig, eine Künstlerin soll dazu noch ein schönes Aussehen haben, sonst wird ihr Erfolg fragwürdig«, lautete Sabininas Fazit (Wendler, S. 103; Lossewa 1997, S. 211). Trotzdem reichte es nicht, auf der Bühne bloß die Träume des Publikums zu spiegeln. Um zu fesseln mussten auch widerständige, etwa spezifische gesellschaftliche Grenzen und Normen sprengende Exzentrizitäten vorhanden sein (eine Spezialität von Franz Liszt) oder die Gendergrenzen kreuzende Momente, wie besondere Kraft und Energie bei Frauen oder Zartheit und Subtilität bei Männern. Erst das Außergewöhnliche weckte die Neugier und hielt die Anhängerschaft in Atem. Dabei unterschieden sich die Typen der 110
Starkult
Profilierung durchaus. Hier spielte auch das emotionale Potential der Stars eine zentrale Rolle. Virtuosen brachten unmittelbar Gefühle zum Ausdruck und erfüllten damit auf der Bühne paradoxerweise eine Illusion von spontanem, »wirklichem« Leben. Die Kunst produzierende Aktion wurde als intensives emotionales menschliches Handeln erlebt, obwohl (oder gerade weil) sich der Auftritt selber auf einer dem gewöhnlichen Alltag des Auditoriums enthobenen künstlichen Ebene ereignete. »Im Clavierspiele ausgezeichnet zu seyn« wäre schon etwas besonderes, las man im Allgemeinen musikalischen Anzeiger 1837 über Clara Wieck. Aber »dieses Instrument mit solcher Seele behandeln, damit mächtig auf das Gefühl wirken, zugleich mit solchem Verstände und solcher Auffassung die einzelnen Compositionen verschiedener Tonsetzer vortragen; das kann unter den Virtuosinnen nur Clara. Sie gefiel nicht, sie riß zur Bewunderung hin, und das Publicum applaudirte nicht, sondern jubelte« (in: Kat., S. l l l f ) . Auch wenn es so scheint, so geschieht doch auf der Bühne selten eine Handlung spontan. Im Gegenteil. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Schon Clara Wiecks Podiumsauftritte waren sorgfältig vorbereitet und einstudiert, wie die Wahl der Bühnengarderobe, samt Schmuck und Ansteckblume zeigt. Gleichzeitig ist die besondere Konzertsituation für die Zuhörer in der Regel mit einem positiven, euphorisierenden, oft sogar einmaligen Erlebnis verbunden, dessen Erinnerung fortan mit dem Image des Stars verknüpft bleibt. Daran hat nicht zuletzt auch die erhabene Konzertsaal-Architektur und die Inszenierung von Kultur als gleichsam sakralisierte Handlung Anteil, ein Phänomen, das auch auf die Virtuosen selbst zurück wirkte. Insgesamt beruht ein Starimage auf einem kumulativen Effekt von Einzelinformationen aus der präsenten Person auf der Bühne, der gehörten Musik sowie dem medial vermittelten Bild des Stars: Anzeigen, biografische Artikel, narrative Beschreibungen der Person, Rezensionen, Klatsch und Bildmaterialien. Dieses Paket von Informationen trifft auf Rezipienten, die eigene Vorstellungen mitbringen. Hier wirken im Publikum Auswahlprozesse, die durch bereits erworbenes Wissen, durch frühere Erfahrungen mit dem Star, durch den eigenen musikalischen Geschmack, aber auch die Selbstkonstruktion und Stilisierung als »Bildungsbürger« beeinflusst sind (Borgstedt 2006, S. 123ff). Allerdings lässt sich selbst mit den heute verwendeten aufwändigen Testverfahren nur schwer konkretisieren, was für individuelle und kollektive, psychologische und soziokulturelle Vorgänge tatsächlich im einzelnen Zuschauer von dem Star auf der Bühne ausgelöst werden {Star, S. 17ff). Für die historische Situation kann die Wirkung kaum vage angedeutet werden, da oft nicht einmal zu rekonstruieren ist, wie sich das Auditorium überhaupt zusammengesetzt hat.
Karrierestrategien
111
Ein einmal gewonnenes Image wirkt unabhängig vom punktuellen Eindruck weiter, weil die Zuschauer, die den Star kennen, bereits vorab etwas Bestimmtes erwarten und selbst Situationen, die von der ursprünglichen Erfahrung abweichen, dann aus der Perspektive des Vertrauten interpretieren. Allerdings steckt in dem dauerhaften Erfolg harte Arbeit. Instrumentalvirtuosen haben einen technischen Standard zu verteidigen, von dem sie nicht allzu sehr abfallen dürfen. Außerdem muss der Star, wenn er an der Spitze bleiben will, sich mit dem soziokulturellen Wandel weiter entwickeln und soll doch mit seinem öffentlich geprägten Bild noch übereinstimmen. Das heißt, zwischen dem Image und der Person muss eine konstante Relation bestehen, um sich über Jahrzehnte auf dem Podium halten zu können (Borgstedt 2006, S. 127; Star, S. 17ff). Blickt man aus der Perspektive dieser Vorgaben auf Clara Schumanns Karriere, so lassen sich folgende Punkte zusammenfassen. Clara Wiecks Image festigte sich in den Jahren ihres internationalen künstlerischen »Durchbruchs« 1837 und 1838. Es setzte sich aus heterogenen Komponenten zusammen, wie Verzauberung und Kompetenz, Gefühl und Intelligenz. Dazu kristallisierten sich Persönlichkeitsmerkmale wie bescheiden und tugendhaft, beständig, uneitel und charakterfest als Konstanten heraus. Sie entsprachen ihrem »Königinnenfaktor«. In das daraus abgeleitete »Star«-Bild konnten auch divergierende Aspekte integriert werden. Obwohl die lange Karriere Clara Schumanns in unterschiedlichen Phasen abrollte, die von spezifischen, historisch wandelbaren Akzenten bestimmt wurden, gelang es der Virtuosin, ihr Publikum immer wieder neu zu begeistern. Vor allem die Ubergänge von einer in die nächste Phase waren heikle Situationen, in denen das in der Öffentlichkeit präsentierte Erscheinungsbild modifiziert werden musste, um glaubwürdig zu bleiben. Nach dem Debüt 1828 bildete das Ende der Wunderkindphase eine solche Hürde. In der Zeit zwischen 1832 und dem internationalen »Durchbruch« 1837 gelang Clara Wieck der Imagewechsel vom Kinderstar zu einer ernsthaften Virtuosin. Eine intensive, umfassende musikalische Weiterbildung begleitete diesen Weg. Hier wurde die Basis aus theoretischem und handwerklichem Erfahrungswissen zementiert, durch das auch das ästhetische Verständnis artifizieller Musik wuchs. In dieser Ubergangsphase schärfte die Pianistin ihr schon frühzeitig angelegtes Profil als Spezialistin für anspruchsvolle Musik der »Klassik« (Bach und Beethoven) und der zeitgenössischen neuen Musik, wie sich etwa an Chopins »Don Juan«-Variationen op. 2 nachzeichnen lässt. Nachdem der Komponist selber in W i e n kaum
112
Starkult
damit durchgedrungen war, machte Clara Wieck das im Oktober 1831 von Julius Knorr in deutscher Erstaufführung vorgestellte Stück seit 1832 überhaupt erst einem größeren Hörerkreis bekannt. Die mit geballten technischen Raffinessen ausgestatteten Variationen umgab der Nimbus, kaum spielbar zu sein. Clara Wiecks bravouröse Interpretation nutzte Anfang der 1830er Jahre Chopins Image in Deutschland ebenso wie ihrem eigenen als Virtuosin. Mit dem internationalen Durchbruch 1837 festigte sich dann das bereits angelegte, exklusive künstlerische Profil Clara Wiecks. Von da an behauptete sie sich in der Spitzengruppe der in Europa bekannten Klaviervirtuosinnen und -virtuosen. Davon profitierte die Künstlerin sehr lange, und zwar auch in Zeiten, in denen sie seltener in der einschlägigen öffentlichen Szene auftrat, wie etwa 1840 oder in den Jahren 1847 bis 1853 und zwischen 1872 und 1874. Für zeitgenössische Virtuosinnen endete die Karriere oft schon mit der Hochzeit. Daher bedeutete die Ehe für Frauen eine zentrale Bruchstelle in der Karriere. Danach weiter zu machen barg einerseits das Risiko, gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen, enthielt andererseits aber auch die Chance, ein positives Beispiel für Kontinuität zu bieten. Die Pianistin trat ein halbes Jahr nach ihrer Heirat wieder auf, jetzt als Clara Schumann, und sie blieb trotz aller bewegten privaten Ereignisse beständig auf der Bühne präsent. Das machte ihren »Victoria-Faktor« aus. Solche kritischen Ubergangsphasen entsprachen nicht automatisch auch den als belastend oder schwierig empfundenen privaten Lebenssituationen. Zwischen der Selbstsicht und dem öffentlich wahrgenommenen Image bestanden in der Karriere Clara Schumanns durchaus Differenzen. So erlebte die junge Künstlerin 1839 und 1840 ihre radikale Ablösung vom Vater und den zähen Prozessverlauf um ihre Heiratserlaubnis als tiefen Einbruch ihrer Existenz. Stimmungsschwankungen mit Selbstzweifeln, ob sie überhaupt zur Künstlerin tauge, und optimistische Pläne für neue Tourneen nach Frankreich, England und Russland wechselten sich ab. Währenddessen registriert man in der Öffentlichkeit davon nur die - positiv bewertete - vor Gericht ausgetragene dramatische Liebesgeschichte und nicht die Selbstzweifel der Künstlerin, die sie allerdings auch sorgfältig vor dem Publikum zu verbergen wusste. Heirat und die Familienbildung brachten neue Herausforderungen. In der künstlerischen Selbstpräsentation rückte nun die von den Schumanns proklamierte Künstlergemeinschaft in den Vordergrund, und sie wurde auch öffentlich entsprechend wahrgenommen. »Ein Concert dieses Künstlerpaares gehört seit mehreren Jahren unter die bedeutendsten und interessantesten Erscheinungen im Leipziger Musikleben«, so die Allgemeine musikalische Zeitung (1846, Sp. 785). Gleichzeitig verfolgte die Künstlerin auch ihre SolokarKarrierestrategien
113
riere weiter. Mit ihrem ersten Konzert als Clara Schumann, das sie am 31. März 1841 zum Besten des Orchesterfonds veranstaltete, und in dem unter anderem Robert Schumanns Erste Sinfonie B-Dur op. 38 und ihr eigenes Lied »Am Strande« (Robert Burns) uraufgeführt wurden, gelang es überzeugend, an das Spitzenniveau der Mädchenzeit anzuknüpfen und dabei gleichzeitig die neue ertragreiche Künstlergemeinschaft vorzufuhren. »Ich wurde empfangen mit einem so anhaltenden Enthusiasmus, daß ich blaß und roth wurde - es hörte nicht auf, selbst als ich schon am Ciavier saß«, so schilderte die Virtuosin ihr Come-back als Clara Schumann (in: Wendler, S. 98). In Rezensionen ist noch einige Jahre lang der Name Wieck präsent, verbunden mit dem Hinweis, dass die Künstlerin jetzt als Clara Schumann ihren Höhenflug fortsetze. Clara Schumanns Rang als internationaler Star bekräftigten danach die erfolgreichen Tourneen nach Dänemark, Russland, Osterreich, Belgien und Holland zwischen 1842 und 1853 sowie die zahlreichen Auftritte bei Uraufführungen von Werken Robert Schumanns. Selbst Serien, die eigentlich floppten, wie die schlecht besuchten Wiener Konzerte um die Jahreswende 1847, trug nun das stabile Image und schadeten Clara Schumann weniger, als sie befürchtete. Stattdessen bestätigten sie das Bild einer ethisch hoch motivierten, seriösen Künstlerin, die sich einerseits selbstlos für neue Musik (verstärkt für die ihres Mannes) einsetzte und sich andererseits familiären Verantwortungen stellte. Damit fügte sie ihrem Image weitere emotionale Komponenten hinzu. Ihre ältesten Töchter nahmen die Schumanns mehrfach mit auf die Reise. Wo immer sie mit ihren Kinder auftraten, gaben sie offenbar auch ein entzückendes Familienidyll ab. Bei der Ausweitung ihrer internationalen Karriere 1854 reagierte Clara Schumann anfangs verunsichert und mit Auftrittängsten. Sie beruhten zumindest teilweise - darauf, dass die Virtuosin ihre Konzertreisen ohne Wissen des inzwischen hospitalisierten Ehemanns durchführte und sie deswegen ein schlechtes Gewissen plagte. Hier galt es allerdings nun auch, die Auftritte in der Öffentlichkeit als einen Akt der Liebe und Fürsorge für den erkrankten Mann zu vermitteln und das Bild der Mutter um die Komponente der Ernährerin zu erweitern. Mit Schumanns Krankheit und seinem Tod kamen emotional sehr hoch bewertete »Schicksalsschläge« hinzu, die das Image noch einmal modifizierten. Publikumsreaktionen wie die spontane Serenade, die der Leipziger Pauliner- und der Gesangsverein ihr im Oktober 1854 brachten, aber auch die Resonanz in der Presse zeigen, dass man die Auftritte der Künstlerin emphatisch unterstützte. Sie konnte ihren herausragenden Ruf in den folgenden Jahren nicht nur halten, sondern noch 114
Starkult
steigern, obwohl inzwischen eine neue Virtuosen-Generation, die bereits von Clara Schumanns Errungenschaften profitierte, das Podium erobert hatte. Nach dem frühen Tod von Mendelssohn Bartholdy, Chopin und Schumann sowie Liszts Rückzug vom Konzertpodium galt Clara Schumann in den späten 1850er Jahren als die wichtigste noch aktive Repräsentantin der vormärzlichen »Avantgarde«. Ihr Spiel und ihre Interpretationen erhielten dadurch den Nimbus hoher Authentizität. Längst verehrte das Publikum Clara Schumann so sehr, dass ihre Auftritte »nicht nur künstlerische, sondern auch gesellschaftliche Ereignisse« darstellten (Biba in: Kai., S. 123). Man ging ins Konzert der Schumann, egal, was sie spielte. Seit Ende der 1850er Jahre weitete Clara Schumann ihren Aktionsradius aus und erobert mit ihren Tourneen nach England, Irland und Schottland einen neuen Markt. Sie präsentierte sich nach wie vor als Beethoven-Interpretin, eine Rolle, die sie seit 1837 behauptete. Außerdem blieb der wichtigste Schwerpunkt ihres Repertoires die immer noch als avantgardistisch erlebte Klavier- und Kammermusik von Schumann und Chopin sowie später die von Brahms. Clara Schumann machte in dieser Phase die »authentische« Aufführung von Robert Schumanns Musik glaubwürdig zu ihrem Alleinstellungsmerkmal, auch wenn sie keineswegs als Einzige seine Werke spielte. Inzwischen waren ihre Auftritte über alle Zweifel erhaben, zumal sie mit einer kulturpolitischen Botschaft verknüpft wurden, nämlich der Verbreitung »höchster« Kunst. Erfolgreich gelang ihr eine Imagemodifikation, bei der die Aufmerksamkeit von der Person auf die »Botschaft« und von der Spezialistin für »neueste Musik« auf die Repräsentantin von zeitlos gültiger »Klassik« geleitet wurde. Die letzte Kurve ihrer Laufbahn, die Anstellung am Frankfurter Konservatorium 1878, bedeutete keine wirkliche Ubergangshürde mehr. Längst verkörperte Clara Schumann als »große alte Dame« eine lebende Institution der wahren Art des klassisch-romantischen Klavierspiels. Bei ihren Auftritten konkurrierte sie nicht mit dem Glamour der neuen Diven des Kaiserreichs. Vielmehr blieb sie ihrem Image treu. Zu offiziellen Anlässen erschien die Schumann »ganz in schwarzer Seide« und stets mit einem Witwenschleier geschmückt. »Sie sah wahrhaft königlich aus«, beschrieb ihr Enkel die Sechsundsiebzigjährige, die zum Empfang einlud. »Trotzdem sie von einigen Leiden geplagt ist (Reißen in den Fingern und im Arm, Gehörsschwäche) geht sie aufrecht und ungebrochen [...] Es ist in ihr eine enorme Willensstärke« (NZfM 1917, S. 88). Darüber hatte sie bereits als Kind verfügt.
Karrierestrategien
115
Die Nase zu groß, das Kinn zu spitzig Präsentation und Werbung Die Spielregeln für eine Karriere lernte die Zwölf) ährige auf ihrer ersten großen Tournee nach Paris, vom Herbst 1831 bis zum Frühjahr 1832. Ein Wunderkind musste auftritts- und reisetauglich sein. Clara Wieck übte schon sehr früh, sich in fremder Umgebung auf Klavieren unterschiedlicher Mechanik und Bauart zurecht zu finden und vor Publikum zu spielen. Gerade am Anfang war die Protektion berühmter Persönlichkeiten unverzichtbar. Paganinis, Goethes, Spohrs oder Marschners enthusiastische Urteile bedeuteten eine hervorragende Werbung. Nachdem Goethe dem Mädchen im Oktober 1831 eine Porträtmedaille mit der Widmung »der kunstreichen Clara Wieck« geschenkt hatte, beauftragte Wieck seine Frau, den mächtigen Musikjournalisten Friedrich Rochlitz einzuschalten, um die Tages- und Fachpresse davon zu unterrichten. Eine Zeitungsnotiz nützte »mehr als alle Empfehlungen« (Wieck Briefe, S. 38). Auch die lobenden Ermutigungen anderer Prominenter gab man sofort an die Presse weiter. Nicht nur das Leipziger Tageblatt und die Allgemeine musikalische Zeitung verbreiteten ab 1828 kontinuierlich Nachrichten über Clara Wiecks Auftritte, Reisen und Erfolge, sondern auch verschiedene andere überregionale Fach- und Unterhaltungsblätter. Auf Reisen machte sich das Wunderkind bekannt. Gezielt suchten die Wiecks Orte auf, die für ein Weiterkommen günstig schienen, und sie knüpften persönliche Netzwerke nach dem Schneeballsystem. Allerdings schien der Markt beim Start von Clara Wiecks Karriere bereits reichlich gesättigt gewesen zu sein. »Alle Welt fliehet die sogenannten Wunderkinder« (Wieck Briefe, S. 39). So fugte es sich glücklich, dass in der Gothaischen Zeitung am 2. November 1831 ein Bericht erschien mit dem Urteil, Clara Wieck wäre »keine Treibhauspflanze«, sondern ein kleines musikalisches Genie, wie der Vater zufrieden notierte. Stets hob er in den Werbebriefen hervor, dass seine Clara eine »musikalische Pianistin« sei. Doch wie sollten die Vorzüge seiner Tochter am besten präsentiert werden? »Auf den ersten Eindruck kommt viel an«. Er musste klug erwogen werden. »Ich bin allemal in Verlegenheit, ob ich soll Clara Etwas von sich, von Herz, von Field oder von Pixis vorspielen oder nur phantasieren lassen«, überlegte Wieck. »Und am Ende: Was bewundert man denn? Ihre Fertigkeit«. Die hatten andere auch. Fachleuten wie Moritz Hauptmann und Louis Spohr spielte Clara in Kassel ihre eigenen Kompositionen vor, darunter nicht erhaltene »Variationen N. 2«, die Spohr 116
Starkult
»als besonders originell« lobte. Jovial gab der berühmte Komponist seiner kleinen Kollegin fachliche Tipps. »Als dann holte er seine Frau und Tochter und Clara spielte nun [...] Chopin Variationen Op. 2, was alle mit höchstem Erstaunen anhörten« (Jb, 2., 8. und 12. November 1831; Hs FW). Wieck wagte trotz der Bedenken die große Reise nach Paris, weil es die letzte Gelegenheit war, die inzwischen zwölfj ährige Clara als Klavierspielwunder herumreichen zu können. Schumann registrierte empört, dass der Vater ihr Alter auf zehneinhalb herunter geschwindelt hatte. »Haben dergleichen Erbärmlichkeiten Namen, außer diesen?« Die Tournee sollte das Mädchen international bekannt machen und gleichzeitig dazu dienen, einen Imagewandel einzuleiten. Aus Leipzig reiste ein Kindersternchen ab und in Paris kam ein junger Teenager an, der als viel versprechendes neues Talent in der internationalen Musikszene mitspielen wollte. Vor der Abreise erkrankten die Wieckschen Kinder allerdings an Masern, was Friedrich Wieck in größte Unruhe versetzte. Der »Gedanke an Zilias Blindheit oder Tod«, notierte Schumann {Tb 1, S. 338 und 365). Das Mädchen genas. Am 25. September 1831 verließen Tochter und Vater Leipzig in Richtung Weimar. Auf der über sechs Monate dauernden Reise lernte Clara Wieck ihr späteres Berufsleben mit allen Höhen und Tiefen kennen. Schon an den Zwischenstationen in Weimar, Kassel, Frankfurt und Darmstadt bewährte sie sich auf fremdem Parkett. Die Fahrt von Darmstadt nach Paris dauerte damals in der Uberlandkutsche vier Tage und Nächte. »Clara hat alles ausgehalten wie ein Russe«, berichtete Wieck nach Hause. Sie gewann Routine darin, sich in stets wechselnde Kontexte und unvertraute Lebensgewohnheiten einzufinden. Vor allem lernte sie das Leben in der Metropole Paris kennen. »Du solltest uns Kaffee trinken sehen«, beschrieb Wieck das Pariser Frühstück, »aus ungeheurn Tassen, mit Butterbrot! [...] Die Soiréen gehen 10 Uhr an u. endigen 1 Uhr nachts. Abends 5 Uhr essen wir Mittag«. Ohnehin wären Franzosen überaus genügsam, speisten nur einmal am Tag winzige Portionen aus vielen geschwind herumgereichten Schüsseln, tränken nur wenig Wein mit Wasser vermischt und hielten bereitwillig vier Stunden dauernde Aufführungen in voll gestopften Sälen ohne Erfrischungen durch. Am meisten plagte Wieck allerdings das Rauchverbot in den Pariser Cafés und Salons. Man degouttierte den Geruch in den Kleidern, »eine Todesünde«, so Wieck {Wieck Briefe, S. 44). Zunächst musste investiert werden, um überhaupt den dortigen Standards zu entsprechen. »Morgen kommen Schneider u. Schumacher, um einen Franzosen aus mir zu machen,« feixte der Vater. Blaue Fräcke, enge Präsentation und Werbung
117
schwarze Hosen, Goldknöpfe, Samtkrägen und gelbe Handschuhe waren in der Herrenmode angesagt. »Ich sehe darin ungefähr wie eine junge Eiche im Rosenthal aus«. Seine breiten Stiefel glichen in der Form den Kähnen, die früher bei Würzen über die Mulde fuhren, schilderte er den Leipzigern plastisch. Dazu kamen Kleider, Hüte und Handschuhe fur Clara. Auch bei den Auftrittskostümen galten andere Konventionen, so dass das erst in Frankfurt erstandene rote Seidenkleid für Paris unbrauchbar war. »Clara muß immer ganz weiß gehen; in jeder Soirée muß alles neu seyn«. Allerdings erhielten sie zur Hygiene nur »jeden Morgen ein Glas Wasser« und wöchentlich ein winziges Handtuch. »Das ist der Clara eben recht« ( Wieck Briefe, S. 43ff). Man brauchte auch eine repräsentative Adresse. Sie verriet Seriosität und Statusbewusstsein. Bei ihrer ersten Parisreise logierten sie im Hôtel de Bergère, rue de Bergère im Faubourg Montmartre. Sofern es möglich war, wählten die Wiecks auf ihren Tourneen die besten Häuser vor Ort. In Berlin war dies schon in den 1830er Jahren das Hotel de Russie Unter den Linden. »Wer im Hotel de Russie [...] wohnt, ist schon 10 procent mehr werth«, so Wieck ( Wieck Briefe, S. 59). In Wien bezogen sie wie Franz Liszt das Hotel Stadt Frankfurt. Diese Häuser, in denen »tout le monde« zusammen kam, waren beliebte Treffpunkte mit einem sehr guten Ruf. Sie verfügten oft sogar über eigene kleine AufRihrungssäle, in denen private Soireen veranstaltet werden konnten. Paris setzte sie in Erstaunen. Abends bewunderten die Besucher den Glanz der schon mit Straßenlaternen beleuchteten Stadt, die »ville lumière«. »Wir sahen das Palais royale - Tuillerien, Louvre, die Seine mit einer eisernen Brücke«, ein technisches Novum, und »die Boulevards mit den 7 Theatern« (Jb, 19. Februar 1832). Der Montmartre, den sie bestiegen, um Milch zu trinken, lag zu dieser Zeit noch außerhalb und war - ohne die das Panorama heute dominierende Kirche Sacré Coeur - eine ländliche Gegend. Noch existierten Georges-Eugène Haussmanns großzügig angelegte und die Stadt neu ordnende Boulevards nicht. Auch die Pariser Oper strahlte noch nicht in Garniers luxuriöser Pracht. Die nicht mit Werbung, Vorspielen und Konzertorganisation besetzte Zeit nutzten sie zur Weiterbildung. In der italienischen Oper sahen die Wiecks 1832 Giovanni Battista Rubini in der Titelrolle von Bellinis II Pirata. Er galt als der beste Belcanto-Sänger seiner Zeit. Bellinis Melodien und Rubinis Technik lieferten auch das mentale musikalische Vorbild für das von Friedrich Wieck propagierte beseelte »singende« Spiel am Klavier. Im Conservatoire bestaunten Vater und Tochter, mit welcher Präzision das dortige Orchester unter der Leitung von François-Antoine Habeneck nicht nur Beethovens Sinfonien aufführte, sondern auch einzelne Sätze aus den Streichquartetten op. 59, »mit 118
Starkult
der höchsten Reinheit von ungefähr 80 Streichinstrumenten vorgetragen«. Diesen überwältigen Eindruck der Aufführung bestätigte auch Chopin. »Das Orchester non plus ultra [...] Die Geige so groß wie das Schloß, die Viola wie die Bank und die Celli wie eine luthersche Kathedrale«, schrieb er nach Polen (Chopin 1984, S. 140f). Unentwegt lernte man neue Musik kennen. »Wo soll man hier hin mit aller Musik? Können menschliche Ohren das aushalten?« fragte Wieck (Jb, 18. März 1832). In Paris tummelte sich im Frühjahr 1832 alles, was im Musikbetrieb Rang und Namen hatte oder haben wollte. Nur die Malibran war gerade abgereist. Man konnte vor Ort studieren, wie hoch das internationale musikalische Niveau lag und sich daran orientieren. Paganini, Meyerbeer, Baillot und Paer suchten die Wiecks auf. Die ältere Garde berühmter Klaviervirtuosen wie Kalkbrenner, Herz und Pixis hielt Hof. Aber auch die junge »Avantgarde«, vertreten durch Chopin, der sein Klavierkonzert e-Moll op. 11 spielte (»unvergleichlich schön u. originell«, so Wiecks Urteil, Jb, 25. Februar 1832), Hiller und Mendelssohn, dessen Oktett op. 20 zur Pein des Komponisten durch eine schludrige Ausführung verhunzt wurde, behauptete sich. Auch der junge Liszt befand sich in Paris und sondierte das Terrain. Clara Wieck wollte ihr Pariser Debüt in einem Konzert von Paganini geben, wie versprochen. Es wäre eine hervorragende Werbung gewesen. Doch der Auftritt fiel ins Wasser. Erst war Paganini wochenlang unpässlich, dann brach in Paris eine Cholera-Epidemie aus, und die Wiecks flüchteten aus der Stadt. Finanziell brachte die Tournee keinen Überschuss. An einem der wenigen Abende, an denen Clara Wieck einen Gewinn einspielte, ruinierte sie ihr weißes Kleid durch »Punschflecken« (Jb, 22. März 1832). Ärgerlich. Der Anschaffungspreis für den Ersatz verschlang fast das gesamte Honorar. Trotzdem war die Tournee ein Erfolg, und sie brachte einen wichtigen Schub für die Karriere. Clara Wieck hatte die Wunderkindflügel abgestreift. Zur positiven Bilanz zählte die Erfahrung, dass das Mädchen die Fachkollegen von seinen Qualitäten überzeugen konnte. Clara Wieck gelang es, sich bei einflussreichen Förderern, darunter die führenden Musikfunktionäre und Klavierfabrikanten Pleyel, Erard, Schlesinger oder Stoepel musikalisch glücklich einzuführen und ihren Anspruch auf Mitsprache im internationalen Reigen großer Virtuosinnen und Virtuosen anzumelden. Das hatte eine ganz praktische Konsequenz: »Den 25. [Februar 1832] erhielten wir auch von Erard ein tafelförmiges Instrument«. Ein gutes Klavier war nötig, um ihr Können ins rechte Licht zu stellen. Präsentation und Werbung
119
Aus Paris übernahm die junge Virtuosin ab 1832 die Praxis, alles auswendig zu spielen. Hierin folgten die Virtuosen den Schauspielern. Seit dem 18. Jahrhundert präsentierten die ihre Rollen auswendig und verhalfen der Bühnenillusion zu viel größerer Präsenz. Auch die Wieck erzielte auf dem Podium damit eine fantastische Wirkung, zumal die Praxis in Deutschland noch sehr ungewohnt war. Einer der wenigen Virtuosen, die auswendig spielten, war zu dieser Zeit Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Auswendigspielen wurde eines ihrer bemerkenswerten Markenzeichen in den frühen 1830er Jahren. Die gesamte Darbietung erhielt dadurch den Charakter einer so eben erfundenen Improvisation und perfektionierte auch für Musikexperten die Illusion einer unmittelbaren Verkörperung der musikalischen Persona des Stücks. Zwar erforderte es eine zusätzliche Gedächtnisleistung, verschaffte aber den Künstlern dafür freiere rhetorische Gestaltungsmöglichkeiten. Später behielt auch Clara Schumann diese Praxis bei, trotz der sich verstärkenden Angst, den Faden zu verlieren. Nach Noten zu spielen käme ihr vor, »als bände ich mir die Flügel, die doch noch immer einige Schwungkraft besitzen«, schrieb sie Brahms 1871 (Schumann-Brahms 1, S. 636). In Paris vermarkteten sich die Stars auch durch Miniaturporträts, auf Münzen geprägte Konterfeis oder andere mit dem Star verbundene Devotionalien. Diese Form der materiellen Popularisierung durch erschwingliche Souvenirs lernten die Virtuosen von den Königshäusern. Napoleon I. setzte derartige Werbemittel bereits systematisch ein. Schon vor der Einführung der Fotografie erhielten »Star«-Bildchen eine wichtige Bedeutung, weil sie die Popularität festigten. Das Medium Bildwerbung wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts durch die technische Entwicklung der grafischen Reproduktion attraktiv. Schnellpressen neuen Typs und eine verbesserte industrielle Papierfabrikation lösten eine »Kommunikationsrevolution« (Zorn 1976, S. 580) aus. Davon profitierten Buchhandel und Zeitungswesen ebenso wie die auf Druckgrafik spezialisierten Künstler, Werkstätten und Verleger. Ein brauchbares aktuelles Bild von Clara fehlte. Eduard Fechner, Wiecks Schwager, der als Maler und Grafiker in Paris arbeitete und die beiden Leipziger glücklich durch den französischen Alltag lotste, bot sich an. Er malte 1832 in Paris ein - heute verschollenes - Porträt, das Alfred-Léon Lemercier lithografierte. Die Abzüge wurden in Paris und London verlegt (in: Kat., S. 16 und 329). Es lässt sich nicht mehr zurückverfolgen, wie hoch die Auflage war. Erhalten ist lediglich Wiecks Bestellung von weiteren achtzig Stück, nachdem die erste Sendung verteilt war. Obwohl das Pariser Abbild die Zwölfjährige nicht besonders gut getroffen zu haben scheint - »die Nase zu groß, dito der Mund«, »das Kinn zu spit120
Starkult
zig und lang, der obere Körper zu vollkommen gegen das Gesicht«, der »Arm zu dick und steif, die Finger zu lang«, kritisierte der Vater - so erfüllte es mit dem eingravierten Namen Clara Wiecks doch bereits vollkommen seine Starbild-Funktion. Wenn man davon ausgeht, dass die Bilder in den 1830er Jahren ähnlich wie heute bewertet wurden, so störte eine nur entfernte Ähnlichkeit nicht wirklich. Das Porträt sollte als privates Erinnerungsstück und kleine Ikone der idealisierten Künstlerin dienen, ein Stück vom Star, das man mit nach Hause nahm. In schlichter Version kostete es sechzehn Groschen, auf feinem chinesischem Papier einen Reichstaler, ein stolzer Preis, den die »Enthusiasten« aber offenbar bereit waren zu zahlen (in: Porträts, S. 17f). Das Bild zeigt kein Kind mehr, sondern einen sehr jungen und noch zierlichen Teenager, in gelassener Haltung sitzend, in einem weißen Kleid, dessen topmodischer Schnitt diskret Modernität dokumentiert. Der geraffte und mit Tüll verkleidete Ausschnitt, Wespentaille, breiter Gürtel und weiter Rock sowie die damals beliebten voluminösen Gigot-Ärmel (»Keulenärmel«) bildeten eine fantasievolle zeitgenössische Umsetzungen einer romantischen Mittelaltermode ab, die sich an Rittern und Feen aus Märchen und Sagen orientierte und in den 1830er Jahren »en vogue« war (Fashion 1, S. 184ff). Zum aufwändigen und doch mädchenhaften Kleid passt die sorgfaltig mit Schleifen und Bändern drapierte Frisur (Abb. 1). Die hier zu sehende Aufmachung dürfte die Pariser Bühnengarderobe Clara Wiecks wiedergeben. Unschuldiges Weiß, duftiger Tüll und Mousseline, der leicht geneigte Kopf sowie der scheue, dem direkten Kontakt ausweichende Blick unterstreichen den rührenden Zug. Doch ruhen die auffallend großen Hände auf einem Notenblatt, dessen Inhalt allerdings nicht zu entziffern ist. Hielte das Mädchen Veilchen oder ein Kätzchen auf dem Schoss, so wäre das biedermeierliche Genrebild perfekt. Seine besondere Wirkung entfaltet es indessen in Zusammenhang mit der gehörten Musik. Zu dieser Zeit bot Clara Wieck Werke der technisch und musikalisch schwierigsten Kategorie. Erst der Kontrast zwischen dem ephemeren in den höheren Sphären romantischer Kunst schwebenden Mädchen und der Vehemenz der Musik, die es mit technischer Perfektion, temperamentvollem Körpereinsatz und in oft Schwindel erregendem Tempo darbot, bildet jene über eine unschuldige Erotisierung hinaus gehende unbegreifliche Mischung, durch die die Virtuosin anziehend und faszinierend wirkte. Die kräftigen Hände und Arme sollten »die männliche Kraft und Ausdauer« ausdrücken, so Friedrich Wieck (in: Porträts, S. 17). Clara schickte ein Bild ihrer Mutter in Berlin, bedachte auch Schumann damit und nutzte die Abzüge im übrigen, um sich bei verschiedenen FördePräsentation und Werbung
121
rem zu bedanken, die Nachrichten und Artikel über sie in der Presse verbreitet hatten. Zu ihrer eigenen Überraschung hing in Karlsbad bereits ihr Porträt öffentlich aus, als Vater und Tochter dort zur Kur weilten (Jb, 29. August 1833). Im Oktober 1833 schien die Auflage längst vergriffen zu sein. »Warum hält der Verleger hier [in Leipzig] keinen Vorrath? - Diese Woche wurden wieder mehrere verlanget - allein es sind schon seit einem Jahr keine mehr zu finden«, so hakte Wieck bei Fechner nach. Er wollte auch die Zeitungsredaktionen bedienen: »wie viele warten z. B. in Altenburg, Weimar, Gotha, Cassel u.s.w. darauf!« (Wieck Briefe, S. 47; Porträts, S. 17). In jenem Jahr nach der Parisreise hatte Clara Wieck bereits vierzig eigene Konzerte gegeben, für die sie das Werbematerial brauchte. Beim Transfer vom Wunderkind zum viel versprechenden neuen Stern am Künsderhimmel kam der ausgesprochene Jugendkult des Vormärz Clara Wieck entgegen. Noch sehr junge Interpreten auf der Bühne zu sehen, galt nicht als ungewöhnlich. In einem Konzert der knapp dreizehnjährigen Clara Wieck debütierte am 9. Juli 1832 die vierzehnjährige Sängerin Livia Gerhardt im Leipziger Gewandhaus so erfolgreich, dass sie als »zweite Sängerin« von der Konzertdirektion engagiert wurde (Dörffel 1980, 1, S. 69f). Die beiden Künstlerinnen zählten zusammen nicht einmal 30 Jahre. Clara Wieck trat hier erstmals auch als Veranstalterin auf. Livia sang Arien von Ferdinando Paér, Clara spielte Pixis, Herz und Chopin. Zur Erinnerung an den erfolgreichen Start schenkte sie ihrer Mitstreiterin und Freundin einen Ring. Vier Jahre später gab die noch nicht einmal volljährige Sängerin bereits ihr Abschiedskonzert, da sie den Juristen Woldemar Frege heiratete. »Ihr Talent überflügelte die Zeit, ihr Wille ihre Kraft«, hieß es im Leipziger Tageblatt vom 24. Mai 1836 (in: GS 2, S. 353). Nach ihrer Heirat übernahm Livia Frege offenbar nur noch sehr ausgesuchte Partien, wie später die Titelrolle in Schumanns Oratorium Das Paradies und die Peri op. 50, das 1843 uraufgeführt wurde. Eine Bestätigung ihres neuen Selbstverständnisses als professionelle Virtuosin spiegelt das von Julius Giere 1835 in Hannover angefertigte Künstlerbild Clara Wiecks (Abb. 2). Es ersetzte auf der Winter-Tournee 1834/35 ein heute nicht erhaltenes, im Herbst 1834 in den »Kunstgewölben« von Magdeburg ausgestelltes Porträt, das offenbar komplett misslungen war und sich deswegen nicht verkaufte. Mehrere Maler böten ihre Dienste an, schrieb Wieck aus Magdeburg, »aber sie hat ja nicht Zeit zum Sitzen«. Inzwischen versprach nämlich das Porträtieren des jungen Stars den Malern ein einträgliches Geschäft und dem Mädchen winkte ein Honorar, wenn es für Ateliersitzung zur Verfugung stand. 122
Starkult
Erst einige Wochen später, im Januar 1835, wurde Clara dann »wunderschön lithographiert« (Wieck Briefe, S. 48 und 56). Julius Giere präsentiert Clara Wieck als Virtuosin und Komponistin in Aktion, sozusagen während der Ausübung ihres Berufs, am Flügel sitzend (Busch-Salmen 1996, S. 813). Die junge Künsderin, nach der neuesten Mode gekleidet in einem duftigen, mit Rispen und floralen Ornamenten verzierten und den immer noch beliebten voluminösen Keulenärmeln sehr modisch geschnittenem chintzartigen Gewand, samt einer geflochtenen Schmuckschnur in den sorgfältig gestylten Haaren verbreitet hier Weldäufigkeit. Sie schaut dem Betrachter selbstsicher entgegen. Aufgeschlagen auf dem Notenpult steht gut erkennbar ein zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollendetes Werk, nämlich das Finale aus ihrem eigenen erst im darauf folgenden November uraufgefuhrten ersten Klavierkonzert op. 7 (Reich 1991, S. 76). Als Konzertsatz mit Orchester erklang es unter anderem am 15. Januar 1835 in Braunschweig. Der inszenierte »Work-inprogress«-Einblick unterstreicht nicht nur den Anspruch, als Komponistenvirtuosin wahrgenommen zu werden, sondern er suggeriert auch eine von Clara Wieck gebotene tagesfrische musikalische Aktualität. In einer Zeit, die Beschleunigung als erstrebenswerte dynamische Qualität erlebte, zog es die Künstlerin zu den vorderen Reihen der musikalischen »Avantgarde«. Ihr Klavierkonzert spiegelt dieses Lebensgefuhl wider.
Auffliegender Phoenix Premier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6 »Das erste, was wir hörten, flog wie ein junger Phoenix vor uns auf, der nach oben flatterte«, so begann Robert Schumann seinen Konzertbericht über den Abend des 9. November 1835 im Leipziger Gewandhaus, an dem Clara Wieck ihr eigenes Klavierkonzert a-Moll op. 7 erstmals öffentlich vorstellte. »Weiße sehnende Rosen und perlende Lilienkelche neigten hinüber, und drüben nickten Orangenblüten und Myrten, und dazwischen streckten Erlen und Trauerweiden ihre melancholischen Schatten aus: mitten drin aber wogte ein strahlendes Mädchenantlitz und suchte sich Blumen zum Kranz« (in: GS 2, S. 280). Was bekommt man zu hören? Ohne Einleitung bricht das Eröffnungsthema im Orchester gleich energisch heraus, hellt sich nach Dur auf, und während eine kleine Uberleitung beginnt, greift schon das Soloinstrument mit markanten Oktavläufen ins Geschehen ein und treibt den Satz vorwärts. Den Eindruck überschäumenPremier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6
123
der Energie und fortstürmenden Temperaments erzielt die Komponistin mit beschleunigten Rhythmen und verkürzten metrischen Phrasen. Anstelle eines Kontrastthemas erldingt ein kleines, unspezifisches Gebilde, das wie ein kurzes Atemschöpfen wirkt, bevor die »Soloexposition«, die Vorstellung des Hauptthemas im Klavier, erfolgt. Es mildert nun seinen Charakter, weil das Klavier das Thema anders artikuliert als das Orchester. Kleine Verzierungen (Fioreturen) umspielen die Haupttöne. Diese schmückenden Nebennoten, eigentlich nur ein schmeichelnder Zusatz, scheinen in den folgenden Passagen die Oberhand zu gewinnen. So löst sich das Klaviersolo bald aus der thematischen Bindung und kostet die freiwerdenden Kräfte mit eigenen singenden Linien, verspielten Figuren, vertrackten Intervallketten und waghalsigen Sprüngen aus, dass die Tasten nur so fliegen. Mit frischer Unbekümmertheit fegt der Satz über traditionelle Formmodelle hinweg. Dazwischen gibt es Momente überraschend verhaltener lyrischer Besinnung. Kaum hat man sich darauf eingelassen, so stürmt das Solo auch schon mit Lust in eine Reprise, die gar nicht erst zur Ausgangstonart zurückkehrt, sondern gleich in die Romanze, den zweiten Satz übergeht. Erst hier kommt der frische Energieschub des Anfangs zur Ruhe. AsDur, die »Mondschein-Tonart« wie Schumann sie nennt, breitet sich aus und taucht alles in eine neue Klangfarbe. Aus einem kleinen Kernmotiv entspinnt das Klaviersolo seine zarte Melodie, deren sehnsuchtsvoller Zug den ganzen Satz beherrscht. Dieser dreiteilige langsame Satz ist eine Ausnahme in der Konzertliteratur, weil er ohne Orchester auskommt. Stattdessen tritt als einziger Dialogpartner in der Reprise ein Violoncello hinzu und formuliert jetzt die Melodie, die das Klavier mit duftigen Figuren umrankt. Der repräsentative Aspekt des Instrumentalkonzerts tritt damit ganz zurück, als hätte man die Bühne verlassen, um nun einer intimeren, kammermusikalischen Auffuhrung zu lauschen. Mit dem Einsatz der warmen Klangfarbe des Cellotons und dessen emotionaleren Vortragsmöglichkeiten im linearen Spiel intensiviert sich der Ausdruck der Romanze entschieden. Ein Vorbild dafür konnte Clara Wieck nicht nur in Webers erstem Klavierkonzert C-Dur von 1810/11, sondern auch in Moscheies' fünftem Klavierkonzert G-Dur op. 91 von 1826 finden. Berühmt geworden ist dieser Instrumentaleffekt, den auch Liszt in seinem zweiten Klavierkonzert A-Dur nutzte, dann aber erst sehr viel später, nämlich durch das 1881 uraufgeführte zweite Klavierkonzert B-Dur op. 83 von Brahms, in dem ein Solocello das Hauptthema des langsamen Satzes singt. Ein kleiner Ubergang im »misteroso«-Stil führt in Wiecks Konzert von der Romanze ins Finale. Es beginnt konventionell. Paukenwirbel und Trom124
Starkult
petenfanfare rollen gleichsam den roten Teppich aus fiir den Auftritt des Solos, das mit einem schwungvollen, tänzerischen Rondothema einsetzt. Diese Inszenierung ist eine Reminiszenz an Kalkbrenners Klavierkonzert d-Moll op. 61 von 1823. Aus dem sich anschließenden Couplet wird dann von Wieck ein neues Motiv entsponnen. Es erhält im Verlauf des Finales mehr und mehr poetisches Gewicht und verselbständigt sich zu einem eigenen kleinen lyrischen Gebilde, das, vor der rasanten Stretta, zwischen Klaviersolo und einzelnen Bläsersolisten anmutig hin und her gereicht wird. Diese Instrumentationsidee dürfte von Robert Schumann stammen. Schon im Januar 1833 plante Clara Wieck »ein großes Konzert« für ihr eigenes Repertoire zu schreiben, und sie hatte Ende des Jahres einen einsätzigen Entwurf fertig komponiert. Er ist vermutlich auf Gieres Lithographie zu sehen. Die junge Komponistin war ehrgeizig. Ihr Konzert sollte vor allem die Aufmerksamkeit der »Kenner« erregen. Damit stachelte sie Schumanns Interesse an, der selber schon mit verschiedenen Entwürfen für ein Klavierkonzert experimentiert hatte. Schumann versprach, bei der Instrumentation zu helfen und lieferte im Februar 1834 auch eine Partitur des späteren Finales. Erst 1835 entstanden der zweite und erste Satz. »Sie werden lächeln, doch es ist wahr. 1. Habe ich meine Partitur beendigt; 2. die Stimmen alle selbst ausgeschrieben, und das in zwei Tagen«, teilte sie Schumann am 1. September 1835 triumphierend mit (Bw, S. 17). Nach der zwei Monate später erfolgten Uraufführung arbeitete sie das Konzert offenbar noch einmal um, so dass die heute bekannte Fassung nicht ganz mit der ursprünglichen übereinstimmt, wie das erhaltene Autograph des Finales zeigt (Klassen 1990, S.135ff). Clara Wieck widmete ihr Konzert Louis Spohr, den sie in dieser Zeit als Vorbild verehrte. Der Verlag Hofmeister brachte dann den Klavierauszug mit Stimmen 1837 heraus und zahlte der jungem Komponistin zum ersten Mal ein Honorar: 80 Taler (mehr als Mendelssohns Monatsgehalt) und zwölf Freiexemplare (Jb, 2. Februar 1837). Die Uraufführung im November 1835 war hervorragend platziert. Den von Clara Wieck selber veranstalteten Abend leitete der neue musikalische Direktor des Gewandhauses, Mendelssohn Bartholdy, der einen Monat zuvor sein Amt angetreten hatte. Mendelssohns Capriccio brillant h-Moll op. 22 für Klavier und Orchester spielte Clara Wieck als zweites Stück. Das dritte Klavierkonzert des Abends führten Wieck, Mendelssohn Bartholdy und Louis Rakemann gemeinsam auf, nämlich Johann Sebastian Bachs Concert fiir drei Klaviere d-Moll BWV 1063. Nach Angaben Dörffels erklang damit zum ersten Mal ein Werk des Thomaskantors im Leipziger Gewandhaus (Dörffel 1980,1, S. 88). »Es muß den Bewohnern Leipzigs eine interessante Premier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6
125
und merkwürdige Erscheinung sein, wenn der Geist ihres ehemaligen Mitbürgers, des alten Bach, in seiner ganzen tief-ernsten, gutmütig-kapriziösen, sauertöpfischen Liebenswürdigkeit einmal in ihre Mitte tritt«, unkte Schumann in seiner Zeitung (in: GS 2, S. 356). Den damaligen Veranstaltungsgepflogenheiten entsprechend, folgten zwischen und nach den Klavierkonzerten Arien von Mozart und Rossini sowie Herz' Bravour- Variationen über ein Thema aus Rossinis »Belagerung von Corinth« op. 36. Das Konzert op. 7 erzielte insgesamt eine positive Resonanz, wenn auch nicht ohne Vorbehalte. Auf der einen Seite faszinierten die Kompositionsleistung der jungen Künstlerin und ihre stupende Virtuosität, gepaart mit dem ausdrucksstarken Soloeffekt im Mittelteil. Auf der anderen Seite bereiteten die scheinbar sorglos gekoppelten konstrastiven Gestaltungsmomente - der lebhafte Schwung des thematischen Gerüsts, die rasante Artistik, die träumerisch schweifenden Solopartien innerhalb der Allegro-Sitze, die schwer überschaubare Mischung aus freier Fantasie und Konvention - Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Doch das war auch gar nicht beabsichtigt. Die Zuhörer sollten nicht in einen kritischen Dialog verwickelt, sondern vielmehr verzaubert werden und im Sturm mitfliegen. Die »energische Kraft« und den »männlich gediegenen Geist« bewunderte der Rezensent des Allgemeinen musikalischen Anzeigers (1838, S. 143). »Ein wenig ultraromantisch [ . . . ] mitunter etwas zerrissen, doch mit Geist und Phantasie entworfen«, schrieb die Allgemeine musikalische Zeitung (1837, Sp. 858); »absichtlich rhapsodisch«, »mehr Phantasiestück als Concert für das Concert«, las man im Freischütz (1837, S. 221), befremdlich in der harmonischen Disposition von a-Moll und As-Dur, so lassen sich die Urteile zusammenfassen. Sie dürften ungefähr Clara Wiecks Ambitionen widerspiegeln, bis auf die Stellen, an denen es hieß, »wenn Evens Töchter nur im lieben Haus- und Ehestande keine anderen, gröberen Sprünge, Ab- oder Ausweichungen machten« als von A nach As, »dann wäre alles gut« (Allgemeiner musikalischer Anzeiger 1838, S. 143). Auch dass Carl Ferdinand Becker kniff und sich in der Neuen Zeitschrift für Musik herauswand mit der Ausrede, von einer Rezension sollte keine Rede sein, »weil wir es mit dem Werke einer Dame zu thun haben« (1837, S. 36), kam bei der Komponistin nicht gut an. Clara Wieck kannte die damals gängigen großen Klavierkonzerte und hatte eine Vorstellung davon, was auf dem Podium zählte. Nicht Mozart oder Beethoven, sondern Kalkbrenner, Field, Hummel und Moscheies boten Anfang der 1830er Jahre die Orientierung. Deren Werke gehörten zu den öffentlich meist gespielten Stücken im Repertoire (Koiwa 2003, S. 7ff). Clara Wieck lernte daran den Aufbau eines wirkungsvollen Podiumsstücks und be126
Starkult
zog zahlreiche Anregungen für ihre eigene Komposition. Soweit der Standard. Doch den elektrisierenden Griff nach den Sternen konnte man vor allem in den Konzerten der jüngeren Generation hören. Demonstrierten Mendelssohn Bartholdys Konzertkompositionen, das Capriccio brillant h-Moll op. 22 und das Klavierkonzert g-Moll op. 25, wie sich vorwärts stürmendes Temperament diskret in einer soliden Satztechnik verankern ließ, so entführten Chopins Klavierkonzerte auf eine Weise in die Zauberwelt der Kunst, vor der eine kritisch-analytische Beschreibung versagte: »Sprachlosigkeit aus Verehrung«, so Schumann (GS 1, S. 165). Chopin gelang das riskante Kunststück, die figurativen Passagen seiner Konzerte so unerhört attraktiv und neuartig zu gestalten, dass sie die thematischen Partien fast an Bedeutung überragten. Da das dort verwendete Material aus peripheren Floskeln, Akkord- und Skalenfiguren unspezifischer war, das heißt allgemeiner und abstrakter als die charakteristischen Themen und ihre Motive, und die Harmonik so elegant durch entlegene Regionen schweifte, dass man schon bald den Kontakt zum Ausgangspunkt verlor, gelang es, die Aufmerksamkeit der Hörenden von einem bewussten Nachvollzug der thematischen Geschichte ab- und sie in den Sog eines nicht mehr kontrollierbaren wundersamen Höhenflugs hineinzuziehen. Friedrich Wieck hielt 1832 das e-Moll-Konzert op. 11 für so avanciert, dass es »vor einem gemischten Publikum [ . . . ] nicht zu spielen« wäre. Die »Passagen sind neu, ungeheuer schwer u. nicht nach der gewöhnÜchen Art brillant«, urteilte er, nach Chopins Auftritt in Paris (Jb, 14. März 1832). Ein Jahr später studierte seine Tochter es ein. Diesem Ideal glühte Clara Wieck nach. Es ging weit über den pragmatischen Anlass hinaus und entfachte Lust, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Originalität, Einfallsreichtum und Verzauberung waren gefragt. Für die Hörer sollte alles faszinierend unbekannt sein, dabei unmittelbar und wie improvisiert wirken. Nach Chopins Vorbild sollten die Grenzen zwischen thematischen und figurativen Abschnitten ununterscheidbar verwischt werden, was eine entscheidende Aufwertung der virtuosen Elemente bedeutete. Die Klangflächen bildenden Ornamente erhielten eine neue Funktion als ästhetisches Experimentierfeld. Dabei wurde das Gelingen nicht allein an der W i r kung gemessen, sondern vor allem daran, wie gut und sinnvoll die Komponierenden die spezifischen Ausdrucksqualitäten des Solo-Instruments (und nicht bloß ihre eigenen flinken Finger) ins rechte Licht rückten. Die quasi sinfonische Dignität einer integrativen, motivisch-thematischen Durchgestaltung von Orchester- und Solopartie, wie Mendelssohn Bartholdy sie bot, war im ästhetischen Diskurs der 1830er Jahre nicht vorrangig. Premier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6
127
Diese Perspektive hing nicht zuletzt mit den rasanten Fortschritten im Klavierbau und den daraus resultierenden Folgen für den spieltechnischen Reichtum zusammen. Mit der stets weiter entwickelten Mechanik gelang nun etwa ein durch sehr schnelle Repetitionsfiguren evozierter Kastagnetteneffekt wie Clara Wieck ihn als spanisches Kolorit in ihrer Caprice à la Boléro op. 5 Nr. 2 nutzte. Die Ausdrucksmöglichkeiten veränderten sich in kurzer Zeit so schnell, dass Konzerte mitunter innerhalb weniger Jahre schon »alt« wirken konnten. Aufgrund dieser dramatischen Entwicklung galt das Klavier ästhetisch als das modernste Instrument für die Entwicklung bislang ungehörter Artikulationsfiguren und Klangkonzepte. Die so genannten »Virtuosenkonzerte« enthalten mehr avantgardistisches Potential, als das Etikett vermuten lässt. Damalige Klaviere verfugten über stärker differenzierte Registerfarben als die heutigen, sie entfalteten aber nicht soviel Klangvolumen, dass sie sich in einem Orchestertutti ohne weiteres hätten behaupten können. Während der Solopartien war deswegen ein sparsamer Orchestereinsatz gefordert, Vorgaben, die auch die Kompositionsentwürfe wesentlich beeinflussten. Diesen Aspekt bildet die Romanze aus Clara Wiecks Konzert unmittelbar ab. In der historischen Auffuhrungssituation musste außerdem mitberechnet werden, dass an vielen Orten keine Orchester zur Verfugung standen. Und selbst wenn es welche gab, konnte man nicht sicher sein, dass sie nach einer Durchspielprobe (mehr war nicht üblich) in der Lage gewesen wären, lange und anspruchsvolle Partituren auch nur halbwegs zufrieden stellend auszufuhren. In Darmstadt, »wo das Orchester« in den »Tuttis« von Chopins Variationen op. 2 »wankte u. nicht einsetzte«, half Clara »unbegreiflicher Weise« nicht nach, wie der Vater zankte (Jb, 5. Februar 1832). Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hielt sich die Praxis, fur Klavierkonzerte alternativ zum Orchester eine Quintettbegleitung vorzusehen. Nach dem Vorbild von Spohrs Violinkonzert in Form einer Gesangsszene op. 47 waren in Clara Wiecks Opus 7 alle drei Sätze durch komponierte Ubergänge zu einem Ganzen verbunden. Daher konnte es als phantasieartiges Konzertstück in drei Teilen oder als dreisätziges Konzert in einem Stück aufgefasst werden. Allerdings blieben die Meinungen über eine Verbindung der Sätze zur (heute »double function form« genannten) Mischform geteilt. Schumann sprach sich generell dagegen aus, mit Ausnahme von kürzeren Stücken. »Man müßte auf eine Gattung sinnen, die aus einem größeren Satz in einem mäßigen Tempo bestände, in dem der vorbereitende Teil die Stelle eines ersten Allegros, die Gesangsstelle die des Adagios und ein brillanter Schluß die des Rondos verträten« (GS 1, S. 163). 128
Starkult
Dieser Idee kam Clara Wiecks Konzept nah, selbst wenn sie es nicht stringent umsetzte. Schumann wählte dafür das Bild von »Kähnen«, die »kühn über den Wellen« schwebten. Nur »ein Meistergriff am Steuer, ein straffgezogenes Segel fehlte, daß sie so siegend und schnell als sicher die Wogen durchschnitten« (in: GS 2, S. 280). Diese metaphorische Szenerie übernahm er von Brentano. Der hatte damit in seiner Satire Naturgeschichte des Philisters (1799) die aufbrechende frühromantische Jugend skizziert, die »im Vertrauen auf göttliche Sterne, das planvolle Segel eines leichten Kahns, weltsuchend den treibenden Winden des Himmels übergibt, [...] rasch auf dem Flügel der Begeisterung über den Meeresspiegel« hinfliehend (in: Schultz 2002, S. 78). Auch wenn Schumann Wiecks Konzert nicht wirklich für gelungen hielt, so vermittelte er im literarisch-poetischen Überschuss seiner Ankündigung im Leipziger Tageblatt doch, dass die junge Komponistin - ebenso wie er selber zu dem erlesenen Zirkel dieser »Avantgardisten« zählte. Dass Schumann ab Mitte der 1830er Jahre auch die Komponistin Clara Wieck respektierte, zeigt etwa ihre Aufnahme in den fiktiven »Davidsbund«. In seinen Davidsbündlertänzen op. 6. trat dann die teils frei erfundene, teils an Gestalten seiner Umgebung angelehnte romantische Künstlergemeinschaft musikalisch ins reale Leben. In verteilten Rollen hatte der Autor Schumann sie bislang schon in fiktiven literarischen Szenerien auftreten lassen und den konträren Charakteren geistreiche kunsttheoretische Sentenzen in den Mund gelegt, die seine Rezensionen würzten. Im Carnaval op. 9 von 1837 betiteln die Figuren (neben anderen) unterschiedliche musikalische Tanztypen. Clara Wieck tauchte musikalisch dort mehrfach auf. In der »Valse allemande« (op. 9 Nr. 16) klingt das Hauptthema aus ihren Valses Romantiques op. 4 an, und als »Chiarina« (op. 9 Nr. 11) charakterisierte Schumann sie musikalisch mit Punktierungen und Sprüngen. Dazu verarbeitete er schon das Kopfmotiv aus ihrer Mazurka G-Dur op. 6 Nr. 5. In Schumanns op. 6 kam ihr dann die Ehre zu, unter ihrem eigenen Namen den DavidsbündlerZyklus mit dem Beginn ihrer G-Dur-Mazurka op. 6 Nr. 5 zu eröffnen. Hier zitierte Schumann die ersten beiden schwungvollen Takte originalgetreu und kennzeichnete sie in seiner Partitur wie ein literarisches Zitat mit dem Hinweis »Motto von C. W.« In den Konventionen des Notendrucks war dieses Verfahren ein Novum. Als Motto an den Anfang gestellt, wirkt das Zitat wie ein die Stimmung des Folgenden andeutender Leitspruch, der den Zyklus untergründig durchzieht. Abgesehen vom realen Noten-Zitat wird durch den Titel und die Literarisierung eine den Geheimbund betreffende korrespondierende Beziehung Premier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6
129
zwischen Schumanns Davidsbündlertänzen op. 6 und den Soirées musicales op. 6 von Clara Wieck hergestellt, aus denen die Mazurka-Takte stammen. Dass beide Werke die gleiche Opuszahl 6 tragen, dürfte von Schumann, wenn nicht manipuliert, so doch im Sinne der von ihm selber suggerierten Übereinstimmung höchst willkommen geheißen worden sein. An dieser intertextuellen musikalischen Kommunikation war Clara Wieck indessen nur symbolisch beteiligt. Sie befand sich während der Entstehungszeit auf Tournee, löcherte Schumann zwar mit Fragen, woran er gerade arbeitete, bekam aber nur vage Informationen und erhielt erst im Januar 1838 ein bereits gedrucktes Exemplar der Davidsbündlertänze als Geschenk. Inhaltlich setzte sich Clara Wieck in ihren zwischen 1834 und 1836 komponierten Soirées musicales op. 6 mehr mit dem musikalischen Erlebnis von Chopins und Mendelssohns Musik auseinander als mit Schumanns frühen Werken. Seit ihren spektakulären Aufführungen seiner »Don-Juan«-Variationen op. 2 hatte sie immer wieder die neuesten Werke Chopins in ihr Repertoire einbezogen, als Herausforderung und als gezielte Provokation. Chopins Musik galt in dieser Zeit deutschen Hörern noch so »ultramodern«, dass konservative Kritiker wie Reilstab sie für ungenießbar hielten. Als eine »Handvoll Cayennepfeffer« charakterisierte er in seiner Zeitung Iris im Gebiet der Tonkunst 1833 Chopins Mazurken op. 7. Der Komponist führe in einen »wahren Irrgarten [ . . . ] ohrenzerreißender Dissonanzen, gequälter Ubergänge, schneidender Modulationen, widerwärtiger Verrenkungen der Melodie und des Rhythmus«. Damit bot der Philister eine willkommene Angriffsfläche für den amüsierten Spott der jungen Avantgardisten. Getreulich listete er alles auf, was die Gleichaltrigen rückhaltlos an Chopin bewunderten. Mit zwei Mazurken, Notturno, Ballade und Polonaise übernahm Clara Wieck in ihren Soirées musicales op. 6 Formen, die brandneu durch Chopin geprägt waren und seitdem mit seinem Namen verbunden blieben. Einflüsse von Chopins Harmonik, seiner spezifischen »romantischen Polyphonie«, das heißt einer partiellen Vielstimmigkeit, oder auch Anleihen aus dem Fundus seiner Ornamentik finden sich schon in früheren Stücken Clara Wiecks. An ihrer Ballade op. 6 Nr. 4 lässt sich nachvollziehen, wie die Komponistin das Vorbild Chopins umsetzte, nämlich in freier Übertragung. Chopin komponierte genuine Klavierballaden, und Clara Wieck griff den Faden auf, noch bevor Chopin selber 1836 damit an die Öffentlichkeit trat. Sie hatte dessen Entwurf schon ein Jahr vorher kennen gelernt, als der Kollege einen Zwischenstopp in Leipzig machte. Beide spielten sich wechselseitig ihre neuesten Stücke vor. Dabei lernte Clara Wieck vermutlich nicht nur 130
Starkult
Chopins legendäres »Tempo rubato« kennen, die sublime, dem rhetorischen Sprachgestus nach empfundene, flexible Zeitgestaltung beim Vortrag, sondern auch die noch unveröffentlichte g-Moll-Ballade op. 23. Als Chopin ein Jahr später seine frisch gedruckte Ausgabe in Leipzig präsentierte, war Wiecks d-Moll Ballade op. 6 Nr. 4 auch schon fertig. Diesmal hörte Chopin ihre beiden Mazurken aus op. 6, die vier Pièces caractéristiques op. 5 und das Klavierkonzert op. 7. »Er war entzückt, sprach sich enthusiastisch aus [...], nahm Op. 5 gleich mit« (Jb, 12. September 1836). Ihre Soirées musicales kamen zwei Monate später parallel bei Hofmeister in Leipzig und bei Richault in Paris heraus. Clara Wieck widmete sie der in Leipzig lebenden Pianistin Henriette Voigt. Die lyrisch-narrative Gattung Ballade mit fantastischen, oft unheimlichen Zügen war im volkstümlichen Gesang vieler Länder populär. Im deutschen Liedrepertoire sang man die Balladen Carl Loewes, und die Kunstenthusiasten kannten Schuberts Goethe-Vertonungen, etwa den Erlkönig D 328, dessen Klaviertranskription Liszt ab 1838 verbreitete. Chopin entwarf mit der Klavierballade eine Gattung, in der anspruchsvolle größere Formen komponiert werden konnten, die über das Liedhafte eines Charakterstücks hinausgingen, aber auch keine Sonaten waren. Das alternative narrative Konzept ermöglichte, die kunstvolle musikalische Poesie episch auszubreiten. Clara Wieck übernahm von Chopin vor allem den narrativen Gestus mit seinen rhetorischen Freiheiten, weniger dessen formales Konzept. Während Chopin gleichsam als Barde in seiner Ballade op. 23 mit erwartungsvoll präludierenden Akkorden die Spannung anzieht und dann tänzerisch beschwingt seine Erzählung beginnt, schafft Wieck in ihrem Stück eine andere, verhaltene, von dunklem Ernst geprägte Atmosphäre: Gerader Takt, Andante con moto, piano, d-Moll-Kadenz mit diffusem Septnonakkord. Dann setzt die Melodiestimme mit einem markanten Quintfall ein, traditionell eine Abschlussformel, hier auf schwerer Taktzeit, so dass das Singen stoppt. Aus dem nachschwebenden Intervall schwingt sich hastig ein vehementer Schwall Tone auf und verstummt sogleich wieder. Pause. Ein zweiter Ansatz, Quintfall, Pause. Und ein dritter Ansatz, jetzt milder, versöhnlicher gestimmt, Quartfall, die Stimmung hellt sich auf nach F-Dur, und die Melodie kommt allmählich in Fluss, greift in entferntere Tonräume aus. Die Phrasen verdichten sich, der Satz wird reicher, Stimmungen wechseln rascher, und das Tempo zieht an. Schneller pocht der Rhythmus. Eine in sich kreisende Sextolenfigur bildet dann den schwankenden Grund, auf dem im Mittelteil ein liedhaftes Thema erklingt, aufsteigend, in D-Dur. Doch sinkt auch dessen Emphase allmählich in die triste Ausgangsstimmung zurück, sotto voce, Premier Concert op. 7 und Soirées musicales op. 6
131
gedämpft, wie entmutigt. Abschattiert nach d-MolI, reduziert sich am Ende der gesamte Satz, und die Ballade verklingt in einer leeren Quinte im dreifachen Pianissimo. Wiecks Ballade besticht durch die Freiheit der melodischen Gestaltung. Unregelmäßige Perioden, in denen die Phrasen asymmetrisch mal gestaucht, mal gedehnt sind und eigentümlich dissonant kadenziert werden sowie eine rhythmisch variantenreiche, prosodische Melodie, mit zahlreichen verbalen Vortragsanweisungen, das alles evoziert einen gleichsam ungebundenen Gesang, der die Spontaneität emotionalen Erzählens nachahmt. Daraus bezieht Wiecks Ballade ihre plastische Wirkung. Als explizite Reminiszenz an Chopin kann der ausdrucksstarke Einsatz von harmonischen SpezialefFekten wie phrygischer Sekundvorhalt und neapolitanischer Sextakkord gelten. Ihre Ballade ist dreiteilig. Die hier zugrunde liegende Liedform wird dadurch individualisiert, dass die einzelnen Abschnitte stets neu formulierte thematische Varianten bilden. Ihre organisch wirkende Einbindung erfolgt durch komponierte Ubergänge. Am Ende, in der Coda, wird das Material des Mittelteils aufgegriffen und der gedämpften Stimmung angeglichen. Damit erscheint die Ballade wie aus einem Guss, trotz ihrer variantenreichen Details. Dieser fließende Gestus kennzeichnet alle Stücke der Soirées musicales op. 6. Die beiden Mazurken in g-Moll (op. 6 Nr. 3) und G-Dur (op. 6 Nr. 5) orientieren sich an langsamen und schnellen Varianten dieses Tanzes, den Wieck in der von Chopin als lyrisches Klavierstück weiter entwickelten Form kennen gelernt haben dürfte. Das gilt auch für die Polonaise in a-Moll (op. 6 Nr. 6). Alle drei Stücke spielen mit folkloristischen Elementen, wie Bordunquinten oder gattungstypischen Melodieformeln und zeigen einen bemerkenswert freien Umgang mit den rhythmisch-metrischen Grundkonstanten der entsprechenden Tänze. Auch hier finden sich prosodische Vortragselemente und organisch gestaltete Übergänge zwischen den Kontrastteilen, die der ganzen Sammlung einen einheidichen Charakter verleihen. Dazu trägt die geschlossene tonartliche Disposition bei. Die Rahmenstücke (Toccatina op. 6 Nr. 1 und Polonaise op. 6 Nr. 6) stehen in a-Moll, das Notturno (op. 6 Nr. 2) in F-Dur beziehungsweise d-Moll, die erste Mazurka (op. 6 Nr. 3) in g-, die Ballade (op. 6 Nr. 4) wiederum in d-Moll und die kurze zweite Mazurka (op. 6 Nr. 5) in G-Dur. Darüber hinaus bestehen thematisch-motivische Bezüge zwischen einzelnen Stücken, am auffalligsten zwischen dem Mittelteil der Toccatina und dem Notturno. Der Mittelteil der raschen, spritzigen Toccatina wirkt überraschend expressiv. Wie ein Streichergrund bauen sich die Harmonien auf langen Liegetönen und flächigen Akkordpendeln auf. Darüber schwingt eine gefühlvolle Melo132
Starkult
die, zu deren charakteristischen Wendungen ein zögernd abwärts schreitender Quintgang und ein emphatischer Oktavsprung gehören. Diese Motive übernimmt Wieck im sich anschließenden Notturno, um daraus eine weitere thematische Variante zu formulieren. Sie unterscheidet sich von der ersten durch ihre metrische Verrückung. Die Melodie geht über die Taktschwerpunkte hinweg. Eingetaucht in die Farbe des mittleren Klavierregisters scheint sie nun sanft zu schweben, ein Effekt, der wie kein anderer romantische Ferne und unendliche Sehnsucht evoziert. Diese Musik zeigt eine neue, poetisch-empfindsame Seite der Künsderin. Schumann war begeistert. »Sie erzählen denn viel von Musik, und wie diese die Schwärmerei der Poesie hinter sich lässt«, teilte er in seiner Rezension der Leserschaft der NZflA mit, »und wie man glücklich im Schmerz sein könne und traurig im Glück« (GS 1, S. 251). W i e das Klavierkonzert op. 7 sind die Soirées musicales als Bühnenstücke komponiert. Uber die G-Dur-Mazurka op. 6 Nr. 5 verfasste sie 1836 noch eigene Bravour-Variationen, die nicht erhalten sind. Ob die Künstlerin die Soirées musicales jemals als Zyklus und nicht nur einzelne Sätze daraus aufführte, lässt sich nicht belegen. Clara W i e c k entwarf sie aus freien Stücken, voll von musikalischen Gedanken, Erfahrungen, Erlebnissen und Emotionen, die sicher nicht allein durch Chopins musikalischen Diskurs angeregt worden waren. M i t ihrem Klavierkonzert, den Charakterstücken op. 5 und den Soirées musicales op. 6 im Gepäck stand der jungen Komponistin 1837 der ganze musikalische Kosmos offen - zumindest potentiell.
M i g n o n und Meisterin Pressespiegel » W i e k (oder Wieck), Clara«, erklären wir »für die größte Claviervirtuosin jetziger Zeit«, so belehrte der 1838 verfasste Personenartikel in Schillings Universal-Lexicon der Tonkunst. »Nicht blos dass ihr Spiel ein ungemein fertiges wäre, sondern es ist ein wahrhaft geniales, ein tief durchdachtes, wahrhaft künsderisches Spiel. Es ist nicht blos rund und weich, wie vielleicht das eines Hummel war, nicht blos elegant wie das eines Moscheies, nicht blos glänzend und rauschend wie das eines Kalkbrenner; es ist auch nicht blos sentimental wie das eines Liszt, oder ausgezeichnet durch mancherlei Bizarrerien wie das eines Chopin, sondern es ist alles in Allem, belebt von einer hinreißenden Genialität [ . . . ] . Jeder Ton, den sie anschlägt, ist ein Laut ihrer eigenen Seele. Ihr Spiel ist das innerste Leben in allen seinen Schattirungen und Lichtern
Pressespiegel
133
[...]. Noch haben wir von Niemand Beethovens Ciaviersachen so vollendet vorgetragen hören als von Clara Wiek, und Chopin möchte wohl selbst seine unermesslich schwierigen Etüden und andere Werke nicht mit solcher Meisterschaft spielen können als unsere Künstlerin« (S. 861f). Bei so vielen Superlativen dürfte für die Leser des Lexikons kein Zweifel mehr bestanden haben: Clara Wieck war Spitze! »Meisterschaft« scheint eine ungewöhnliche Zuschreibung fur eine so junge Virtuosin zu sein. Und doch gehört gerade die Meisterschaft zu den allgemeinen, zeitübergreifenden Kategorien, die schon Clara Wieck den Printmedien zufolge beständig und zuverlässig bot. Selbst in den frühen Konzertberichten wurden ihre »große Fertigkeit, Sicherheit und Kraft, mit der sie auch die schwierigsten Sätze leicht und spielend vorträgt, weit mehr aber noch das Geist- und Gefühlvolle ihres Vortrags« thematisiert, wie in der Allgemeinen musikalischen Zeitung 1832 (Sp. 196f). »Unsere junge Meisterin, Klara Wieck, eine Kunstprophetin«, kündigte Schumann im Herbst 1835 an (in: GS 2, S. 355). Clara Wieck, »die Meisterin«, heißt es in einem Korrespondentenbericht aus Dresden 1838, überzeugte durch »meisterliche Leistungen«, die alle Erwartungen des Rezensenten übertrafen (NZJM 1838, S. 201). Als »die erste unter den Clavier-Meistern und Meisterinnen der neuesten Zeit« lobte sie der Rezensent des Freischütz 1840, »weil sie zu der im hohen Grade vervollkommneten Technik [...] das geistige Übergewicht in Auffassung und im Schaffen fügt« (22. April). »Meisterschaft und Anmuth, wie man sie an ihr zwar gewohnt ist, mit der sie uns aber jedesmal nicht weniger von Neuem erfreut«, hob die Allgemeine musikalische Zeitung 1845 hervor (S. 46). Als »vollendete Meisterin«, »wie nicht anders vorauszusetzen«, titulierte schließlich Rellstab die Künstlerin 1855 in der Vossischen Zeitung (6. November). Clara Schumann besäße mehr als jeder andere Pianist »le génie des grands maîtres«, bestätigte ein französischer Kritiker 1862 (in: de Vries 1996, S. 211). In diesen Kontext gehört auch das seit 1837 immer wieder in den Rezensionen auftauchenden Urteil, »daß wir sie unter allen Spielerinnen, die wir gehört, trotz einzelner Vorzüge die andere haben mögen, doch an die Spitze stellen mögen«, so Reilstab in der Vossischen Zeitung vom 27. Februar 1837. Clara Wieck wäre »die erstejetzt lebende Pianistin«. {NZfM 1838, S. 201, Hervorhebung im Original), »die Ciavierspielerin [...] in der Bedeutung, wie die Römer ihr Rom - die Stadt nannten«, erläuterte der Freischütz 1840 (15. Februar). Die »weibliche Summität der gegenwärtigen musikalischen Welt«, schwärmte die St. Petersburger Zeitung 1844 (in: Kat., S. 57). Dass sie den »höchsten Standpunct« im Klavierspiel vertrete, verbreitete Franz Brendel in seiner Musikgeschichte 1852 (S. 526). Als »die vorzüglichste der Pianis-
134
Starkult
tinnen der neueren Zeit«, kennzeichnete noch der Personenartikel in Hugo Riemanns Musik-Lexikon von 1882 Clara Schumann. In den späteren Lebensjahren war damit auch die Anerkennung einer zeitlos beispielhaften musikalischen Autorität verknüpft. »Seit sechzig Jahren als Pianistin gefeiert [...], zeigte sich Frau Schumann in dem Vortrag von Chopins F-moll-Konzert als Künstlerin, der die Zeit nichts angetan hat: von markiger Kraft im Ton, unfehlbarer Technik, klarstem Kunstverstande, warmer, aber niemals die Grenzen der Form verletzender Empfindung und feinster, sinniger Nuancen. Was sie an diesem Abend zu leisten vermochte, wird für alle Zeiten in der Erinnerung leben als Beispiel, wie geistige Kraft über den Körper nicht nur, sondern auch über Schicksalsschläge zu siegen vermag«, so die Vossische Zeitung über die Siebzigjährige (24. Januar 1889). »Die Finger tun's noch ordentlich, sogar mit Leichtigkeit, aber die Nerven wollen nicht«, schrieb Clara Schumann nüchtern an Brahms, nachdem sie am 8. November 1890 Chopins zweites Klavierkonzert f-Moll op. 21 in Frankfurt gespielt hatte (Schumann-Brahms 2, S. 426). Schillings Artikel über die achtzehnjährige Künstlerin im Universal-Lexicon der Tonkunst von 1838 enthält bereits Zuschreibungen, die Konstanten des öffentlichen Images bildeten, das durch Printmedien verbreitet wurde. Dazu zählten Attribute ihres Spiels als »genial« und »seelenvoll«, aber auch als »geistreich« und »durchdacht« sowie ihre Fähigkeit, unterschiedliche Stile nicht nur perfekt zu beherrschen, sondern mitunter sogar besser zu präsentieren als die Komponierenden selbst. Werktreue beinhaltete hier, Stücke im angemessenen Stil, »ganz im Geiste des Componisten« auszufuhren. »Wir haben« die Fantasie op. 31 »von Thalberg selbst gehört, müssen aber gestehen, in dem Vortrage Clara Wiecks mehr Feuer und Leben, und so diese Fantasie auch weit ansprechender gefunden zu haben« (Freischütz, 14. März 1840). Wichtig waren Hinweise auf die Chopin- und Beethoven-Expertin, als die sie schon seit den 1830er Jahren galt. Ernsthaft und ganz der Sache hingegeben zu sein, gehörte gleichfalls dazu. Konstant blieb im Laufe der Jahrzehnte allerdings auch die Diskussion über ihre raschen Tempi, die Begeisterung und Ablehnung hervorriefen. Zu den Variablen zählen vor allem die sich wandelnden Identifikationsmuster, die die Künstlerin im Laufe ihrer Karriere bot. Hier spielte das Lebensalter ebenso eine Rolle, wie die unterschiedlichen gesellschafdichen und künstlerischen Ideale, die man in ihr im Laufe des Jahrhunderts verkörpert sah. Während Clara Wieck in den frühen Jahren mit ihrem provozierenden Elan vor allem für den Fortschritt des Jungen Deutschlands< stand, multiplizierte die Presse nach der Heirat den Imagewandel hin zu einer gediegenen, Pressespiegel
135
innigen Musikerin, deren himmelsstürmendes Temperament nun durch bürgerliche Tugenden geerdet war. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verband sich mit Clara Schumann die Etablierung von Musik als autonomer Kunst, und im Zuge der Reichsgründung galt sie als Garantin einer nationalen Tradition musikalischer Klassik und Romantik. Die einstige Verfechterin der »Avantgarde« bot nun einen verlässlichen Kanon gediegener Meisterwerke. Beklagten manche Rezensenten bis in die 1850er Jahre hinein, dass ihre Programme zu neu und zu anspruchsvoll seien, so vermisste man in den 1870er Jahren gelegentlich die Abwechslung im durchweg »klassischen« Repertoire. Insgesamt zeigen die eingesehenen zeitgenössischen Artikel, dass ihre außergewöhnliche künstlerische Qualität über den gesamten Zeitraum hinweg herausgestrichen wurde, unabhängig davon, wie man die Person, ihre Interpretation oder das Repertoire beurteilte. Dabei wurden unterschiedliche Bilder herangezogen, in den frühen Jahren das einer »Kunstprophetin«, in den späteren stärker das einer souveränen Herrscherin, während die Beiträge der letzten 20 Lebensjahre hauptsächlich der unangefochtenen Autorität und dem lebenden Denkmal huldigten. Die ganze Zeit über zementierten die Printmedien konstant das Bild einer persönlich bescheidenen, in der Kunst aber unbedingt und kompromisslos das Höchste fordernden Musikerpersönlichkeit. Den Fundus des Pressespiegels bilden biografische Beiträge für Lexika, Artikel in zeitgenössischen Fachzeitschriften und in der allgemeinen Tagespresse sowie Würdigungen und Ehrungen, Gedichte und Jubiläumsartikel, die zu Lebzeiten über Clara Schumann publiziert worden sind. Das gesamte, in einem Zeitraum von mehr als 60 Jahren erschienene Material wurde bislang nicht systematisch erschlossen. Auch meine Zusammenfassungen beruhen auf Auswertungen von verschiedenen Stichproben, die zu unterschiedlichen Fragen gezogen wurden, wie Auftritte in ausgewählten Städten (Leipzig, Berlin, Hamburg, Wien, Paris, London), zu bestimmten Zeiten (den Tourneeplänen entsprechend), Rezensionen der Kompositionen, Berichte zu besonderen Stationen des Karrierewegs oder über Ehrungen wie die Titelverleihung 1838 oder die Bühnenjubiläen 1878 und 1888. In den eingesehenen Beiträgen fällt ein deutliches Ubergewicht positiver bis begeisterter Rückmeldungen auf. Urteile wie das folgende aus der Allgemeinen Deutschen Musikzeitung von 1883 waren in dem gesichteten Beispielen eher rar: »Frau Schumanns Zeit ist vorbei, die Jahre machen ihre Ansprüche geltend und um der Erinnerung an ihre ruhmreiche Vergangenheit willen sollte die verehrte Künstlerin nicht mehr öffentlich spielen« (in: de 136
Starkult
Vries 1996, S. 210). Wenn Kritik laut wird, so hauptsächlich an drei Punkten, nämlich erstens am zu anspruchsvollen Repertoire (vor allem in den frühen und mittleren Jahren), zweitens am Tempo (besonders stark in den 1840er60er Jahren) und damit zusammenhängend drittens an der unterkühlt wirkenden Performanz. Manche äußerten ihre Kritik nur in privaten Zirkeln wie Hans von Bülow. Auch könnte sich die Aura der Künstlerin mit der Zeit so verselbständigt haben, dass man alles, was sie machte, großartig fand, wie George Bernard Shaw es am Beispiel des 60jährigen Joseph Joachim beschreibt: »Joachim jagte wie toll durch die Partitur [...] Es war entsetzlich abscheulich!« Trotzdem klatschten alle »wie besessen«: »Joachims glanzvolle Karriere und Bachs strahlender Ruhm hatten uns derartig hypnotisiert« (in: Borchard 2006, S. 519). Doch könnte ebenso zutreffen, dass die Rezensionen eine bis ins hohe Alter anhaltende Perfektion der Virtuosin wiedergeben. Von heute aus lässt sich das nicht mehr entscheiden. Schließlich belegt die Dauer, in der sich Clara Wieck Schumann erfolgreich auf der Bühne behaupten konnte, dass sie ihrem Publikum offensichtlich immer wieder etwas Besonderes geboten haben muss. Die Spiegelung der Künstlerin in der Presse zeigt ihr Image aus einer öffentlichen Perspektive, die Clara Schumann nur partiell steuern konnte, indem sie ausgewählte Informationen über sich ausstreute oder Redakteure auch schmierte, was zumindest fur Paris belegt ist. Dort kostete es 1839 fünfzig Francs, um Künsdernachrichten im Constitutionel, dem Journal du commerce, politique et littéraire zu lancieren. Liszt und Thalberg hätten auch bezahlt, da »es hier Gebrauch ist«, verteidigte sich Clara Wieck (Bw, S. 758). Der Einfluss der Presse auf die Wahrnehmung der Künsderin in der Öffentlichkeit gilt als unbestritten, doch scheint es schwer, die Effizienz ihrer Meinungsbildung im Publikum nachzuweisen (Rössler 2005, S. 61; Staiger in: Star, S. 48ff). Inwieweit die Rezensionen auf Clara Schumann selbst zurückwirkten, lässt sich nur sporadisch belegen. Jedenfalls las schon das Mädchen Zeitung und bat die Stiefmutter im November 1837, Schumanns Neue Zeitschrift für Musik »immer recht sorgfältig« aufzuheben (in: Wieck Briefe, S. 74). Gleichzeitig wusste sie viele Nachrichten offenbar doch nur vom Hörensagen. An Beckers Rezension ihres Klavierkonzerts op. 7 ärgerte sie dessen Kritik an den »vielen Decimenaccorde[n]«, wie sie Schumann schrieb (Bw, S. 57). Tatsächlich hatte Becker aber die Häufung der »Septimenakkorde« beanstandet. Manchmal reagierte sie sogar direkt. So antwortete die Dreiundsechzigjährige 1882 auf einen biografischen Beitrag der Autorin La Mara in der Gartenlaube-. »Geehrtes Fräulein, erlauben Sie mir, Sie auf einige Unrichtigkeiten aufmerksam zu machen« und korrigierte dann unter anderem die ihrer Meinung nach verzerrte Pressespiegel
137
Darstellung der väterlichen Erziehung. Clara Schumann wollte sie positiv bewertet haben (in: Litzmann 3, S. 433ff). Der Pressespiegel bietet ein Gegengewicht zu ihren Selbstdarstellungen. Bei der Einschätzung der Artikel spielt eine Rolle, welche fortschrittlichen oder konservativen Positionen die damaligen Autoren beziehungsweise die Publikationsorgane verfochten. Schließlich reagierten manche Beiträge in direkter Konkurrenz aufeinander. Schumann etwa, der seit 1834 für sich und seinen Freundeskreis die Vertretung des Fortschritts beanspruchte, polemisierte vor allem in den 1830er Jahren in seiner Neuen Zeitschrift für Musik heftig gegen den Konservatismus der Allgemeinen musikalische Zeitung und besonders gegen deren Redakteur Gottfried Wilhelm Fink. Auch Rellstab, der Chopins und Schumanns Frühwerk unverdrossen attackierte, wurde von Schumann als Ewig-Gestriger angezählt. Wenn die Künstlerin trotzdem in den untereinander rivalisierenden Zeitungen gut besprochen wurde, so steigerte das ihr Renommee erheblich. Im Vormärz verfassten viele Autoren Beiträge für Fach- wie Tageszeitungen und verwerteten ihre Artikel doppelt, wie Rellstab, der für seine eigene Musikzeitschrift Iris im Gebiet der Tonkunst und die täglich in Berlin erscheinende Vossische Zeitung schrieb, oder Robert Schumann, der außer in seiner Neuen Zeitschriftfür Musik unter anderem im Leipziger Tageblatt und im Komet publizierte. Unter den Kritikern der 1830er Jahre verfügte Rellstab als streitbarer Hüter der Tradition über einen herausragenden, wenn auch nicht unumstrittenen Ruf. Seine Rezensionen über Clara Schumanns Konzerte und über ihre Kompositionen erregten Aufmerksamkeit, unabhängig davon, wo sie veröffentlich wurden. Überdies trugen auch Tadel und Verrisse der »Philister« durchaus dazu bei, die Prominenz der Künstlerin zu steigern. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahm dann Eduard Hanslick als mächtiger Musikjournalist, Kritiker und Meinungsmacher eine allen Anfechtungen standhaltende Führungsrolle. Uber viele Jahre rezensierte er Clara Schumanns Wiener Auftritt ausgiebig und mit kritischer Sympathie. Inzwischen polarisierten die so genannten »Wagnerianer« und »Brahminen« die öffentliche musikpolitische Meinung. Hanslick galt als Exponent des konservativen Lagers. Aus den Presseberichten geht indessen hervor, dass die Künstlerin Rezensenten beider Lager beeindruckte, neben Hanslick etwa auch einen ausgesprochenen »Lisztianer« wie Leopold Alexander Zellner, der für die Wiener Theaterzeitung schrieb. Schon Rellstab differenzierte zwischen den meist positiv bis überschwenglich gelobten pianistischen Leistungen der Künstlerin, ihrer Seriosität als Interpretin, ihren Komposition und ihrem Repertoire. Er schätzte 138
Starkult
die Kunst der Virtuosin seit 1831 sehr hoch ein, stand ihren eigenen Kompositionen skeptisch gegenüber und missbilligte ihre Vorliebe für Chopin und Schumann. Dagegen unterstützte er Ende der 1850er und Anfang der 60er Jahre ihre Brahms-Aufführungen ausdrücklich (Schlemmer, in: Kat., S. 74ff). Für die Urteile der in Leipzig erscheinenden Allgemeinen musikalischen Zeitung kamen noch andere Gesichtspunkte hinzu. Die Redaktion begleitete nämlich die Karriere der Künstlerin von 1828 an mit einem gewissen Lokalstolz und versorgte deshalb ihre Leserschaft kontinuierlich mit freundlichen Nachrichten über sie, jenseits der Parteigrenzen. Ein noch höheres Ansehen als Zeitungsartikel hatten Lexikonbeiträge und Zitate in musikhistorischen Büchern, wie in Franz Brendels Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich von 1852. Dafür waren Zeitungen viel weiter verbreitet und erreichten ein größeres Publikum. Wenn besonderer Wert darauf gelegt wurde, auch in den »politischen« Zeitungen erwähnt zu werden, dann deshalb, weil nur sie einen allgemeinen, nicht nur auf Musik spezialisierten Leserkreis erreichten und zum sozialen Prestige am meisten beitrugen. In der überregionalen Presse galt die Allgemeine Preußische Staatszeitung als konservativ, während die Augsburger Allgemeine fortschrittliche Positionen vertrat. Beide Zeitungen gehörten zu den angesehensten ihrer Zeit (Zorn 1976, S. 383). Sie wurden auch vom diplomatischen Corps und im Ausland gelesen. So war der am 27. Februar 1837 in der Allgemeinen Preußischen Staatszeitung veröffentlichte Beitrag über Clara Wieck allein deswegen eine Sensation, weil er die ganze Kulturspalte des Tages füllte. Ein »seltener Fall«, notierte sich die Künstlerin zufrieden (Jb, 27. Februar 1837). Aufgrund der öffentlichen Bedeutung druckte die Neue Zeitschrift für Musik den Artikel komplett nach (1837, S. 73f). »Kannst Du es nicht möglich machen, daß es auch in die preußische Staatszeitung kommt?« fragte Clara Wieck im Sommer 1840, als sie Schumann die Nachricht über ihren gelungenen Auftritt am Weimarer Hof in Anwesenheit der russischen Kaiserin schickte (Bw, S. 1073). Auch die Augsburger Allgemeine wurde unterrichtet. Schon damals popularisierten besonders der Klatsch und die emotionalen Histörchen in der Tagespresse die Künstlerin. Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Wirkung der schwärmerischen Widmungspoesie. »Clara«-Gedichte waren Lobeshymnen, deren Bedeutung sich nicht im Inhalt erschöpfte, sondern auf der überhöhten literarischen Präsentationsform in Versen beruhte. Daneben spielte bei der öffentlichen Bewertung der Virtuosin auch die Prominenz der Autoren eine wichtige Rolle (Rössler 2005, S. 24ff). Ein gefeierter Dichter wie Grillparzer beeinflusste die öffentliche Meinung. Sein Pressespiegel
139
Wort galt viel. Grillparzer schrieb keine Tageskritik. Der Dichter war mit Beethoven befreundet gewesen, hatte 1823 für ihn ein Melusinen-Libretto entworfen und einen Nachruf auf Beethoven in Verse gefasst, außerdem Schubert und Paganini besungen. Allein dass er zur Feder griff, war bereits das Ereignis. Seine öffentliche Reminiszenz »Clara Wieck und Beethoven« vom 9. Januar 1838 erhöhte das Image der jungen Virtuosin enorm. Grillparzer übernahm das Gelegenheitsgedicht sogar in seine Werkausgabe. Auch Robert Schumanns Artikel hatten Gewicht. Die Förderung junger hoffnungsvoller Talente war eine der tragenden Säulen der 1834 gegründeten Neuen Zeitschrift für Musik, daher setzte er sich gezielt und produktiv mit noch unbekannten Komponierenden auseinander. Obwohl Clara Wieck zu dem Personenkreis seines näheren Umfelds gehörte und er Kompositionen mit ihr austauschte, war sie keineswegs die einzige junge Künstlerin, deren Werke und Wirken er verfolgte. Ebenso widmete er Leopoldine Blahetka, Julie Cavalcabö, Louise Farrenc, Delphine Hill-Handley oder Antoinette Pesadori seine Aufmerksamkeit. Bis 1836 stand ohnehin nicht eindeutig fest, welche Rolle Clara Wieck tatsächlich in seinem Leben spielen sollte. Schumann war grundsätzlich parteiisch, wenn es darum ging, junge Talente zu ermutigen, und er machte aus der Bewunderung für die Tochter seines Lehrers kein Geheimnis. Clara Wiecks Karriere interessierte ihn schon von 1830 an. Als sich dann Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft abzuzeichnen begannen, zog Schumann sich als Rezensent Clara Wiecks allerdings weitgehend in den Hintergrund zurück. Schumanns Texte nehmen eine Sonderstellung ein. Sein mit verschwenderischer Metaphorik garnierter Rezensionsstil bot für viele Fachkollegen eine neue Orientierung. Durch den Entwurf fiktiver Szenen, in denen verschiedene »Davidsbündler« miteinander kommunizierten, schuf er die Möglichkeit, unterschiedliche Standpunkte über die zu besprechende Musik einzubringen, um so einen möglichst plastischen Eindruck widerzugeben. Seine literarisch anspruchsvollen Artikel versprachen eine unterhaltsame Lektüre. Schumann lieferte ab 1832 verschiedene Beiträge über Wieck und rezensierte ihre Caprices op. 2, die Valses romantiques op. 4 und die Soirées musicales op. 6 (Klassen 1990, S. 27ff). Der literarische Habitus und die für die Künstlerin verwendeten Bilder wechselten. Generell orientierte sich die Presse stilistisch an der religionsadäquaten Inszenierung von Kunst im 19. Jahrhundert. So wurden im schwärmerischen, von Superlativen durchsetzten »mythischen Style« ( N Z f M 1839, S. 174) der 1830er Jahre zur Skizzierung Clara Wiecks etwa okkultische Bilder beschworen, in denen die Virtuosin als passives Medium fungierte. 140
Starkult
Außerdem wählten die Autoren antike mythologische oder christlich geprägte Vergleiche für die kultischen Handlungen der Kunstpriesterin, erhöhten sie zur »heiligen Cäcilia« (Jb, 10. Dezember 1837) und gliederten Clara Wieck als Engel in die Himmelschöre ein. Gleichzeitig prägten immer wieder handwerkliche und autonomieästhetische sowie politische Metaphern (Meisterin, Königin) die Rezensionen und betonten die aktiv handelnde Position der Künstlerin. In den Gründerjahren schrieb man dagegen in einem sachlicheren Stil und verzichtete meist auf illustre Vergleiche. Das entsprach der neuen, technisch geprägten Zeit und war dem inzwischen würdigen Alter der Künstlerin angemessen. Im Vormärz prägten Bilder aus der Griechen- und Ägyptenmode den Stil, die vor allem Schiller und Novalis literarisch popularisiert hatten: »Klara zog frühzeitig den Isisschleier ab; das Kind sieht ruhig in das Strahlenmeer, der ältere Mensch würde am Glanz erblinden«, so Schumann 1832. Johann Peter Lyser betonte in der Cäcilia 1833 das Fremdartige »dieses seltsamen Wesens«. »Es ist, als wisse das Kind eine lange aus Lust und Schmerz gewobene Geschichte zu erzählen, und dennoch - was weiß sie? - Musik« (S. 255ff). Dem gleichen stofflichen Kontext verhaftetet war auch Schumanns Bild von Clara als »Kunstprophetin«, die die »höhere, die überirdische« Sprache der Musik beherrsche, eine Sprache, »die des eiferndsten Studiums spottet, und die dem Menschen angeboren sein muß«. Er beschleunigte dann die pseudomythologische literarische Szene rasant und wechselte zur »Kühnheit« der Künstlerin, »die sich bis zum heiligen Wahnsinn steigert, in welchem sie die Locken löst, die Augen rollt, göttlich bebt und stammelt und die Grammatik des vulgären guten Tons zerreißt, so daß ihr, wie einer weißsagenden Sibylle, die vom Sturm getriebenen Blätter um das Haupt herumfliegen. Aber jedes der zerrissenen Blätter enthält einen Orakelspruch« (GS 1, S. 109; GS 2, S. 287ff. und 350ff). Der zitierte Beitrag, eine Werbung für die Uraufführung von Wiecks Klavierkonzerts op. 7, ist als romantischer »Schwärmbrief« geschrieben. Diese Form suggerierte der Leserschaft, an einem intimen Dialog teilzuhaben. Das Darstellungsmittel sollte die Aufmerksamkeit und das emotionale Engagement der Rezipienten erhöhen. Hier lässt sich beispielhaft Schumanns fantastisch-literarisches Konzept ablesen. Der Brief, adressiert an »Chiara«, eine fiktive, in Italien weilende Musikerin, die geradewegs aus Jean Pauls Roman Titan entsprungen zu sein scheint, beginnt mit einer Schilderung des Konzerts von »Zilia«. Beide Namen spiegeln in Schumanns Davidsbündlertexten zwei an Clara Wieck orientierte Kunstfiguren. In diesem konkreten Fall war die literarische »Zilia« tatsächlich im Leipziger Gewandhaus aufgetreten, und
Pressespiegel
141
die Beschreibung paraphrasiert die real gehörte Musik. Clara Wieck durfte sich darüber hinaus auch durch die italienische Anrede »Chiara« persönlich angesprochen gefühlt haben - sofern sie den Text in der Zeitschrift gelesen hat. Schumann versprühte in seinem hymnischen Uberschlag ein rhetorisches Feuerwerk poetischer Bildung, das weit über den Anlass, nämlich die Vorankündigung des Konzerts, hinausschoss. Vielmehr bietet der Brief eine programmatische Selbstinszenierung des Autors. Wenn sich tatsächlich ganz prosaisch - die Frisur in der Öffentlichkeit löste, so war es Clara Wieck eher peinlich. »Als sich meine Locke ein wenig lang heruntergeneigt hatte und ich sie wieder fest machen wollte sagte sie [Bettina von Arnim] >Es ist doch merkwürdig, so ein Mädchen schämt sich nicht vor einem ganzen Publikum zu spielen und schämt sich daß die Locke ein wenig lang herunterhängt«« (Jb, 14. Februar 1837). Neben den Bildern, die die Künstlerin als eine Art mythisches Medium aufbauen, finden sich immer wieder Beschreibungen der tatkräftigen, aktiv handelnden Virtuosin, die als »Jungfrau von Orleans auf dem Pianoforte« siegte, wie Clara Wieck als Feedback im Tagebuch festhielt (10. Februar 1834). Auch Schumanns Rede von der »Perlentaucherin« gehört hierher. »Die Perle schwimmt nicht auf der Fläche; sie muß in der Tiefe gesucht werden, selbst mit Gefahr. Klara ist eine Taucherin«, schrieb er 1834 in freier Anknüpfung an Schiller. Die gefeierten »Amazonen«, nämlich Clara Wieck und Delphine Hill-Handley, sollten allerdings anstelle von Lanzen lieber mit »Lilienstengeln« (GS 1, S. 21 und 55) fechten, so Schumann, während der Rezensent des Freischütz geradezu sportiv die temperamentvolle »PianoStürmerin« beklatschte (4. April 1835). Subtile erotische Komponenten färbten mehrere Texte, nicht nur Grillparzers Gedicht. Grillparzer wählte 1838 für seine Eindrücke den Topos vom graziösen »Schäferkind«, das »sinnvoll-gedankenlos, wie Mädchen sind«, den Schlüssel zur Schatztruhe »Beethoven« fand. Seine musikalischen Geister dienten nun »der anmutreichen, unschuldsvollen Herrin, die sie mit weißen Fingern, spielend lenkt« (1, S. 79). Schumann und Mendelssohn fanden vor allem die Stelle mit den »weißen Fingern« toll (Bw, S. 92). Diesen Faden spann ein Autor im Grenzboten 1844 weiter. Schumanns »herrliche Frau, die wir Süddeutschen noch immer Clara Wieck nennen«, hätte den Schlüssel zu den »Wunderschätzen des Zauberers Beethoven« nicht verloren. Vielmehr versicherte der Rezensent, dass der »Geist Beethovens« hinter ihr gestanden hätte, während sie spielte. Er »schlug lächelnd den Takt«. Als »sie aufstand, küßte er ihr die Stirne und dann die schönen marmornen Hände« (Grenzboten 25,1844, S. 566). Dem »alten Ludwig« müsste »darob das Herz in seinem 142
Starkult
himmlischen Leibe gelacht haben«, als er »durch die jungfräulichen Hände der silberfingerigen Künstlerin« seine Musik hörte, mutmaßte ein Rezensent der NZfM schon 1839 (S. 174). Himmlische Sphären wurden vor allem in den Widmungsgedichten angerufen. Auf der Titelseite des Freischütz erschien am 28. März 1835 ein Huldigungsgedicht, das beschreibt, wie durch »Claras Harmonieentöne« die Hörer »hin zu sel'gen Fluren / Der Himmelstöchter, Göttersöhne« gezogen würden. In einem im Dresdner Anzeiger 1836 veröffentlichten Akrostichon, einem Gedicht, dessen Versanfänge den Namen »Clara« bilden, wurde behauptet, sie hätte die Himmelschöre überflügelt (in: Jb, 3. Februar 1836). Gleich an die Spitze, »auf der obersten Sprosse« einer künstlerischen »Himmelsleiter«, »thronte im vollsten Strahlenglanze der Künstlergloriole [...] Clara, die, ebenso glänzend als berühmt, den Namen in der That führt«, so eine Konzertrezension in den Signalen für die musikalische Welt von 1846 (S. 377f). Auch Schumann beschwor in seiner pseudonym mit »A. L.« gezeichneten Werbelyrik Traumbild am 9ten Abends. An C. W., eine engelhafte Peri (eine aus der persischen Mythologie stammende sanftmütige >Schwester< germanischer Walküren), die vom Himmel in den Konzertsaal schwebte (NZfM 1838, S. 95). Ob Peter Cornelius' Gedicht »Scheidegruß an Frau Clara Schumann, geb. Wieck« aus Weimar von 1854 der zeitgenössischen Öffentlichkeit zugänglich war, muss offen bleiben. Es wurde 1904 in seinen Literarischen Werken gedruckt und enthält die damals gewagte Verbindung von Liszt, Joseph Joachim und Clara Schumann. Offenbar entstand es im Umfeld von Liszts Schumann-Artikeln, die Cornelius für die Neue Zeitschrift für Musik vom Französischen ins Deutsche übersetzte. »Ich stelle die Wieck ohne Bedenken als die Erscheinung hin, welche [...] alles in allem genommen - mir als die Bedeutsamste vorkommt [...]. Die Schumann ist mir ein Ideal dessen, was das Weib in der Öffentlichkeit tun, in Hingebung an das Publikum leisten kann, ohne von der peinlichst gewissenhaften weiblichen Haltung auch nur ein Jota aufzugeben«, kommentierte Cornelius im Rückblick (in: Seibold 2005,2, S. 179f). Schon 1838 wurde das Bild von Clara Wieck als »Priesterin« der neuen Kunst verbreitet, die zur »romantisch-musikalische[n] Wallfahrt« aufrief. Sie richtete sich gegen die »Epidemie der Klassicität, [...] die Reifrock-Episode der Musik«, nämlich »Bachs steife Fugen«, so Becker in seinem Artikel für Herloßsohns Damen-Conversationslexicon (S. 430). Diese Sichtweise erstaunt nicht bloß, weil Becker Organist in Leipzig war, sondern auch, weil es zu den Höhepunkten von Clara Wiecks Konzerten gehörte, Bach-Stücke wie Pressespiegel
143
zeitgenössische romantische Klaviermusik einzubeziehen. Franz Liszt popularisierte 1854 das Bild noch einmal und skizzierte Clara Schumann jetzt als »weihevolle, pflichtgetreue und strenge Priesterin«, die »am Altar der Kunst« ihren Kultus zelebrierte. Allerdings setzte er an die Stelle einer vestalischen Jungfrau mit »feuchte[m] Jugendglanz der Augen« nun eine eher medusenhaft »starrende, angstdurchschauerte« Figur mit fast somnambulen Zügen, deren Fingern »ein mysteriöses Licht« entströmte. Für die »gesteigerte Empfindsamkeit« dieser »leidenden sanften Sibylle« wäre »der unrichtige Ton eine Katastrophe, die verfehlte Passage eine verwelkte Neigung, vergriffenes Tempo eine verkannte Liebe, falsch aufgefasster Rhythmus eine geschmähte Großtat«. Diese »Peri, die sich nach ihrem Paradiese sehnt«, schien bereits der Erde entrückt zu sein (in: Ramann 1880f., 4, S. 203). Als der Aufsatz im Dezember 1854 erschien, lebte Robert Schumann indessen noch, seine Frau hatte im Juni das jüngste Kind, Felix, geboren, gerade eine Deutschlandtournee begonnen, plante ihre erste Englandreise und hoffte nach wie vor inständig auf eine baldige Genesung ihres Mannes. Darauf, dass Liszt den pathetischen Aufriss, der heute fast wie eine Karikatur wirkt, tatsächlich ernst und keineswegs als ironischen Abgesang auf seine Konkurrentin gemeint hat, lässt seine Verwunderung über Clara Schumanns Reaktion schließen. Ihn irritierte nachdrücklich, dass die Künstlerin über seine mehr als achtzig Seiten umfassende Clara und Robert Schumann-Serie in der NZfM von 1854 und 1855, aus der das Zitat stammt, wordos hinweg ging, »sans me dire un seul mot«, wie er konsterniert an Carolyne von Sayn-Wittgenstein schrieb (30. Mai 1855, in: Seibold 2005,2, S. 272). Prosaischer, dafür lebensnäher und deutlicher mit einem Schuss Ironie gewürzt hatte Johann Christian Lobe 1846 Clara Schumanns wachsenden künstlerischen Purismus skizziert: Könnte man ihr »die geringste Geschmacklosigkeit unter die Finger schmuggeln, der Schlag würde sie rühren, oder sie fiel wenigstens in Ohnmacht. Das nennt man ein edles Künstlerwesen« (AmZ 1846, Sp. 722). Mit der Person (und nicht nur der Künstlerin) befassten sich explizit indessen nur wenige Autoren. »Der holden Künstlerin Persönlichkeit - ihr ganzes Wesen, das ganz Musik - ihre Compositionen - ihre außerordentliche Gefälligkeit, mit der sie privatim jedem ächten Liebhaber oder angehenden Talenten vorspielt - soll ich Ihnen das alles noch vorrühmen?« fragte der Korrespondent der NZfM 1838 (S. 201). Auch in der Musical Times von 1884 wurden noch einmal ihre »modesty« und »prudence« herausgestrichen (in: Kat., S. 318). Kluges, umsichtiges Handeln dürfte aus der Art ihrer Programmgestaltung und Konzertorganisation abgeleitet sein, die Bescheidenheit galt in der Öffentlichkeit als ein Persönlichkeitsmerkmal, dass sowohl 144
Starkult
aus dem moderaten Bühnengehabe als auch aus ihrem »natürlichen«, das heißt nicht exzentrischen Verhalten abseits vom Podium geschlossen wurde. »Sie ist eine Königin des Klavierspiels, eine absolute Herrscherin, die vielleicht mehr nach Strenge des Gesetzes als nach Regung ihres Herzens regiert, dafür aber auch mit der schärfsten und feinsten Abwägung, oft mit wahrhaft erhabenen Regententugenden; und wenn die Sonnenstrahlen der Milde ihr Diadem seltner vergolden, so geschieht es dafür mit desto schönerer Wirkung«, so Rellstabs Gloriole in der Vossischen Zeitung (12. Dezember 1854). Anders als Clara Wieck in den 1830er Jahren verkörperte Clara Schumann nicht in erster Linie eine Königin des Herzens, sondern eine »Autorität, welcher gegenüber die Allgemeinheit sich des Urtheils zu begeben pflegt«, konstatierte Leopold Alexander Zellner 1866 in den Blättern fiir Musik, Theater und Bildende Kunst. Danach trug die Beethovenspielerin »Felsblöcke herbei und baute daraus einen Tempel von Karnak«, dem mythischen Amon-Heiligtum von gigantischen Ausmaßen (in: Kat, S. 123ff). Dass diese Königin ihr Instrument wahrhaft »despotisch regirte«, berichtete schon der Rezensent des Freischütz enthusiastisch. Statt von einer Künstlerin wollte er lieber von »eine[m] Virtuosen« schreiben, »so ausgeprägt, so männlich ernst, so gewaltig« herrschte sie (15. April 1837). Selbst von Bülow nötigte 1877 die »noch unentthronte Königin, Frau Dr. Clara Schumann,« Respekt dafür ab, dass sie »Beethovens G-dur-Concert Op. 58 wirklich zu künstlerischer Reproduction« brächte (in: Steegmann 2001, S. 151). »Ueber Clara Schumann sind die kritischen Acten geschlossen. Wer und was sie ist, weiß alle Welt«, so Zellner, der 1860 die Verlegenheit zugab, über das Spiel der Künstlerin nichts neues beitragen zu können, »da wir es ja mit einer fertigen, abgeschlossenen Künstlererscheinung zu tun haben« (in: Kat., S. 122f). Bereits 1838 hielt es die Allgemeine musikalische Zeitung für überflüssig, noch weitere Erklärungen über die Qualität ihres Klavierspiels abzugeben (Sp. 164). Ein Grund war die allgemeine Einschätzung, dass das »Clavierspiel im Technischen keiner weiteren Vervollkommnung mehr fähig« wäre, wie Heinrich Adami 1846 behauptete (in: Kat., S. 117). Allerdings bedurfte es besonderer Kompetenzen, wollte man die klavieristischen Aspekte diskutieren. Darüber hinaus aber erlagen manche Rezensenten einfach der Faszination der Virtuosin. »Um den Standpunct zu gewinnen, von welchem man Clara Wiecks Pianofortespiel würdigen kann, gehört ein fester Harnisch gegen jeden Enthusiasmus«, hatte ein Korrespondent aus Prag empfunden ( N Z f M 1838, S. 6). Das bestätigte auch noch ein Wiener Kritiker 1860: »Kenner und Laien jubeln der Künsderin entgegen, und selbst die Kritik bewahrt nicht immer ihre volle Unbefangenheit« (in: Kat., S. 122). Pressespiegel
145
Vor diesem Hintergrund bildet August Gathys 1837 publizierte Analyse von Clara Wiecks Klavierspiel eine Ausnahme. Gathy koppelte den »Standpunct [...], von welchem aus ihre Virtuosität betrachtet und beurtheilt werden« müsste, an die Erfüllung der besonderen Erfordernisse der neuesten zeitgenössischen Klaviermusik, »welche das Orchesterspiel auf dem Pianoforte verlangt«: »Vollstimmigkeit der Composition« wäre »durch eine Vollgriffigkeit in gleichzeitig angeschlagenen oder harpeggirenden Accorden« wiederzugeben, »die nicht allein die größte Freiheit und Geschmeidigkeit der Finger und Handgelenke erfordert, sondern überdies jedem einzelnen Finger seine eigene, selbständige Aufgabe stellt; so daß man während des Spiels die Noten zur Hand haben oder doch hinlänglich damit vertraut sein muß, um zu begreifen, wie Alles — klar hervortretende Melodie im Discant, kräftig sich bewegender Baß in der Tiefe, Gegenmelodie und fortwährend volle Begleitung in der Mittellage - gleichzeitig, nicht von vier, sondern nur von zwei Händen vorgetragen werden kann« (NZß\4 1837, S. 55). Gathy bot damit eine Erklärung, welche exzeptionellen Leistungen die Virtuosin darbot, gerade bei Komponisten wie Chopin oder Schumann, deren Stücke noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oft als »undankbar« schwer galten. Schon früh wurde in der Presse ihre bemerkenswerte stilistische Vielfalt hervorgehoben. Sie galt als besonderes Merkmal der »Werktreue«, die die Virtuosin neben »Precision, Eleganz und Rapidität« ( N Z f M 1839, S. 174) auszeichnete. Darunter fiel die in den 1830er Jahren noch seltene notengetreue Wiedergabe »ohne Manier und ohne Ziererei« (.AmZ 1837, Sp. 858), nämlich ohne eigenmächtige Veränderungen der Partitur etwa durch improvisierende Ausschmückungen oder großzügige Kürzungen. Dieses Image wurde auch im Ausland durch Korrespondenten und Berichte von europareisenden Musikenthusiasten beziehungsweise von Schülerinnen und Schülern Clara Schumanns verbreitet (Reich 1999, S. 195ff). So schrieb der Rezensent der englischen Zeitung The Athenaeum 1841, er hätte »selten einen bestimmteren Anschlag ohne Übertreibung und ohne Gewaltsamkeit, selten eine meisterlichere, großzügigere, intelligentere Auffassung der M u sik« gehört. Sollte es dem Spiel Clara Schumanns (»in England besser unter ihrem Mädchennamen Clara Wieck bekannt«) »an etwas mangeln, so wären es die Geziertheiten und Koketterien, die so frivol wirken, wenn sie von Männern produziert werden« (dt. in: Tb 2, Anm. 435, S. 508). Damit hob sich schon die junge Virtuosin von der Konkurrenz ab. In England wartete man längst auf ihren Auftritt. Sie kam aber erst fünfzehn Jahre später.
146
Starkult
1 Clara Wieck, 1832. Lithographie nach einem Gemälde von Eduard Fechner
2 Clara Wieck, 1835. Lithographie von Julius Giere
3 Clara Wieck, 1838. Lithographie von Andreas Staub
4 Clara Wieck, 1840. Aquarellierte Zeichnung von Johann Heinrich Schramm
5 Clara Schumann, 1844. Brustbild von August Wilhelm Wedeking, Ol auf Leinwand
8 Robert und Clara Schumann, 1847. Lithographie von Eduard Kaiser
9 Clara Schumann, 1847. Bleistiftzeichnung von Wilhelm Hensel, mit Widmung der Künstlerin
ItllHUIIMjiBBmtfäBiBMi
10 Clara und Robert Schumann am Pianino, 1850. Daguerreotypie von Johann Anton Völlner
11 Clara Schumann, 1853. Gemälde von Carl Ferdinand Sohn
14 Die Schumannschen Kinder, urn 1855. Fotograf unbekannt
17 Clara Schumann, 1866. Brustbild, Foto von C. von Jagemann mit eigenhändigem Zitat des Themas »Andantino de Clara Wieck« aus Robert Schumanns Sonate fiir Klavier f-Moll op. 14
18 Clara Schumann, 1878. Brustbild, Mischtechnik Franz von Lenbach
19 Clara Schumann, 1885. Marmorbüste von Adolf Hildebrand
20 Clara Schumann, 1887. Fotografie aus dem Atelier Elliot & Fry, London
21 Clara Schumann, Marie und Eugenie Schumann, Loucky Vonder Mühll (?), 1895. Fotografie, aufgenommen im Garten der Familie Vonder Mühll, Basel
Konkurrenz Nachahmung und Abgrenzung Aufgrund der berufsbezogenen Perspektive dürften sich Clara Schumanns persönliches und ihr Selbstkonzept als Künstlerin schon in Kindertagen eng aufeinander bezogen und im Licht der sehr frühen Auftrittserfahrung formiert haben. Kognitive Aspekte, wie die Selbsteinschätzung, deren affektive Bewertung (Selbstwert) und die Uberzeugung, mit der eigenen Leistung etwas bewirken zu können (Selbstwirksamkeit), potenzierten sich (de la Motte 2005, S. 541ff). Das heißt, bei der Entwicklung der Künstlerpersönlichkeit zählte von Kindheit an nicht allein die introspektive Erforschung (wer bin ich, was kann und was will ich), sondern auch die Selbstbeobachtung im Rampenlicht (wie wirke ich) und die Kontrolle eigener Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit. Reaktion auf das Feedback des Publikums und das Selbstbeobachten im Spiegel der anderen wurde ebenso von klein auf eingeübt wie ein gespitztes Interesse für die Konkurrenz. Durch den Pressespiegel konnte die Künstlerin lernen, wie sie und andere Virtuosen bewertet wurden. Schon das Mädchen analysierte und evaluierte mit Hilfe des Vaters nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Auftritte der Konkurrenten, um aus Fehlern zu lernen und sich im Wettbewerb individuell zu profilieren. Bis ans Ende ihres Lebens verhielt die Virtuosin sich kompetitiv, selbst ihren Töchtern gegenüber. Gerade in den 1830er Jahren, als die Künstlerin ihr Image noch modellierte, spielte dieser Faktor eine große Rolle. Beobachtet und bewertet wurden die technische Qualität des Spiels, der musikalische Vortrag, außerdem Punkte wie Vorbereitung, Repertoire, Dramaturgie, Bühnenwirkung und Auftrittsverhalten. Ferner registrierte man Publikumsbesuch, Applaus sowie die Presseresonanz und räsonierte über Gründe für das Ge- oder Misslingen der Darbietung. Dabei interessierte schon die junge Virtuosin das Kriterium »Berufsethik«. Darunter fielen nicht nur Fragen nach der Eitelkeit der Künstler, sondern vor allem nach übergeordneten Zielen, wie ästhetische Bildung und Sendungsbewusstsein bei der Verbreitung anspruchsvoller Kunst. Aus den Tagebüchern und Briefen lässt sich vor allem für die frühen Jahre ein aufschlussreiches Ranking der Konkurrentinnen und Konkurrenten herausfiltern. Unter den Virtuosen der älteren Generation, die anfangs vor allem durch Friedrich Wieck bewertet wurden, glänzte aus dieser speziellen Expertenperspektive nur Ignaz Moscheies. Sein »Spiel ist das solideste u. nobelste, Nachahmung und Abgrenzung
147
was man sich denken kann«, vornehm und gemessen. Er verzichtete in seinen Werken auf »Effekthascherei« und »verschmähet selbst alle feinere Koquetterie« (Jb, 21. Oktober 1832). Dafür kam Johann Peter Pixis, einer der populärsten Komponisten der frühen 1830er Jahre, am schlechtesten weg. Nachdem Clara Wieck mit ihm am 8. Oktober 1833 sein Großes Duett für •zwei Klaviere, das Pixis ihr widmete, im Gewandhaus gespielt hatte, notierte der Vater: »Wie wenig hat früher zur Virtuosität gehört. Sein Anschlag ist falsch, so wie seine Bewegung der Hand und der Finger. Sein Spiel ermangelt ganz der feineren Ausbildung« (8. Oktober 1833). Auch Henri Herz, den sie 1832 in Paris hörten, überzeugte gar nicht. Der spielte »ohne Herz, die Hände springen ohne Seele, und es sieht alles viel besser noch auf dem Papiere aus, als es sich anhören lässt« (16. März 1832). Friedrich Kalkbrenner bestach dagegen durch seine Brillanz. Doch wenn ein Virtuose nur eigene Stücke spielte, so wäre das schon »ein Rückschritt«, so Friedrich Wieck, »bei Kalkbrenner umso fühlbarer, als seine Compositionen des innern poetischen Lebens und der Originalität gänzlich ermangeln« (11. Mai 1833). Diesen Missstand empfand Clara Wieck auch bei der jüngeren Konkurrenz. Theodor Döhler, den ihr Vater gnadenlos als »frisirtes Eichhörnchen« abqualifizierte, fertigte Stücke, die noch »unter Czerny« stünden, »kalt und herzlos«, wenn auch sehr gut gespielt. »Er fand also ungeheuren Beifall« (9. Oktober 1836). Keinen Beifall hatte Wilhelm Taubert vor leerem Saal erringen können, obwohl er ein anspruchsvolles Beethoven-Programm bot, gemischt mit eigenen Kompositionen, die nach Friedrich Wiecks Urteil lediglich zeigten, dass er ganz »unbewandert« sei in Bezug auf die aktuelle Entwicklung. Bennett, der »Londoner Chopin« (4. November 1836), artikulierte »trocken« und »nuschlich« (19. Januar 1837). Selbst Sigismund Thalberg, für dessen Technik Clara Schumann noch 1841 in höchstem Lob schwärmte - er spielte »zum Entzücken schön«, eine »vollendetere Mechanik giebt es nicht«, »seine Läufe kann man mit Perlenreihen vergleichen, seine Octaven sind die schönsten, die ich je gehört« - , überzeugte als Komponist gar nicht. »Mir kommt es vor, als wollte er Liszt in seinen Fantasieen imitieren, wozu ihm jedoch dessen geistiger Aufschwung fehlt« (Tb 2, S. 146f). Friedrich Wieck hatte Thalberg für den Friseur gehalten, als er ihm im Treppenhaus begegnete. Indiskutabel waren alle, die nicht genug geübt hatten, wie der Donaueschinger Kapellmeister Kalliwoda. Dazu gehörte auch die Geigerin Nanette Oswald. Sie »kann viel zu wenig«, ebenso Clara Novello. »Klaviertrommler« und »Maschinen« kamen ebenfalls nicht gut an, wie Clara die gleichaltrigen Kollegen Alexander Dreyschock, Robena Laidlaw und Louis Lacombe 148
Starkult
nannte (Jb, 15. Oktober 1832 bis 6. März 1839). Auch ihre direkten Konkurrentinnen der Anfangszeit, Leopoldine Blahetka und Anna Caroline von Belleville, konnten vor den kritischen Ohren der Wiecks nicht bestehen. »Was will die Blahetka mit ihrem altmodischen kalten Stil u. ihren geistlosen Compositionen? [...] Sie thut sich Schaden, wenn sie immer nur ihre Compositionen spielt« (17. und 20. März 1832). Trotz geballter öffentlicher musikalischer Aktivitäten reichte Clara Wieck Anfang der dreißiger Jahre allerdings noch nicht an sie heran. Schumann zog 1832 in einem Artikel für den Komet einen schmeichelnden Vergleich zwischen der damals 24jährigen Belleville und der zwölfjährigen Clara Wieck: »Jene ist dichtend, diese das Gedicht«. Belleville ordnete er der französischen, Wieck der deutschen »Schule« zu, und setzte Eleganz und technische Perfektion gegen »Herz« und »Gemüt«, damals gängige Topoi für die Selbstsicht deutscher Künstler. In einem Brief an seine Mutter vom 28. Juni 1833 bekräftigte Schumann privat, er reichte »vor allen männlichen Virtuosen zwei Mädchen die Palme, der Belleville und der Klara« (in: GS 2, S. 350 und 461). Belleville, eine Schülerin Czernys, die 1819 in Wien die Bühne betreten und noch Auftritte Beethovens gehört hatte, war Anfang der 1830er Jahre bereits eine international bekannte Virtuosin. Sie hatte in London in einem Konzert Paganinis debütiert (ein Schachzug, den Clara Wieck in Paris imitieren wollte), trat in ganz Europa auf und führte die Konzerte der um 1830 prominentesten Klavierkomponisten im Repertoire, nämlich Hummel, Kalkbrenner, Moscheies, Ries und Pixis (Koiwa, S. lOff). In der Konzertsaison 1830/31 trat sie gleich fünfmal in Leipzig auf, suchte sich bei Wieck einen Flügel aus, konzertierte erfolgreich im Gewandhaus mit Beethovens drittem Klavierkonzert c-Moll op. 37 und exekutierte mit Clara vierhändige Variationen von Herz. Erst nachdem Clara Wieck sich in Wien 1837/38 an die Spitze gespielt hatte, schaffte sie es, die Konkurrentin Belleville (»das unausstehlichste Weib der Welt«; Jb, 8. April 1839) aus ihrem Kopf zu verdrängen. Dagegen wuchs die acht Jahre ältere Pianistin Camilla Pleyel für Clara Wieck zu einer Angstgegnerin. Pleyel war um 1838 längst europaweit bekannt und zu diesem Zeitpunkt zweifellos die wichtigste unter der internationalen Konkurrenz. Die 1811 geborene Marie Denise Moke (so ihr ursprünglicher Name) hatte bereits eine ansehnliche Karriere gemacht. Als Schülerin von Jacques Herz, Kalkbrenner und Moscheies begann sie ihre Laufbahn 1825 in Brüssel. Es folgten Auftritte in London, St. Petersburg, Wien und in verschiedenen deutschen Städten. In Paris machte sie ebenfalls früh Furore. Chopin widmete ihr seine Trais Nocturnes op. 9, auch Hiller Nachahmung und Abgrenzung
149
und Mendelssohn umschwärmten sie heftig. Liszt benutzte später sogar Chopins Wohnung für ein Rendez-vous mit der Pleyel, was zum Bruch ihrer Freundschaft führte. Neben der glanzvollen Kunst interessierte die Öffentlichkeit gleichermaßen das bewegte Liebesleben dieser Künstlerin. Nach einer sehr kurzen Verlobung mit Berlioz 1830, der diese Episode später lediglich als ein Kräftemessen ihrer Verfuhrungskünste skizzierte (Berlioz 1990, S. lOOff), heiratete sie im selben Jahr den Komponisten, Pianisten und Klavierfabrikanten Camille Pleyel. Von da an nannte sie sich Camille (die französische Form gilt für Frauen wie Männer) beziehungsweise Camilla, so dass ihr neuer Künstlername mit dem ihres Mannes übereinstimmte, eine höchst romantische Symbiose. Die Ehe wurde allerdings 1835 wieder geschieden. Camilla Pleyel behielt diesen Namen weiterhin und setzte ihre internationale Karriere fort. Anfang der 1840er Jahre zog sie sich dann vom Podium zurück. Sie wirkte von 1848 bis 1872 als Klavierprofessorin am Conservatoire von Brüssel, dessen Direktor, Fetis, in ihr ein Ideal des Klavierspiels sah. Clara Wieck kannte Camilla Pleyel lange Zeit nicht aus eigener Anschauung, sondern wurde seit 1836 immer wieder durch verschiedene Gerüchte über die »vergötterte« Konkurrentin alarmiert und notierte den Klatsch sogar im Tagebuch. Danach hätte die Pianistin, die 1837 mit dem Hamburger Kaufmann Charles Parish liiert war, einen Vertrag geschlossen, der sie - bei einer Strafe von dreitausend Mark - verpflichtete, ohne seine Einwilligung keinen Herrenbesuch zu empfangen. Im Gegenzug richtete Parish ihr in Hamburg eine Villa ein. Er selbst blieb bei seinen Eltern wohnen, da ihr Verhältnis nicht legitimiert werden konnte. Friedrich Wieck musste jedenfalls umkehren, als er ihr ohne Parishs Begleitung seine Aufwartung machen wollte (Jb, 29. März 1837). »Könnte ich doch nur dieses merkwürdige Weib hören und sehen. Jede ihrer Bewegungen soll studirt seyn, nach Beendigung eines Stücks bleibt sie auf dem Orchester«, das heißt auf der Bühne, »spricht mit den Musikern, verneigt sich immer wieder, ganz kindlich, als wüßte sie gar nicht, wie ihr dieser Beifall gebühre.« Und: »Sie soll allen Männern die Köpfe verdrehen« (Jb, 26. Oktober und 1. Dezember 1839), allen voran Robert Schumann. Dessen Urteil entschärfte die anonyme Gefahr keineswegs. Im Gegenteil. Pleyel wählte »ausgezeichnete Stücke«, spielte »mit Feuer und Leben, und dann interessirt sie ja auch als Person«, schrieb Schumann seiner Braut. Sie »hat viel Künstlerisches, in der Figur viel von Dir, im Gesicht etwas von Paulinen und Dir. Morgen besuche ich sie privatim« (Bw, S. 766). Er petzte auch, wie Friedrich Wieck in Leipzig die Pleyel öffentlich hofiert hätte. 150
Starkult
Clara Wieck reagierte vergrätzt. Schumanns Artikel über die Pleyel in der NZflM enthielt vieles, was sie selbst als Besonderheit für sich in Anspruch nahm, etwa die erlesene Programmauswahl (Weber, Beethoven, Hummel, Mendelssohn) die, so Schumann, »auf die würdigste Richtung der Künstlerin schließen« ließ. Pleyel hätte Beethovens c-Moll-Konzert op. 37 »würdig, ohne Fehl, im deutschen Sinne« vorgetragen, so dass »die Musik wie ein Bild ansprach«. Die »höchst interessante Frau«, für deren »feine, blumenhafte Gestalt« Schumanns Pseudonym Florestan in der Zeitung schwärmte, würde »überall durch ihr Spiel erfreuen, und, mehr als das, durch ihre Vorliebe für das Edelste ihrer Kunst zu dessen Verbreitung mitwirken« (in: GS 1, S. 444f). Genau das hatte sich Clara Wieck auf ihre Fahnen geschrieben. »Alles, was ich über sie lese, ist mir immer deutlicher Beweis, daß sie über mich zu stellen« wäre, notierte sie in »totale[r] Niedergeschlagenheit«. Clara Wieck saß 1839 missmutig in Berlin, während das tosende Leben in Leipzig abzulaufen schien. Doch anstatt es bei der Eifersucht auf die Konkurrentin zu belassen, transformierte Wieck ihre Frustration über den eigenen beruflichen Durchhänger mit einer gedanklichen Volte in generelle Zweifel. »Ich glaubte einmal, das Talent des Schaffens zu besitzen, doch von dieser Idee bin ich zurückgekommen«, fuhr sie fort und verallgemeinerte defätistisch: »Ein Frauenzimmer muß nicht componiren wollen - es konnte noch Keine« (26. November 1839). Ausgerechnet als Komponistin hätte sie ohne weiteres gepunktet. Denn bei allem Enthusiasmus fand Schumann Pleyeis eigene Preziosa-Variationen ungenügend. Doch das ging in diesem Moment an ihr vorbei. Der Liebste meldete sich nicht. »Womit habe ich Deine Kälte verdient?« »Hast Du mich denn nicht mehr so lieb?« (Bw, S. 806). Es brauchte nur wenige Tage, bis sie sich von allein wieder berappelte und eine passende Sichtweise zurechdegte. »Die halbe Kunst besteht doch wirklich in jetziger Zeit in Coquetterie«, so verurteilte sie Pleyels Erfolgsrezept, noch ohne sie überhaupt einmal gesehen oder gehört zu haben. »Nun, mögen es Andere sein, und mögen sie mehr Beifall finden als ich, der Kenner wird mir doch nicht all mein Verdienst absprechen«. Und schon entzückte sie in einer privaten Soiree wieder mit Schumannschen Kompositionen (Jb, 1. und 2. Dezember 1839). Erst 1851 lernte Clara Schumann Camilla Pleyel persönlich kennen. Während einer Belgien-Reise besuchten die Schumanns sie in Brüssel. »Ich [...] fand mich sehr überrascht durch ihre große Liebenswürdigkeit, in der sie mir so ganz natürlich schien«, so Clara Schumann über ihre ehemals schärfste Gegnerin. Inzwischen waren jüngere Konkurrentinnen auf die Bühne getreten, wie die »schwächere« Wilhelmine Clauß-Szärvädy, so Hanslick, deren »weich anschmiegende[r]« Ausdruck ihm allerdings bes-
Nachahmung und Abgrenzung
151
ser gefiel als Clara Schumanns »Männlichkeit des Vortrages« (Litzmann 2, S. 263; Kat., S. 129f). Ihren männlichen Konkurrenten gegenüber reagierte Clara Wieck offensiver als den weiblichen. Dass Liszt im Frühjahr 1838 in Wien erwartet wurde, sah sie als willkommene Herausforderung. »Nun, so hätt' ich einen Wettkampf zu bestehen.« »Ich bin ein gepanzertes Mädchen«, bekräftigte sie kampfeslustig (Jb, 6. Dezember 1837; Bw, S. 116). Weder körperliche Attacken, wie die des Berliner Geigers und Dirigenten Karl Moser, der sie »beim Arm« nahm und »von den Brettern [zerrte], damit das Publikum nicht zu viel klatschen sollte« (Jb, 27. Februar 1837), noch verbales Imponiergehabe, wie von Lacombe, der lauthals ankündigte, »Claras Stelle zu ersetzen !!!« (Jb, 7. Dezember 1837), schreckten sie ab. Clara Wieck zweifelte - trotz mancher Ängste nicht daran, dass sie in der Spitzenklasse der internationalen Virtuosen mitspielte. »Wir machen das Publikum auf die junge bescheidene Künstlerin, die in Deutschland Liszt und Chopin an die Seite gesetzt wird, aufmerksam. Wien soll entscheiden, ob sie sich neben Thalberg behaupten kann.« Diese, ihren Rang bestätigende Zeitungsnotiz kopierte Friedrich Wieck ins Tagebuch (7. Dezember 1837). Öffentliche Vergleiche waren beliebt, nicht bloß, um ein Ranking unter den konkurrierenden Virtuosen herzustellen, sondern auch, weil sich dadurch Eigenheiten und Vorzüge der einzelnen Künstler leichter darstellen ließen. Für die Leserschaft boten sie eine willkommene Orientierung. In einem 1838 verfassten Bericht über Liszt verglich der Korrespondent der NZfM die vier besten Virtuosen der Saison miteinander, nämlich Henselt, Liszt, Thalberg und Wieck. Alle zusammen wären noch nicht einmal hundert Jahre alt, so Friedrich Wieck. »Höchst vergnügend, ja oft entzückend ist Thalberg, dämonisch Liszt, in die höchsten Regionen versetzend Clara Wieck, schön aufregend: Henselt.« Bei der »Reinheit des Spiels« landete Wieck auf Platz zwei, Liszt auf dem letzten, in der Improvisation hingegen Liszt an erster, Wieck an zweiter Stelle. Die Kategorien »tiefe Künstlernatur« erfüllten nur Liszt und Wieck, »Originalität« nur Liszt, bei der »Vielseitigkeit« führte Wieck vor Liszt, bei der »Kühnheit« Liszt vor Wieck, »Gefühl und Wärme« hätte Liszt vor Henselt und Wieck, »Egoismus«: Liszt und Henselt, »ohne Grimassen beim Spiel«: Thalberg und Wieck, »nach dem Metronom spielend: Keiner«. Die Kategorie »Komposition« fugte die Redaktion (also Schumann) noch an und nannte als einzig erwähnenswerten: Henselt (S. 135f). Clara Wieck und Franz Liszt traten in der internationalen Konzertszene im Vormärz zwar gegeneinander an, doch kamen sie sich nicht wirklich ins Gehege. Beide verkörperten in der Öffentlichkeit zwei völlig unterschied152
Starkult
liehe Startypen. Liszt inszenierte eine rauschende Bühnenshow. Sie war ein wichtiges Element seiner Auftritte. Friedrich Wieck protokollierte im Frühjahr 1838 sehr plastisch, wie der Flügel des Klavierbauers Conrad Graf »in einem großen Duell erlag und - Liszt Sieger blieb«. »Nachdem er im 1. Stück« den von Thalberg privat zur Verfugung gestellten englischen Flügel »vernichtet, spielte er die [Puritaner-]Fantasie auf einem C. Graff, sprengte 2 Messingsaiten, holte sich selber den 2ten Graff in Nussholz aus dem Winkel u. spielte seine Etüde, nachdem er wieder 2 Saiten gesprengt, noch einmal« (Wieck Briefe, S. 94). »Alle 3 zerschlagen aber alles genial - der Beifall ungeheuer - der Künstler ungenirt und liebenswürdig«, ergänzte Wieck im Tagebuch. »Und wo giebt es Klaviere, die das nur halb wiedergeben, was er kann und was er will«? Liszt »zappelt am ganzen Leibe«, so Friedrich Wieck, aber »seine Bewegungen gehören zu seinem Spiel und stehen ihm schön an«. Er würfe »mit Vehemenz seine Handschuh u. Schnupftuch auf die Erde vor's Ciavier«, spräche dabei »mit den um sich herumsitzenden Damen, bleibt immer auf dem Orchester, trinkt schwarzen Kaffee, und benimmt sich wie zu Hause. Das alles gefallt jetzt und macht Furore« (Jb, 11. April bis 6. Mai 1838). »Er ist ein Künstler, den man selbst hören und sehen muss«, schrieb Clara Wieck begeistert an Schumann. Allerdings nutzte sich der Effekt auf Dauer auch ab. »Liszt hat im vorletzten Concert mit einem Accord 3 Hämmer aus den Capseln geschlagen und außerdem 4 Saiten gesprengt - er muß also wieder gesund sein«, so Clara Wieck lakonisch im Februar 1840 (Bw, S. 159 und 929). Liszt gehörte zu den spektakulären Verführern. Im Unterschied zum diabolischen Anstrich von Paganini verkörperte er - nach den zeitgenössischen Beschreibungen zu schließen - einen höchst charmanten Magier, der die Musik dazu nutzte, um sein Publikum emotional und erotisch zu verzaubern. Dazu gehörten Extravaganzen inner- und außerhalb der Konzertsäle, Flirts, Affaren und Gerüchte über illegitime Verhältnisse, tatsächliche (Liszts drei Kinder mit Marie d'Agoult - Blandine, Cosima und Daniel - wurden zwischen 1835 und 1839 geboren) und erfundene. Seine Fans huldigten ihm mit einer Begeisterung, die bereits an moderne Massenhysterie denken lässt. »Ein in der Probe von ihm verlorener Handschuh wurde von einem jungen Herrn erobert und einer Gesellschaft junger Damen überliefert, welche die einzelnen Fetzen des gefärbten Ziegenfelles im Triumph unter sich verteilten«, berichtete die Leipziger Zeitung noch 1860 (in: Seibold 2005,1, S. 291). Zwar gestaltete Liszt sein Repertoire nach deutschen Kriterien recht bunt, »von ungeheuerem quantitativen Reichthum, aber von keinem künsderischen Prinzip beherrscht« (Hanslick 1869, S. 291). Was ihn jedoch von anderen Tas-
Nachahmung und Abgrenzung
153
tenartisten am meisten unterschied, war seine frappierende technische Brillanz, mit der er nicht nur eigene, sondern auch »klassische« sowie die Werke der zeitgenössischen Kunst zum Funkeln brachte. Liszts Bühnenpräsentation war nicht zu überbieten. Wenn man Clara Wiecks Wirkung »Enthusiasmus nannte, so müsste man jetzt erst ein neues Wort erfinden, um die Stimmung zu bezeichnen, in welche Liszt seine Zuhörer zu versetzen« wüsste, resümierte ein zeitgenössischer Kritiker in Wien 1838 (in: Kat., S. 110). Clara Wieck verkörperte dagegen den neuen Typus einer ebenso »seelenvollen« wie geistreichen, musikalisch gebildeten, intellektuell sich einfühlenden Interpretin, die die Musik in den Mittelpunkt stellte, ganz darin aufzugehen schien und so deren Schönheit vermittelte. Sie positionierte sich damit als Künstlerin, die nach deutschen Wertmaßstäben die Zeichen der neuen Zeit wach aufnahm und die künftige Richtung bereits eingeschlagen hatte, nämlich die Aufwertung artifizieller Musik als ästhetisch autonome Kunst. Durch ihre Zurückhaltung wirkte sie »natürlich« und unprätentiös. Diesen Nimbus konnte Clara Schumann noch bis ins hohe Alter retten. Als Mädchen bot sie mit ihrer aus Kompetenz und subtiler Erotik gepaarten Ausstrahlung eine idealisierte Projektionsfläche: die bezaubernde Unschuld, die ihrem Publikum einen Einblick in das Ideenreich der hohen Kunst bescherte, wirkte wie eine tugendhafte Braut, die jeder sich wünschte, und die Schumann bekommen hatte. Dass das Konzept aufging, bilden zwei in bemerkenswert einschlägiger sexueller Metaphorik verfasste Rezensionen ab. Sie verdeutlichen die unterschiedlichen Selbstinszenierungen beider Stars. Liszt »kommt, setzt sich an den Flügel, ohne etwas zu merken, in seine Aufgabe versunken, gedankenvoll, zitternd im Fieber der Eingebung«, so beginnt ein zeitgenössischer Konzertbericht 1844. Dann »tobt er darauf los ohne Mitleid. Der Aufschwung ist genommen, folge ihm, wer kann. Das hingerissene, begeistert tief aufatmende Publikum kann seine Beifallsrufe nicht mehr zurückhalten, man stampft fortwährend mit den Füßen [...], dazwischen einzelne Schreie, die unwillkürlich ausgestoßen werden, flüsternd wird wieder Stille geboten; die wird mühselig hergestellt, bis am Ende, auf dem Höhepunkt der Leistung, alles losbricht und der Saal widerhallt von einem einzigen Donner des Beifalls« (in: Burger 1986, S. 152). Auch ein 1844 unternommener Vergleich zwischen Liszt und Clara Schumann in der Allgemeinen musikalischen Zeitung spielt darauf an. »Liszt reißt durch eine die Schranken des Möglichen fast übertriebene, wildstürmende Bravour zum Staunen hin - Clara Schumann rührt durch Grazie und Anmut. Daher die Erscheinung, dass Clara Kenner und Liebhaber in glei-
154
Starkult
chem Grade entzückte, während Liszt [ . . . ] mehr bei Laien Beifall findet. Diesen imponiert die Körperanstrenung, das flatternde Haupthaar, die aufund niederwogenden Hände, das Rauschen der Hämmer.« Doch der sanfte Reiz verlangte »vom Hörer mehr, verlangt Tiefe des Gemüts« (Sp. 185). In Liszts Spiel würden alle Stücke zu Liszt, eine Erfahrung, die auch Robert Schumann an seinem Carnaval machte, während Clara Schumann sich als werkgetreue Interpretin profilierte. So bestätigte ein Rezensent der Signale für die musikalische Welt mit deutlich moralischer Implikation, dass die Schumann »nichts weniger als ein eitles Geltendmachen ihrer individuellen Virtuosennatur der reinen göttlichen Kunst gegenüber kennt, daß sie vielmehr, statt die unsterblichen Tonschöpfungen Anderer als bloßes Mittel zu egoistischem Zwecke anzusehen, in ihnen den ganzen Reichtum einer poetischen Seele [ . . . ] entfaltet« (1844, S. 93f). Konfrontiert man diese Eindrücke mit dem, was schon Clara Wieck Schumann an ihren Kolleginnen und Kollegen schätzte, so stimmen die von ihr selber als positiv hervorgehobenen mit den im Blick der Rezensenten über sie als Künstlerin beschriebenen Eigenschaften weitgehend überein. Das heißt, ihr Selbstkonzept als Virtuosin und das von außen gespiegelte Bild wirkten überzeugend kohärent. In ihrem aus Tagebüchern und Briefen hervorgehenden Ranking galt für sie das pianistische Niveau Liszts als unerreichbar. »Seit ich List's Bravour gehört und gesehen habe, komme ich mir vor wie Schülerin«, schrieb sie Schumann 1838. Sein Spiel setzte sie auch später noch immer wieder in »das höchste Erstaunen« ( B w , S. 159; Tb 2, S. 197). Thalberg und Henselt bewunderte sie als Virtuosen, doch fehlte dem ersten der Esprit, dem zweiten der künstlerische Biss. Wichtig waren ihr Können, Professionalität, umfassende Musikkenntnisse, daneben bürgerliche Ideale, wie Fleiß und Ehrgeiz, aber auch Distanz zur eigenen Person. Besonders allergisch reagierte sie auf den Einsatz erotischer Signale, Frauen gegenüber noch mehr als Männern. Am meisten schätzte sie Bescheidenheit. Uber Henri Vieuxtemps, mit dem sie eine nicht näher bezeichnete Violinsonate von Beethoven musiziert hatte, notierte sich Clara Wieck, »so groß als Künstler, so bescheiden als Mensch« (20. Oktober 1837). Hoch gelobt wurden außerdem die fachlichen und menschlichen Qualitäten des russischen Pianisten Anton Gerke, der über eine »erstaunenswerthe« Mechanik und ein »bewundernswürdiges« Gedächtnis verfugte, dabei liebenswürdig, bescheiden und nobel sei (22. September 1837). Gerkes Ansehen verstärkte noch, dass er auf ein Honorar verzichtete. Seine Deutschlandtournee wurde vom russischen Zaren gesponsert. Nachahmung und Abgrenzung
155
Auch die gleichaltrige Sängerin, Pianistin und Komponistin Pauline Garcia-Viardot beeindruckte als »echte Künstlerseele«, »sie interessirt sich lebhaft für Musik«, »auch mangelt ihr nicht das Gemüth«, sie wäre dabei »ein bescheidenes und anspruchsloses Mädchen« und »die interessante Frau, die ich je kennen gelernt« (Jb, 24., 25. Mai; 5. Juli 1838). Das galt ebenso für die Sängerin Caroline Unger-Sabatier, die 1824 in der Uraufführung von Beethovens Neunter Sinfonie op. 125 gesungen hatte. Sie »ergriff" mich doch aufs tiefste [...], ich musste weinen, wie es mir selten bei Musik passiert«. Clara Schumann schätzte sie als »höchst liebenswürdig, bescheiden und anspruchslos« (Tb 2, S. 197). »In der Kunst mein Ideal!«, hielt Clara Wieck 1840 nach einer FidelioAuffuhrung über Wilhelmine Schröder-Devrient fest. Zwar war diese berühmte »Leonore« weder bescheiden noch besonders züchtig, dafür demonstrierte sie aber vollkommene Professionalität, nämlich eine Stimm- und Körperkontrolle bis in die Fingerspitzen, deren Wirkung »schön natürlich« sei. »Die höchste Vollendung in der Kunst, wie sie sie besitzt, scheint Einem Natur, jede Fingerbewegung ist bei ihr studirt, und doch glaubt man, es sey alles augenblickliche Eingebung«, mit »Wärme« und »Innigkeit«, »meisterhaft ruhig« und »nobel dabei« (5. April 1840). Clara Wieck arbeitete an diesem Perfektionismus, der sie bei Schröder-Devrient so sehr begeisterte. Litzmann erinnerte sich, dass die »dunklen Augen aufglühten«, als die »Greisin« Clara Schumann »in jugendlichem Enthusiasmus [...] von den Stürmen des Entzückens erzählte«, die der Gesang der Schröder-Devrient in ihr ausgelöst hätten (Litzmann 2, S. 117). Doch »über Alle[n] steht - Mendelssohn« (Jb, 30. Dezember 1838). Er galt im privaten Ranking der Virtuosin bis zu seinem Tod immer wieder als Höchster, weil er — jedenfalls meistens - über alle wünschenswerten künstlerischen und menschlichen Eigenschaften zusammen verfugte. Auch er schaffte es, sie mit dem Vortrag seines Klaviertrios d-Moll op. 49 und Mozarts Klavierquartett g-Moll KV 478 zu Tränen zu rühren. »Er ist mir doch der liebste Spieler unter Allen«, gestand sie auch Schumann. »Den Genuß abgerechnet halte ich es für mich sehr lehrreich ihn zu hören«, vor allem mit Werken von Bach (Bw, S. 1020 und 1028). Diesbezüglich hatte Schumann einen ernst zu nehmenden Rivalen. Ihre eigene Natürlichkeit im Auftritt gehörte durchaus zur öffentlichen Inszenierung. »Ich bin nicht so bescheiden vor Anderen als Du denkst«, belehrte Clara Wieck ihren Bräutigam (Bw, S. 716). Sie sei ihm gegenüber nur ehrlicher als vor dem Publikum, das manches nicht zu wissen brauche. Auch ihr Aussehen war ihr keineswegs gleichgültig, sondern wurde im Hinblick 156
Starkult
auf ihre öffentliche Rolle aufmerksam gepflegt. Daher ließ sich Clara Wieck in Wien zwei »Tintenklekse an der Nasenspitze« wegretuschieren und die Zähne richten. Als Bühnen-Make-up hatte sie »ein ganz wenig roth aufgelegt« ( B w , S. 1165). Ihre mädchenhafte äußere Erscheinung war kunstvoll inszeniert. Anstelle von »Locken, großen Schleppkleidern u. dicken Hintern«, so Friedrich Wiecks rustikale Beschreibung des modischen Weiblichkeitsideals der mondänen Wiener Gesellschaft von 1838, verbreitete die Virtuosin optisch ein schlichtes Bild vornehmer Zurückhaltung von sich. Und sie blieb dabei, trotz zahlreicher Optimierungstipps und Empfehlungen. »Claras Einfachheit gefällt am Ende« (Jb, 18. Dezember 1837; Wieck Briefe, S. 82 und 96). Ihre spezifische Ausstrahlung war Teil der Imagekonstruktion. Dass sie wirkte, zeigt Liszts Beschreibung seiner Konkurrentin von 1838. So schilderte er Marie d'Agoult vertraulich: »Wir wohnen beide im Hotel >Zur Stadt Frankfurt«, und nach dem Diner klimpern wir ein wenig herum. Sie ist eine sehr einfache Person, sehr gut erzogen, keineswegs k[okett], ganz in ihrer Kunst aufgehend, aber auf die vornehme Art und ohne Künstlichkeit. Ihre Kompositionen sind wirklich sehr beachtlich, gerade für eine Frau. Sie enthalten hundertmal mehr Einfallsreichtum und wahres Gefühl als alle früheren und jetzigen Fantasien von Thalberg. Sie hat hier die Frequentipalpiti«, Liszts Pacini-Fantasie, »mit unglaublichem Erfolg gespielt« (in: Seibold 2005,1, S. 68). Die schlichte Selbstpräsentation deckte sich im Vormärz mit einem modernen, als natürlich geltenden Frauentypus deutscher Bürgerlichkeit, der im politisch gefärbten nationalen Diskurs in Opposition zur »französisch« etikettierten Frivolität und Oberflächlichkeit gehandelt wurde (Link/Wülfing 1984, S. 238; Link/Wülfing 1991, S. 22). Selbstverständlich passte Clara Wieck ihr Auftreten in Frankreich den dortigen Gepflogenheiten an. So trug sie in Paris 1839 ein Gewand aus schwarzer Seide, »das ist hier jetzt beliebt«, wirkungsvoll kontrastiert durch weiße Kamelien im Haar und als Ansteckschmuck {Bw, S. 453). Die im deutschen bürgerlichen Ideal implizierte Vorstellung von Innerlichkeit und Intimität kollidierte allerdings erheblich mit dem Beruf, sich auf der Bühne zu exponieren. Um diesen Aspekt abzumildern, galt es daher unbedingt, einen guten Ruf zu wahren und von der eigenen Seriosität zu überzeugen. Franz Brendels stereotype moralisch abwertende Beschreibung von Operndiven fasste gängige Vorurteile zusammen, die bereits seit dem 18. Jahrhundert immer wieder aufkreuzten: »Die Sängerin muss als Weib die Männerwelt zu fesseln, sie muss zu kokettieren, eine gute Toilette zu machen verstehen. Es ist nothwendig, dass sie dem Auge einen sinnlichen Reiz gewähre. Bietet sie denselben auch durch ihren Gesang, so ist das Entzücken
Nachahmung und Abgrenzung
157
vollständig [...] Für viele Concertbesucher ist eine Art verfeinerter Wollust, solchen Trillern und Läufen zuzuhören« (Brendel 1854, S. 46). In England sorgte der Künstleragent von Jenny Lind dafür, dass die Sängerin in der Öffentlichkeit als wohltätige und bescheidene Frau erschien (Borgstedt 2006, S. 123). Clara Schumann bestätigte diesen Eindruck: »Die Lind ist ein Gesangsgenie«, notierte sie sich 1846. Beim Empfang nach einem Konzert in Leipzig »gewann ich Jenny Lind doppelt lieb durch ihr anspruchsloses, ich möchte fast sagen, zurückhaltendes Wesen; man merkte kaum, daß sie da war, so still war sie« (in: Litzmann 2, S. 115). Die Vermeidung jeglicher »Koketterie« und der Appeal von Reinheit und Unschuld, ihr »Louisenfaktor«, gehörten von Beginn an zu ihrem künstlerischen Kapital. Er ging auch in die Porträts von 1838 ein. »Erste Sitzung der Clara beim Portraitmaler Staub« (Jb, 1. März 1838): Andreas Staub fertigte eines der damals wie heute bekanntesten Bilder von Clara Wieck an. Staub, der sich erfolgreich die Vertriebsrechte dafür gesichert hatte, lithographierte die Künstlerin im Auftrag des Verlegers Diabelli. Das Bild konnte beim Musikverlag Hofmeister in zwei Qualitäten erworben werden, gedruckt auf gewöhnlichem oder auf chinesischem Papier. Nach diesem Entwurf wurden auch kleine kolorierte Elfenbeinminiaturen zum Anhängen oder Anstecken produziert. Clara Wieck erscheint auf der Lithographie als Dreiviertelfigur stehend vor einer angedeuteten Parklandschaft (Abb. 3). Ihr faksimilierter Namenszug sowie der eindrucksvolle Kammervirtuosentitel bezeugen ihre herausragende Professionalität. Daher konnte auf weitere musikalische Insignien verzichtet werden. Das Hineinsetzen in die Natur als Porträtort bringt eine gefühlvolle Komponente ins Bild (Busch-Salmen 1996, S. 809, Westhoff-Krummacher 1995, S. 94). Mit einer Viertelwendung des Kopfes blickt die Virtuosin den Betrachtern freundlich entgegen. Dabei vermittelt die geschlossene Körperhaltung sittsamen Anstand, in gezieltem Kontrast zu den oft dramatisch ausgreifenden Gesten von Sängerinnen. Diesem Ideal kam die neue Mode entgegen. Im jetzt aktuellen Schnitt rückte die Taille wieder an ihren natürlichen Platz, wurde mädchenhafter und schmaler, die voluminösen Keulenärmel verschwanden. Dass hier kein schlichtes Landkind, sondern eine hoch gefeierte Künstlerpersönlichkeit vorgestellt wird, unterstreichen die feinen Details der Kleidung: die diskrete Eleganz des dekolltierten blauen Seidenkleides mit seinem kunstvollen Schnitt und der raffiniert gefalteten Oberpartie, dazu der dezente Schmuck, die feine Goldschnur im Haar und Ohrringe, letztere möglicherweise ein fürstliches Geschenk. Modische Accessoires, wie die Lorgnette (sozusagen das zeitgenössische Pendant zur heutigen Designer-Sonnenbrille) 158
Starkult
und der damals überaus begehrte kostbare große Schal aus fein gesponnenem Kaschmir (Fashion 1, S. 207; Biedermeier, S. 575), lässig über die Arme gehängt, zeigen Understatement und Stil. Das indische Schultertuch war ursprünglich »ein Zeichen königlicher Abkunft und ein Symbol für den aristokratischen Wert seines Trägers«, so Bayly. Seit den 1830er Jahren wurde es von der Firma Paisley in Glasgow industriell produziert und global gehandelt (Bayly 2004, S. 459). Hier steht eine souveräne Künstlerin. Gleichzeitig geben die heute als »Kindchenschema« bezeichnete rührende leichte Kopfneigung sowie die runden, abfallenden Schultern der Figur einen Anschein von mädchenhafter Sanftmut, die der Gesichtsausdruck noch unterstreicht. »Ähnlich, doch geschmeichelt«, so Clara Wieck ( B w , S. 115). Als Schumann das »Engelsbild« von Staub im April erhielt, reagierte er völlig erotisiert. »Zerküßt habe ich's beinahe — ja das bist Du.«. »Da schau ich von den Augen zu den Lippen, dann zur Stirne dann das Ganze wieder [ . . . ] rolle dann weiter - da kömmt die Hand und nun der große Titel - nobel wie eine Prinzessin siehst Du [aus] und einfach wie ein Kind.« Die »Augen, die hat der Maler verstanden - höre, ist der ein junger Mann? Vor dem könnte ich Angst haben« (Bw, S. 133ff). Nicht ganz unberechtigt: Von Johann Heinrich Schramm, der anderthalb Jahre später noch kurz vor der Hochzeit eine aquarellierte Zeichnung von ihr anfertigte, fühlte sich Clara Wieck ausgesprochen belästigt. »Er wird mir immer unangenehmer durch seine Zudringlichkeit und unaussprechlich schmachtenden Blicke, die nichts zu bedeuten haben als eine widerliche Coquetterie. Gott, wie hasse ich das!« Womöglich blieb das Bild deswegen unvollendet (Bw, S. 1074; Abb. 4). Präzise beschreibt Schumann an sich selber die Funktion von Blicken in der Dramaturgie sinnlichen Begehrens. Er wusste, dass der Druck von Staub, den er in den Händen hielt, kein singulärer Abzug für ihn, sondern sozusagen Werbematerial war, das er mit einer großen Gemeinde zu teilen hatte, daher plante er sogar, ein in Wien ebenfalls neu gefertigtes und öffentlich ausgestelltes Ölgemälde von Clara Wieck zu kaufen, verwarf den Gedanken aber wieder. Unter ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten konnte sich Clara Wieck Schumann nicht zuletzt aufgrund ihrer musikalischen Perfektion profilieren. Das disziplinierte tägliche Üben, der Ehrgeiz, an der Spitze zu bleiben, die technische Geschmeidigkeit, an der sie unermüdlich feilte, um immer wieder auf der Bühne die Illusion herzustellen, als wären die größten Schwierigkeiten ganz einfach, waren ein besonderes Kapital. Von den jüngeren Konkurrenten in der zweiten Jahrhunderthälfte fanden nur wenige Gnade. Carl Tausig empfand sie 1864 als schier unerträglichen Tasten»Pauker«. Und dass Brahms von Bülow so schätzte, wunderte sie. »Das ist mir Nachahmung und Abgrenzung
159
doch der langweiligste Spieler, da ist von Schwung und Begeisterung keine Rede [...] ohne jeden seelischen Hauch«, selbst wenn sie dessen »eminente« Technik und sein hervorragendes Gedächtnis anerkannte (in: Litzmann 3, S. 156). Ihre herzhafte persönliche Abneigung erwiderte von Bülow mit gleicher Münze, und respektierte doch ihre fachliche Kompetenz. Dagegen scheinen, sofern man den erhaltenen Tagebuchfragmenten glauben darf, die Pianistinnen und Pianisten der Enkelgeneration, mit denen Clara Schumann in den 1870er und 80er Jahren konkurrierte, sie nicht mehr wirklich beunruhigt zu haben. Das bestätigen auch Presseauszüge. Zwar würde sie an »Feuer und Bravour heute bereits von jüngeren Pianistinnen z. B. Sophie Menter, Marie Jaell, weit überflügelt« fand Theodor Helm 1872. »Worin aber Frau Schumann noch immer auch den ersten Virtuosen des starken Geschlechtes nicht weicht, das ist der echt musikalische Vortrag«, ein »vollständiges Gleichgewicht aller technischen und geistigen Factoren [...] so könnens nicht zwei, drei Pianisten in Europa« (in: Kat., S. 127). Die Menter »wüßte das Publikum zu fesseln«, niemand spielte »Liszt eminenter« als sie, überlieferte der Enkel als Urteil Clara Schumanns (in: iVZ/M 1917, S. 78f). Wer wagte, sich ihrem Examen auszusetzen, wie Eugène d'Albert, der ihr 1881 Schumanns Sinfonische Etüden op. 13 vorspielte, konnte mit ihrem Segen rechnen. Wie weit Clara Schumanns Nimbus strahlte, zeigt nicht zuletzt, dass Ignacy Paderewski noch 1890 der Schatten Clara Schumanns mehr drückte, als die Konkurrenz einer ihrer besten Schülerinnen, Ilona Eibenschütz, die ihm in London das Terrain streitig machte. Ein weiterer Faktor, sich zu profilieren, war die Entscheidung, grundsätzlich nur mit erstklassigen Bühnenpartnern aufzutreten. In Wien gewann Clara Wieck 1838 mit dem Kammervirtuosen Joseph Mayseder, einem ehemaligen Mitglied des Schuppanzigh-Quartetts, das einen Teil von Beethovens Streichquartetten uraufgeführt hatte, und dem Cellisten Joseph Merk zwei der hochkarätigsten Hofsolisten für ihre Auftritte. Beide hatten sich seit Jahren nicht öffentlich hören und nun von der jungen Kammervirtuosin überreden lassen. Auch in Paris konzertierte sie 1839 mit den »premiers artistes de la capital« wie im Courier Français zu lesen war (Wittkowski, in: Kat., S. 146). Den Violin-Virtuosen und Beethoven-Spezialisten Charles-Auguste de Bériot, mit dem sie 1839 konzertierte, kannte sie bereits aus ihrer Jugendzeit. Er war mit der 1836 verstorbenen Sängerin Maria Malibran verheiratet gewesen. Mit deren jüngerer Schwester, Pauline Viardot-Garcia, trat Clara Schumann immer wieder auf. Auch Wilhelmine Schröder-Devrient, Jenny Lind, später Julius Stockhausen und Amalie Joachim zählten zu ihren bevor-
160
Starkult
zugten Partnern. Seit den 1850er Jahren war dann der Violinvirtuose Joseph Joachim ihr Favorit. Beide verband über die jahrzehntelange Freundschaft hinaus eine ausgesprochen hehre Berufsethik. Popularität u n d P o p u l a r i s i e r u n g Das Verhältnis zum Publikum Bravour-Variationen op. 8, Scherzo op. 10
»Was ist der Künstler viel mehr als ein Bettler? und doch, die Kunst ist eine schöne Gabe! was ist wohl schöner als seine Gefühle in Tone kleiden; welcher Trost in trüben Stunden, welcher Genuß, welch schönes Gefühl so Manchem eine heitere Stunde dadurch zu verschaffen! Und welch erhabenes Gefühl, die Kunst so zu treiben, daß man sein Leben dafür läßt!« Die Berufsdefinition, die die 18jährige Clara Wieck Robert Schumann im Dezember 1837 gab, umreißt zentrale Komponenten ihres Selbstverständnisses als Künsderin. Erhaben in der Ernsthaftigkeit, aber auch in hohem Maße zufrieden damit, durch die Kunst über ein so wirkungsmächtiges emotionales Ausdrucksmittel zu verfügen, das sie selbst ebenso euphorisch stimmen konnte wie andere, erlebte sie ihre Auftritte als beglückend, selbst dann, wenn man »den Leuten fiir ein paar schöne Worte und eine Tasse warm Wasser vorspielen« müsse. Doch »ist es nicht des Künsders Beruf, sein Leben für die Kunst zu geben?« (Bw, S. 59; Jb, 31. März 1840). Sie war fest davon überzeugt, dem Publikum Kunst vermitteln zu können. Diese Berufszufriedenheit bewahrte sich Clara Schumann lebenslang, auch wenn sich mit der Zeit einzelne Parameter ihres Selbstverständnisses als Künsderin verschoben. Der selbst erteilte Auftrag erfolgte vor dem Hintergrund von zwei zentralen Prämissen bürgerlicher Kunst. Kunst sollte nämlich erstens öffentlich und allgemein zugänglich gemacht werden, und sie sollte zweitens der Menschenbildung dienen. Darüber hinaus bot die für ein gemischtes Publikum inszenierte Kunst im Museum oder auf der Bühne ein den Alltag überstrahlendes profanes Fest. Virtuosen agierten dabei als Verkünder und Magier zugleich. Popularität ist ein Phänomen öffentlicher Meinung. Der Pressespiegel veranschaulicht, wie rasch die Künsderin Clara Wieck in den Jahren ihres Durchbruchs an Bekanntheit und Beliebtheit gewann und wie nachhaltig diese Basis trug. Ihre Popularität wuchs mit dem Erfolg. Gerührt beschrieb sie 1840 einen Verehrer, der neun Stunden gelaufen war, nur um sie zu seDas Verhältnis zum Publikum
161
hen. Gleichzeitig belästigte sie immer wieder die zudringliche Schwärmerei einzelner Fans. »Höre, mit dem Keferstein wird mir's auch zu arg! seine Briefe werden mir peu ä peu zum Greuel, denn sein Enthusiasmus kennt keine Gränzen mehr«, schrieb sie 1840 über den Theologen und zeitweiligen Mitarbeiter von Schumanns Zeitschrift (Bw, S. 1105). Der Gewinn ihrer Popularität schlug sich sowohl im Zuwachs an öffentlicher Reputation und künstlerischer Autorität als auch im wirtschaftlichen Profit nieder. Die Künstlerin nutzte ihre Popularität zur Popularisierung von Kunst. Dabei standen die Popularisierungsbestrebungen in einem engen Wechselverhältnis zur immer weiter gesteigerten künstlerischen Professionalität. Die wurde notwendig, wollte man die Kunst nicht bloß als Liebhaberei, sondern beruflich betreiben und sich damit eine bürgerliche Existenz aufbauen. Je intensiver sich die Künstler allerdings spezialisierten und als Experten qualifizierten, desto mehr vergrößerte sich der Abstand zum Publikum. Damit stieg zwar die Faszination, doch wuchs die Gefahr, dass am Ende niemand mehr die einsame Sprache der Künstler verstünde. Der kommunikative Austausch über Kunst, ein Kern bürgerlichen Selbstverständnisses seit dem 18. Jahrhundert, wäre erheblich beeinträchtigt. Kunst und Qualität, Popularisierung und Kommerz funktionierten in einem komplexen Beziehungsnetz, von dem alle Beteiligten zu profitieren hofften. Die professionelle Leistungssteigerung erhöhte den ideellen und materiellen Wert von Kunst. Mit ihren stupenden öffentlichen Darbietungen weckten die Künsder neue Formen des Begehrens und der Teilhabe daran. Popularisierung diente dazu, das Publikum hier einzubinden. Gleichzeitig konnten weitere Hörerschichten angesprochen und neue Absatzmärkte für Musikalien gewonnen werden, wodurch sich die wirtschaftliche Basis der Kunstschaffenden insgesamt verbreiterte. Die aufstrebende Kunstsparte ermöglichte eine hauptberufliche künstlerische Arbeit, wie sie Clara Wieck und Robert Schumann als gemeinsame Lebensperspektive vorschwebte. Mit der Spezialisierung stiegen die Preise. Künstler wie Wieck oder Liszt lebten längst von der Honorierung ihrer Arbeit in konvertierbarer Währung, auch wenn sie in Adelskreisen nach wie vor mit diversen Sach-Geschenken abgefunden wurden. Popularisierungsdebatten begleiteten die Entstehung der bürgerlichen Kunst bereits in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und wurden so vehement wie kontrovers gefuhrt. Dabei setzte man zwei unterschiedliche Erkenntnisformen in Opposition, eine höhere abstrakte auf der einen und eine niedere sinnlich-konkrete auf der anderen Seite. »Hoch« bezog die kleine Elite von wissenden Experten auf sich selbst, als »niedrig« galt eine noch bildungsbedürftige anonyme Masse. Vor diesem Hintergrund entwickelte 162
Starkult
Schiller seine Thesen einer ästhetischen Erziehung der Gesellschaft zur Humanität. Danach sollte der einzelne durch die Konfrontation mit Kunst eine neue Idealität erleben, um ihr nachzustreben. Weitgehend einig war man sich daher über das Ziel, nämlich ein gemischtes Publikum »hinaufzuläutern«. Dessen ästhetische Erziehung sollte dazu befähigen, mit der Zeit die komplexen Zusammenhänge höherer (Kunst-)Wahrheiten zu begreifen. Strittig blieb die Umsetzung. Sollte man das Publikum mit Anspruchsvollstem konfrontieren oder sollte man Kompromisse machen? Und wie könnte das Entgegenkommen aussehen? Ein an der juristischen Diskussion um die Formulierung von Gesetzestexten angelehnter Ansatz ging von einer Vereinfachung der Kunstwerke zu klarer, verständlicher Aussage aus. Ihm stand die aus der theologischen Tradition kommende Auffassung gegenüber, auf das Staunen über das Wunderbare zu setzen, um eine Bereitschaft zum Nachdenken und Verstehen von Kunst aufzuschließen. Damit ließ sich die »Herablassung« zum Publikum im Sinne einer pastoraltheologischen Sendung rechtfertigen (Popularisierung, S. 43ff). Wie der Theologe Johann Christoph Greiling in seiner 1805 publizierten Theorie der Popularität, wies man allgemein den Künsten die Aufgabe zu, in alle zu vermittelnde Bereiche der Religion, Philosophie und Wissenschaft wirksam einzugreifen, denn die Künste, so die Vorstellung, vereinten sowohl abstrakte als auch sinnliche Erkenntnis und bildeten die Mitte zwischen beiden Polen. Eine unmittelbar zu erlebende Umsetzung derartiger Ideen bot die Leipziger Nikolaikirche, in deren Schatten Clara Wieck aufwuchs. Der Innenraum war im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in einen sinnlich erfahrbaren Paradiesgarten umgestaltet worden. Das vormals dunkle gotische Ambiente erhielt eine fantastische, lichte, farbenprächtige Ausgestaltung in weiß, erbsengrün, himbeerrosa und gold. Durch die neuen klaren Fenster flutete helles Tageslicht auf die zu Palmen umgestalteten Säulen. Für den Umbau wurden Künstler der Leipziger »Zeichnung-, Mahlerey- und Architektur-Akademie« engagiert (Czok 1992, S. 67ff). Die Absicht, hoch spezialisiertes Wissen verständlich und lebensnah zu präsentieren, blieb auch im 19. Jahrhundert umstritten. Indessen hatte sich die Position der Künstler als »Agenten der Popularität« (Popularisierung, S. 43) verändert. War das ästhetische Erziehungsideal in der Weimarer Klassik noch utopisch geblieben, und hatten die Frühromantiker die Kunst transzendiert und ins autonome Innere verlagert, so machte sich die junge Avantgarde des Vormärz konkret daran, »die höhere Epoche einer allgemeinen musikalischen Bildung herbeizufuhren«, wie Schumann 1836 optimistisch formulierte (GS 1, S. 167). Zumindest hatten die Künstler im Vormärz durch
Das Verhältnis zum Publikum
163
ihre öffentliche Präsenz die Macht und die Mittel dazu, die bürgerliche Gesellschaft durch ästhetische Erziehung zu verändern. Stars wie Wieck Schumann oder Liszt balancierten als Grenzgänger zwischen der realen und der Wunderwelt. Sie kannten sich aus in den von Chopin als »espaces imaginaires« bezeichneten Fantasiereichen der Kunst (Chopin 1984, S. 226), liefen aber auch durch den Alltag, benutzten öffentliche Verkehrmittel, spazierten im Stadtgarten und verstrickten sich in LiebesafFären, die dann von der Presse geschürte voyeuristische Gelüste bedienten. Die Theaterbühnen und Konzertsäle spiegelten die doppelte Existenz von Wunder- und realer Welt wider. Als repräsentative Neubauten gehörten sie zur städtischen Architektur, an der man täglich vorbeiging. Gleichzeitig entfalteten die kunstgeweihten, oft im Stil der Neorenaissance entworfenen Räume eine erwartungsvolle, besondere Atmosphäre, die die Besucher schon gefangen nahm, bevor überhaupt ein Ton erklang. Schumanns in der NZflW publizierter »Schwärmbrief« über Mendelssohn Bartholdys Debüt als Leipziger Gewandhauschef spielte literarisch mit der ständigen Schwellenüberschreitung vom Realen zum Fiktiven. Allein durch den Eintritt »in den goldglänzenden Saal« umgab den Ich-Erzähler Eusebius das »Zauberland der Musik«. Er sah im Fieber der Vorfreude »Mozart, wie er mit den Füßen stampft bei der Sinfonie, daß die Schuhschnalle losspringt, dort den Altmeister Hummel phantasierend am Flügel [...] Meine Betrachtung unterbrach die plötzliche Todtenstille des Publikums. F. Meritis [= Mendelssohn] trat vor. Es flogen ihm hundert Herzen zu im ersten Augenblicke« (GS 1, S. 116f). Dann setzte die Musik ein. Zum gewandelten Aufklärungskonzept der Vormärzkünstler gehörte es, anstelle rationaler Kategorien wieder das Wunderbare zu verstärken. Im sich gerade erst etablierenden Konzertbetrieb galt es immer noch, überhaupt ein Publikum in die Veranstaltungen zu locken und Musik als eigenständige Kunst bekannt zu machen. So entfachten die Virtuosen einen emotionalen Sturm, der darauf angelegt war, das Publikum mitzureißen. Dazu spielten sie ihre auratische Macht aus. »Wie sie alle mit zurück gepreßtem Atem lautlos horchten, als wollten sie die Sirenentöne von ihren Lippen schlürfen«, so Schumann über einen Auftritt der Sängerin Francilla Pixis 1835. Der Rezensent hörte »den Tick-Tack der Herzen und sah heimliche Seufzer und seliges Lächeln über die Seelen schweben«. Ein hinter ihm stehender »Kontomann« verjüngte sich gleich um 20 Jahre und fühlte sich »an jene warme Jugendzeit voll glücklicher Liebesschmerzen erinnert«. In einer Art komischer Verzweiflung registrierte der Erzähler Florestan irritiert an sich selber, wie die 164
Starkult
Gefühls- und Geschmackskontrolle während der Aufführung versagte und er »bei einer miserablen Arie von Donizetti« wider Willen Tränen vergoss (in: GS 2, S. 282f). Die durch die Aufführung der Musik als Hochstimmung erlebte emotionale Überwältigung im Konzert, die in Schumanns Rezension am Beispiel des Bankiers als glückliches Wiederfinden eines seit Jahren verschütteten Gefühls beschrieben wurde und auch den Ich-Erzähler selbst ergriff, war der Schlüssel zum Erfolg. Die Stimmung schaukelte sich zu einer intensiven Gemeinschaftserfahrung hoch. Dadurch steigerte sich die Auffuhrung zu einer quasireligiösen Masseninszenierung, in der der Einzelne in eine magische Szenerie eintauchte und »zum Element einer Gemeinde, einer Menge, eines strukturierten Gemeinschaftskörpers« wurde, eine Wirkung, die, so Hartmut Böhme, nicht nur bei künstlerischen, sondern auch bei politischen und religiösen (heute auch bei sportlichen) Veranstaltungen ausgelöst würde (Böhme 2006, S. 255ff). Bewusstes Erleben und physischer Mitvollzug spielten eine zentrale Rolle. So ließ sich das Kunstereignis mit Wertungen verknüpfen, die nicht auf der gehörten Musik allein, sondern auf dem »Gänsehaut-Feeling« der gesamten Veranstaltung fußten. Auf dem Konzertpodium heizten die Künstler die kollektive Begeisterung an und übertrugen ihren Uberschuss an Energie. Dieser Effekt wurde bereits in älteren Theater- und Affekttheorien als »Ansteckung« diskutiert. Ansteckung beziehungsweise »Affizierung« basierte auf der Beobachtung, dass die Zuschauer auf die Illusion der Bühnenereignisse unwillkürlich physisch reagierten, mit Atemverhalten, Herzklopfen, Tränen, Unruhe oder spontanem Beifall, und dass sie sich auch untereinander ansteckten. An der somatischen Wirkung demonstrierte man traditionell die magische Kraft der Musik. Während der Aufführung verschmolz (idealerweise) die eigene Hochstimmung der Darstellenden mit der des Auditoriums und beide potenzierten sich. Diesen interaktiven Fluss beschreibt Erika Fischer-Lichte als eine »selbstbezügliche und sich permanent verändernde feedback-Schleife« (Fischer-Lichte 2004, S. 19 und lOlff; Ansteckung, S. 35ff). Sie während der Aufführung auslösen und in Schwung halten zu können, definierte die Macht der Künsder über ihr Publikum - selbst über die allmächtige Staatsführung (Kaiser und Kanzler), die in den Logen saß. Für das Gelingen der von Clara Schumann als »Anima« (Tb 2, S. 115) bezeichneten besonderen Aufführungsatmosphäre gab es allerdings keine Garantie. Wenn es glückte, den gesamten Saal in Wallung zu bringen, so verschweißte beide Seiten ein intensives Erlebnis. Das Glückserlebnis steckte sowohl in der Wirkung, die die Musik ausübte, als auch in der lustvollen
Das Verhältnis zum Publikum
165
Hingabe an das Musizieren. Die von Mihaly Csikszentmihalyi als »Flow« beschriebene Euphorie beruhte darauf, eine technisch und mental schwierige Höchstleistung vollbracht zu haben, gepaart mit dem »erhabenen Gefiihl«, so Clara Wieck, dem Publikum etwas Bedeutendes gegeben zu haben. Die prickelnde Mischung von Allmacht und Glück konnte zur Sucht werden. Sie machte die Künstler nicht nur ökonomisch, sondern auch psychisch vom Publikum abhängig. Wenn das kollektive Erlebnis gelang, so bestand für einen Moment eine fast mystische Verbundenheit mit der Welt. Stars wie Clara Wieck oder Franz Liszt hatten diese Wirkung bereits als Kinder ausgekostet. In einer Zeit, in der Künstler wie Intellektuelle politisch weitgehend ohnmächtig waren und sich wirtschaftlich mühsam hocharbeiteten, dürften sie ihre magische Potenz umso genussvoller erlebt beziehungsweise deren Verlust umso frustrierter betrauert haben. Die derartige Eroberung des Publikums erforderte geballten körperlichen Einsatz und große mentale Konzentration. Konzerte geben kostete Kraft. Man wüsste noch zehn Minuten vorher nicht, »ob man [das Publikum] gewinnen oder unterwerfen« müsste, so Liszt. Er wählte dafür Metaphern aus der Schwerindustrie. Das »große« Publikum gliche »einem Meer von Blei«. Es wäre »nur im Feuer zu schmelzen und nicht minder schwer zu bewegen«. Die Massen »verlangen den mächtigen Arm einer athletischen Kraft, um in eine Form gegossen zu werden, unter der das flüssige Metall plötzlich zum Ausdruck einer Idee, einer Empfindung« würde (Liszt 1981, S. 120). Und auch Clara Wieck deutete ihrem Bräutigam an, dass er in seinem gemütlichen Leipziger Stübchen eigentlich nicht einschätzen könnte, was sie auf dem Podium tatsächlich leistete (Bw, S. 418). Als Schumann dann Liszt 1840 erlebte, ließ er sich vollkommen mitreißen. »Es ist nicht mehr Clavierspiel dieser oder jener Art, sondern Aussprache eines kühnen Charakters überhaupt, dem zu beherrschen, zu siegen das Geschick einmal statt gefährlichen Werkzeugs das friedliche der Kunst zugetheilt hat« (GS 1, S. 480). Chopin dagegen machte die Präsenz der erwartungsvollen Zuhörerschaft »scheu«, wie er Liszt gegenüber behauptete. Er fühlte sich von ihrem Atem »erstickt« und von den »neugierigen Blicken paralysiert« (in: Samson 1991, S. 29). »Ob ich dem Publikum gefallen weiß ich nicht«, notierte sich Clara Wieck nach einem Konzert in Hamburg 1840 verstört, »denn es ist hier Sitte, daß nicht geklatscht wird. Das ist schrecklich für den Künstler, er weiß ja gar nicht, woran er ist, und ist ja das auch gar nicht ermuthigend«. Sie begann zu zweifeln, ob sie schlechter geworden sei. »Oder ist es blos die Aufmunterung eines Publikums, das mir fehlt, um mich wieder zu entflammen?« Im Frühjahr 1840 166
Starkult
schwebte sie deswegen »halb im Dunkeln über mich, so viel ich auch grüble« (Jb, 19. Februar und 17. Juni 1840). Dabei verfügte sie über die Mittel, mit denen eine »feedback-Schleife« in Schwung gebracht werden konnte, und sie kannte die Erfahrung, wie Bauch- und Kopfschmerzen oder sogar Schwindelanfalle während des Spiels verflogen. Auch als Hörerin registrierte Clara Wieck den durch die Musik ausgelösten Enthusiasmus. »In mir tönt noch die ganze Musik - das war wieder einmal ein Hochgenuß!« schrieb sie über eine FidelioAufRihrung in Berlin 1840, und nach einem eigenen Auftritt mit Beethovens Klaviertrio op. 70 hielt sie fest: »Bei dem Adagio vergißt man ganz sich und das Ciavier vor dem man sitzt, mir wird ganz eigen zu Mute dabei, als schwebte ich auf Wolken« (Jb, 25. November 1839). Ihre »trockenen« und schleppenden Mitspieler holten sie allerdings schnell wieder aufs Parkett zurück. Später wusste Clara Schumann sehr genau die inneren und äußeren Interaktionen zu steuern. Immer wieder taucht in ihren Aufzeichnungen die Bemerkung »sehr animirt« auf, mit der sie sowohl ihre eigene Motivation als auch die auf sie zurück wirkende Publikumsreaktion kennzeichnete. Schon der Eingangsapplaus trug dazu bei. Dabei steigerte der Erfolg die eigene Leistungsmotivation erheblich. Die Künstlerin hat im Laufe ihres Lebens immer wieder bekundet, wie stark die Reaktion des Publikums auf ihr Spiel zurückwirkte und ihr »Flow« wiederum das Publikum beeinflusste. »Ich begreife es nicht, wo mir die Begeisterung immer wieder her kommt und oft ist's so wonnevoll süß durchschauernd, daß ich's nicht begreifen kann«, gestand sie Kirchner nach einer bejubelten Aufführung von Beethovens EsDur-Konzert op. 73 in Köln 1863, »in solch einem Moment möchte ich mal sterben können« (Kirchner, S. 149). Umgekehrt registrierte sie fassungslos, wie das Detmolder Publikum »beinahe teilnahmslos« blieb bei einer Auffuhrung von Mozarts A-Dur-Klavierkonzert (KV 488?), bei dessen Einstudierung sie selber zutiefst emotionalisiert war. »Es braucht doch weiter nichts als natürliches Empfinden«, schrieb sie Joachim (Joachim 2, S. 129). Folgt man den bei Litzmann wiedergegebenen Tagebuchauszügen, so scheint Clara Schumann immer wieder einen berauschenden »Flow« erlebt zu haben (von gelegentlichen Reinfällen abgesehen). Daher sagte sie Auftritte und Tourneen nur dann ab, wenn gar nichts mehr ging, wie bei den Uberlastungsbeschwerden 1872 und 1873, die sie zu monatelangem Pausieren zwangen. Selbst als sie 1883 in Berlin nach einem Sturz durch eine Kopfverletzung, Quetschungen und Hämatom so lädiert war, dass sie keine Doppelgriffe machen konnte und zunächst »in Angst« und »mit viel Schmerzen beim Spielen« auftrat, wirkte auch hier das Selbstheilungswunder. »Schon der Enthusiasmus, der Minuten lang anhielt, ehe ich mich ans Ciavier setzen
Das Verhältnis zum Publikum
167
konnte, war fast überwältigend. Das Ciavier war mit einem riesigen Lorbeerkranz geschmückt«. Im Konzert, »das ich sehr glücklich trotz aller Schmerzen spielte«, vergaß sie »Angst und Sorgen«. Eine »Blumenexplosion« (anstelle eines Terroranschlags, der in der Stadt befurchtet worden war) bereitete ihr das Londoner Publikum 1884, so dass sie ihre »Schmerzen in den Brustmuskeln« vollständig verdrängte (in: Litzmann 3, S. 443f. und 452f). Danach verbrachte sie allerdings eine qualvolle schlaflose Nacht und erwog ernsthaft, sich von der Bühne zu verabschieden. Ihr glückliches Aufgehen in der Kunst und die existentielle Bedeutung der Publikumskommunikation erschien so ungewöhnlich, dass schon Clara Wieck sie Robert Schumann gegenüber erklären musste und sie mit ihrer tiefen Uberzeugung, eine quasireligiöse Sendung zu erfüllen, verteidigte. In der für selbständige Frauen restriktiveren zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Clara Schumann ihren Handlungsrahmen sogar noch ausweitete, anstatt als Witwe und inzwischen ältere Frau in den Hintergrund zu treten, setzte sie sich auch der massiven Kritik ihrer engsten Vertrauten aus. Brahms, genervt von den dicht gedrängten Tourneeplänen der Virtuosin und den winzigen Zeitfenstern, die ihnen gemeinsam blieben, riet ihr wiederholt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er provozierte damit eine tiefe Verstimmung, die Clara Schumann zu einer Grundsatzerklärung veranlasste: »Eigenthümlich erscheint mir aber Deine Anschauung des Concertreisens! Du betrachtest es nur als Verdienst, ich nicht; ich fühle mich berufen zur Reproduktion schöner Werke [ . . . ] Die Ausübung der Kunst ist ja ein großer Theil meines Ichs, es ist mir die Luft, in der ich athme«. Um »die Ruinen, die vielleicht von meinem Freundschaftstempel noch stehen,« zu retten, lenkte Brahms überstürzt ein, während Clara Schumann »noch einen besonderen Sporn« spürte und nun umgekehrt Brahms einlud, mit ihr zusammen aufzutreten, was in Oldenburg am 30. Oktober 1868 auch geschah {Litzmann 3, S. 215ff). Der Überschuss an performativer Energie sorgte offenbar noch in fortgeschrittenem Alter für die »Frische« ihrer Auftritte. Kein Wunder also, dass sie, die durchaus gnadenlos die Alterschwächen ihrer Kolleginnen und Kollegen beobachtete und den 46jährigen Moscheies 1840 als »überlebt« abqualifizierte (Tb 2, S. 114), sich selber nicht vom Podium verabschieden konnte. Solange sie populär war, sah sie keine Veranlassung dazu. Davon abgesehen erwirtschaftete sie tatsächlich den Lebensunterhalt für Kinder und Enkel. Von Gelenkschmerzen behindert und durch erhebliche Schwerhörigkeit kommunikationsreduziert, notierte noch die Vierundsiebzigj ährige 1894, wie sehr ihre Lebensener168
Starkult
gie vom Spiel abhing. »Was soll aus mir werden wenn ich nicht mehr spielen kann? vielleicht auch nicht mehr unterrichten?« (in: Litzmann 3, S. 578). Bereits in den 1830er Jahren fokussierte Clara Wieck ihren Ehrgeiz darauf, den Publikumsgeschmack zu korrigieren. Allerdings erzielte niemand durchschlagende Wirkung mit hehrer Absicht und geschickter Überredungskunst. Die Ende des 18. Jahrhunderts veranstalteten belehrenden »Ignoranten«und Kinderkonzerte oder Nikolaus Forkels begleitende Vorlesungen an der Göttinger Akademie waren einer älteren, auf Vernunft basierenden Aufklärung gefolgt. Bei dem aktuellen Popularisierungsansatz von Clara Wieck hingegen sollte die emotionale Verfuhrung elektrisieren. Die Fähigkeit, das abstrakte Konzept einer autonomen, das heißt ohne programmatische oder bildhafte Inhalte als Kunst entworfenen Musik überhaupt verfolgen zu können, erforderte einen langen Hörerziehungsprozess. Vor diesem Hintergrund dürfte die bis Mitte des 19. Jahrhunderts übliche Praxis, eine möglichst große Vielfalt kürzerer Nummern im Konzert anzubieten, mehrere Ziele verfolgt haben. Man konnte auf diese Weise sehr viel »Kunst« aus allen Sparten überhaupt kennen lernen. Die Abwechslung sollte unterhalten. Außerdem nahmen die Virtuosen mit den häppchenweise servierten Sonaten und Sinfonien auf die Konzentrationsfähigkeit des Publikums Rücksicht. Artifizielle Musik, die man nicht selbst aus Klavierauszügen spielte, konnte nur in Konzerten kennen gelernt werden. Das damalige Auditorium verfugte oft über zu wenig einschlägige Hörerfahrung, um nun individuelle Musikstile beziehungsweise Qualitätsgrade wirklich unterscheiden zu können. Schon damals orientierte man sich daher vorsichtshalber an großen Namen. So kam es vor, dass ein irrtümlich für eine Komposition von Beethoven gehaltenes Klaviertrio von Pixis oder Henselt enthusiastisch gefeiert und das unter falscher Ankündigung gespielte Original (etwa das so genannte »Erzherzog«-Trio op. 97) aber nicht erkannt, sondern als »kalt, mittelmässig und langweilig« beurteilt wurde. Liszt foppte seine Zuhörer mit Vergnügen, indem er dasselbe Stück mal als Beethoven, mal als Czerny, mal als Liszt spielte und dementsprechend »Bravos«, Gleichgültigkeit oder »aufmunterndsten Beifall« erntete. Auch Clara Wieck leistete sich gelegentlich diesen Spaß (Jb, 21. Oktober 1837; Schiwietz 1994, S. 103, Seibold 2005,1, S. 313). Doch nicht die Experten, wie noch im klassischen Kunstkonzept, sondern die »Enthusiasten« bildeten die Zielgruppe. Ein Virtuose dürfe nicht glauben, »in einem öffentlichen Concerte ausschließlich von Musik-Kennern gehört zu werden. Es war des Ernsten, wenn auch an sich noch so gediegenen vor einer Zuhörerschaft, deren Majorität aus Musik-Liebhabern besteht,
Das Verhältnis zum Publikum
169
allzu viel; des Galanten und Schimmernden, Allen Zugänglichen - Allzuwenig« monierte der Kritiker des Freischütz nach einem Auftritt Clara Wiecks 1837 (8. April). Drei Jahre später verschärfte die Zeitung ihre Warnung noch einmal und sprach die Künstlerin direkt an: »Verehrte Clara! Mendelssohns Capriccio in H-moll ist, seines intensiven Gehaltes unbeschadet, kein Verwurf für den Concert-Saal«. »Dein Auditorium ist gemischt aus Laien zu % und Kennern zu höchstens V4«. Soviel die Kenner von den »Abstracta« in ihrem Repertoire profitierten, so gering sei der Ertrag für die Laien. Sie hätten »viele Noten, aber keinen eindringlichen Gedanken gehört [...], und da sie die Schwierigkeit der Ausführung auch nicht entfernt zu würdigen wissen, so ist ihr Genuss rein - Null!« Beethoven, Chopin und Mendelssohn gehörten danach nicht in diese allgemein öffentlichen Veranstaltungen (Freischütz, 15., 22. Februar und 14. März 1840). Zeitgenössische Hörertypologien zeigen, dass dieses Ideal noch bis in die 1870er Jahre wirksam blieb. Die Begeisterten standen an der Spitze, gefolgt von den »Unterhaltungshörern« und den Kennern, die »blos mit dem Verstände« hören (Rochlitz). Als »Kunstenthusiasten« bezeichnete Friedrich Rochlitz in Anlehnung an Jean Paul 1799 alle, die mit dem Herzen und »mit ganzer Seele« hörten. Schließlich löste erst diese innere Beteiligung den über den sinnlichen Eindruck hinaus gehenden Bildungsprozess aus, der notwendig war, um zur Erkenntnis vorzudringen. Während Kenner und Kritiker die Musik oft allzu rational verfolgten, um sie genießen zu können, und auch zu »verbildet« waren, um Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein, investierten die »blos mit dem Ohre« Hörenden zu wenig Herzblut, da sie ausschließlich Zerstreuung suchten. Bei diesen setzte die Konzertpädagogik an. Als indiskutabel schieden lediglich die aus Prestigegründen anwesenden »Schaulustigen« (Rochlitz) aus, zu denen auch Teile der »elegante[n] Modewelt« gehörten (Fuhrimann 2005, S. 47fF). Allerdings machten sie einen Teil der zahlenden Abonnenten aus, und Künstler blieben auf sie angewiesen. Bei den »Pietätlosen«, zu denen auch bornierte Kenner gehören konnten, schien die Lage dagegen aussichtslos. Erholung, Unterhaltung und Genuss waren gleichsam als Relikte aus dem Nützlichkeitsdenken der Aufklärung anfangs durchaus gelitten, sofern man bereit war, sich »neugierig« der Kunst zu öffnen und sich auch hierin weiter zu bilden, wie Hans Georg Nägeli 1826 empfahl (in: Gruhn 2003, S. 103). Programme sollten deswegen mehrere Einstiegsmöglichkeiten bieten, so jedenfalls diskutierte man die Popularisierung im Vormärz. In den Konzertveranstaltungen der 1830er bis 60er Jahren lässt sich die in den einschlägigen ästhetischen Schriften längst behauptete und jetzt praktisch umgesetzte Aufwertung von Musik als Kunst gut beobachten. Hier 170
Starkult
zeigen sich deutliche Parallelen zu der ein Jahrhundert zuvor in den deutschen Ländern erfolgten »Literarisierung des Theaters« (Roselt 2005, S. 19ff). Damals galt es, einerseits die auf die Bühne gebrachten Stücke literarisch anspruchsvoller zu gestalten. Dieser Aspekt forderte die Autorinnen und Autoren zu qualitativ höherwertigen Arbeiten heraus. Gleichzeitig wurde von den Darstellenden nun verlangt, dass sie nicht bloß mit dem ganzen Stück gut vertraut waren. Vielmehr sollten sie ihre Rollen auswendig lernen, sich an den dichterischen Text halten und das Drama wörtlich, ohne eigene improvisierte Änderungen wiedergeben. Zur Erziehung der Ausfuhrenden hatte das Mannheimer Nationaltheater 1781 sogar einen Straftarif erlassen. »Wer in seiner Rolle Aenderungen oder Zusätze zum Nachtheil des Stücks macht, unsittliche Theaterspiele anbringt, Possen macht, bezahlt den achten Theil seiner wöchentlichen Gage« in einen Sozialfond. Allein im November jenes Jahres wurden drei Schauspieler verurteilt. Diese Disziplinierungsmaßnahmen dienten dem wirkungsästhetischen Ziel der Bühnenkunst, denn die »Tragödie«, so hatte Gottsched schon 1729 behauptet, »schicket ihre Zuschauer allezeit klüger, vorsichtiger und standhafter nach Hause« (in: Roselt 2005, S. 23 und 19). Dem widersprach Goethe entschieden: Vielmehr versetzten Tragödien »das, was wir Herz nennen, in Unruhe« (Goethe, Werke 6, S. 236). Ein entsprechender Wandel vollzog sich im 19. Jahrhundert im Konzertsaal. Je hermetischer in den ästhetischen Diskursen »Meisterwerke« herausgehoben wurden, um sie gleichsam im Schrein der »heiligen« Tonkunst aufzuheben, desto mehr Andacht und Ehrfurcht wurde von den Virtuosen und vom Publikum erwartet. Parallel dazu schwand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch das Publikumsinteresse an virtuosen Schauelementen auf der Bühne. Unter den Künsdern und Kunstkritikern waren sie sogar verpönt. In einem Umfeld, in dem Affektkontrolle nicht allein als psychischer, willentlicher Vorgang galt, sondern mit einer Auf- beziehungsweise Abwertung der biologischen Persönlichkeitsdisposition verknüpft wurde, wollte niemand aus der Kunstgemeinde herausfallen. Die wirbelnden Entertainer wanderten in andere Spielstätten ab, die als Unterhaltungsbühnen einer neuen »Trivial«-Kultur eine zweite Ebene öffentlicher musikalischer Darbietungen boten und ihr eigenes Publikum anzogen (Sennett 2004, S. 221ff.; Maase 1997, S. 16f). Mit der soziographischen Verschiebung änderten sich auch die Ziele von Popularisierung. Man verpflichtete sich auf die Verbreitung nur der »allerbesten Kunst« wie Clara Schumann ihren Mitstreiter Joseph Joachim einschwor (in: Joachim 2, S. 190) und leitete damit eine Beschränkung und Verfestigung des Repertoires zu einem Kanon kulturell wertvoller »Meisterwerke« ein. Allerdings funktionierte das Publikum nicht einfach als Box, in Das Verhältnis zum Publikum
171
die die Künstlerin eine Botschaft einspeiste, die dann ihren Intentionen entsprechend aufgenommen wurde, wie das bekannte an der Nachrichtentechnik orientierte Sender-Empfänger-Modell suggeriert (Winter 1995, S. 6ff). Das Publikum bewertete nicht unbedingt die ästhetische Autonomie eines Stücks, sondern dessen Wirkung. Sie konnte kognitiv (gut gemacht), emotional (löst Rührung oder Erinnerung aus), sensualistisch (klingt gut) oder hedonistisch (macht Spaß) erfolgen oder auch entsprechend vermisst werden. Im kollektiven Urteil schlug sich außerdem Ansehen und Bekanntheit des Komponisten sowie der Virtuosin als Vermittlungsperson, die Aufführungssituation, etwa die Stimmung im Saal, und das Prestige des Spielorts nieder. Schließlich entstand auch die Bedeutung, die den aufgeführten Werken dann zugewiesen wurde, in einem interaktiven Kommunikationsprozess zwischen Star und Publikum (Bedeutung, passim; Winter 1995, S. 15). Selbst wenn sich Clara Schumann gelegendich der verbalen Publikumsverachtung von Brahms und Joachim anschloss, so blieb ihr Verhalten dem Auditorium gegenüber insgesamt doch verbindlich. Liszt, der als Virtuose bereitwillig ein Sensationsbedürfnis bedient und großzügig während der Aufführungen mit dem Auditorium geflirtet hatte, verachtete am Ende sich und sein Publikum dafür. Umgekehrt verhielt sich später Hans von Bülow. Er predigte Musik wie eine verordnete Kulturbotschaft rücksichtslos von oben herab. Auch dafür fanden sich begeisterte Zuhörer. »Wie Sie da standen, Schlachtenlenker, ein Diktator der Tone«, jubelte Ferdinand Lassalle 1863 und bestätigte von Bülows eigene Auffassung: »Was wir brauchen, ist ein musikalischer Despotismus, eine furchtbare Autorität, der die Gemeinheit der Individuen nicht aufkommen läßt oder doch wenigstens dämpft« (in: Geck 1989, S. 283ff). Auch Brahms grenzte sich eher unwirsch vom Auditorium ab und hätte dessen Reaktion am liebsten ignoriert, was nicht gelang. Sein Spiel gleiche »der herben Cordelia, die ihr bestes Gefühl lieber verschweigt, als den Leuten preisgibt«, so Hanslick {Concertwesen 2, S. 257). Clara Schumann reagierte unterschiedlich auf das Feedback aus dem Saal. Mal behielt sie ihr Repertoire trotzig bei und war unzufrieden, wenn die Konzertbesucher ihr nicht folgen konnten, mal korrigierte sie es behutsam, indem sie Stücke austauschte oder anders im Programmablauf einbettete. Meist wählte sie letztere Variante. Die Verständigung war ihr wichtig. Offenbar brauchte sie wie Liszt die Sympathie ihres Publikums als Stimulans, um zur Hochform aufzulaufen. So spielte sie am 17. März 1873 zum ersten Mal in London das »Emoll Präludium und Fuge von Bach, das einen solchen Eindruck aufs Publikum machte, wie ich es nicht für möglich gehalten hatte - ich war aber sehr inspirirt dabei, wie selten bei Bach, wenn ich ihn öffentlich spiele, weil er eine enorme 172
Starkult
Anspannung aller Seelenkräfte verlangt« (in: Litzmann 3, S. 286f). Gleichwohl wusste Clara Schumann zu berücksichtigen, dass auch die nach höheren Idealen strebenden neuen gehobenen Bürgerschichten der gründerzeidichen Industriegesellschaft nach Feierabend einer anspornenden Begeisterung sowie inspirierender Unterhaltung und nicht bloß der Belehrung bedurften. Die Frage, ob und in welchem Umfang das Publikum mit neuer Musik konfrontiert werden sollte, war nicht pauschal zu entscheiden. Im Vormärz zählten eine vorsichtige Dosierung avantgardistischer Literatur, deren geschickt platzierte Präsentation sowie eine möglichst häufige Wiederholung zu Clara Schumanns konzertpädagogischen Strategien. Es konnte schief gehen. Den Misserfolg der Uraufführung von Schumanns g-Moll-Sonate op. 22 kommentierte Hieronymus Truhn in seiner Rezension 1840 als heftige Überforderung. So atemberaubend komplexe Stücke müsste man öfters hören, um darüber urteilen zu können - ein bis heute aktuelles Argument im Umgang mit Neuer Musik. Dass dies selbst unter Experten galt, artikulierte Schumann 1841 am Beispiel von Chopin. Dessen neueste Stücke stießen nach seiner Meinung doch an die Grenzen des Vermittelbaren. Einige von Chopins Préludes op. 28 hielt Schumann - von blühenden Ausnahmen abgesehen - in ihrer fragmentarischen Kürze und Radikalität so wenig für kommensurabel wie die b-MollSonate op. 35. Die Stücke gingen ins Extrem und wären nicht geeignet fur den Konzertsaal (GS 1, S. 127 und 418; GS 2, S. 12). Um neue Musik einzuführen nutzte die Virtuosin auch Anfang der 1860er Jahre noch das bewährte Verfahren, zunächst einen Kreis von Experten (»die Besten«) zu überzeugen, bevor sie dann ein allgemeines Publikum damit konfrontierte. Wenn man etwas erreichen wollte, so müsste man bei den Künsdern beginnen. In Paris lud sie 1862 »einige Musiker« ein, »um ihnen nur Brahms vorzuspielen. Erst hielt es etwas schwer, ihre Theilnahme zu wecken«, mit dem Sextett op. 18, »erwärmten sie sich«, und am Ende »waren sie Feuer und Flamme«. »Es kann mich so innig freuen, wenn Musiker, die die Musik so ganz und gar zu ihrem Handwerk machen müssen, warm werden! Das ist doch eine Befriedigung, die Einem kein Publicum geben kann« (in: Brunner, S. 337; Litzmann 3, S. 121 und 197). Praktische Tipps für wirkungsvolle Programmkonzepte bot Friedrich Wieck. Er schlug den Künstlern vor, die Konzerte so einzurichten, »dass Sie das Publicum zu sich hinaufzuziehen suchen, so dass Sie das Ernsthafte und viel Aufmerksamkeit Verlangende im ersten Theil geben«. Die Zuhörer wären da noch »am frischesten und empfänglichsten«. Im zweiten Teil dürfte es dann brillant werden. Aber: »Ein Concert muß kaum zwei Stunden dauern - lassen Sie lieber Ihre eigenen Compositionen weg«. An diese Empfehlungen hielt sich Clara Schumann lebenslang (KuG, S. 203). Sollte eine Das Verhältnis zum Publikum
173
Popularisierung anspruchsvoller artifizieller Musik gelingen, so musste nicht allein die ästhetische Qualität der einzelnen Nummern stimmen, sondern man brauchte auch eine kluge Dramaturgie. Das war ihre Spezialität. Neben dem mentalen Anspruch spielte bei der Platzierung der Stücke auch deren Charakter eine Rolle. Schließlich sollte sich die Wirkung nicht wechselseitig aufheben. Dabei floss auch der technische Schwierigkeitsgrad für die Virtuosin sowie die unterschiedliche Kraft und Konzentration, die manche Stücke kosteten, in das dramaturgische Konzept ein. Sie könnte »am Schlüsse eines Concertes kein ernstes Werk mehr mit ganzer Frische spielen, noch weniger das Publikum es genießen«, so Schumann an Joachim am 12. November 1864. Daher schlug sie vor, Beethovens Violinsonate G-Dur op. 96 an den Anfang zu stellen. Nach Eugenie Schumann besaß ihre Mutter ein Notizbuch mit Einträgen über Dauer und Tonart der Stücke, das sie »bei allen Programmentwürfen zu Rate« zog (E. Schumann, S. 262). Leider hat sich bislang kein weiterer Hinweis auf dessen Verbleib gefunden. Die größte Attraktion ihrer Konzerte dürfte vom Publikum indessen nur subkutan erfahren worden sein, nämlich der spezifische, für Anlass und Ort ausgewählte lebendige Rhythmus des Ablaufs. Clara Schumann arrangierte und gruppierte die einzelnen Programmnummern zu größeren Einheiten, die sie durch improvisierte Vorspiele und Uberleitungen verband. Damit bot sie einerseits die gewünschte Abwechslung, verhinderte andererseits aber eine beliebig wirkende Buntscheckigkeit. Ein beabsichtigter Nebeneffekt war darüber hinaus die Einbindung der oft als »sperrig« und »schwierig« empfundenen neuen Musik. Nicht zuletzt wurden die immer wieder beschriebenen emphatischen Konzerterlebnisse neben der Faszination, die die Virtuosin durch ihre stupende Kunstfertigkeit erregte, auch durch die spezifische Präsentationsform hervorgerufen. Diese Praxis war vermutlich nicht Clara Wieck Schumanns Erfindung. Sie perfektionierte sie aber offenbar erfolgreich. Anton Rubinstein dürfte sie von ihr übernommen haben. Seine Improvisationen fanden in ihren Augen indessen wenig Gnade: »Es kam mir so unkünstlerisch vor, sogleich über das Ciavier hinwegzufahren in Sexten und Terzenläufen« (in: Litzmann 3, S. 20). Zusätzlich spielten bei den unterschiedlichen Popularisierungsstrategien der kulturelle Kontext und spezifische lokale Traditionen eine wichtige Rolle. Deswegen wurden die Erfahrungen Ortsansässiger bei der Auswahl des Repertoires berücksichtigt. Die Virtuosin nutzte sie als »Thermometer«: »Solche geben den besten Maßstab fürs Publicum« (in: Litzmann 3, S. 255). Was in London ankam, musste nicht automatisch auch für Hamburg, Berlin oder Paris taugen.
174
Starkult
Clara Wieck komponierte 1837 und 1838 zwei unterschiedliche Stücke fiir ihr Repertoire, mit denen sie ihr Auditorium zum Zuhören bewegen wollte. Ein Stück, das die spontane Aufmerksamkeit der opernbegeisterten Menge wecken sollte, waren die Adolph Henselt gewidmeten Variations de Concert pour le Piano-Forte sur la Cavatine du Pirate de Bellini op. 8. Clara Wieck nahm sie auf der Tournee 1837/38 nach Prag und Wien als Zugnummer mit. Die Variationen erfüllten gleich mehrfach die Vorzüge eines mitreißenden Hits. Themen aus Bellinis Opern, hier II Pirata von 1827, gehörten zu den populärsten Melodien der Zeit. So konnten auch musikalisch nicht vorgebildete Besucher das Thema erkennen (jedenfalls erahnen) und die Variationen verfolgen. Dass das Stück ein geballtes Feuerwerk an innovativer virtuoser Klaviertechnik entfaltete und mit seinen brillanten Lauf- und intrikaten Sprungfiguren sowie dem vollgriffigen Satz in beiden Händen bis an die Grenzen des auf dem Klavier noch Realisierbaren ging, dürften zwar nur die Fachkollegen im Detail zu würdigen gewusst haben. Für die allgemeine Hörerschaft übertrug sich dennoch das Außergewöhnliche der Darbietung in der Ausdrucksvielfalt und dem tonreichen Klangspektakel. Die Attraktion des Sujets wurde im zeitgenössischen Kontext noch dadurch erhöht, dass sich eine ganze Generation hingebungsvoll für Bellini begeisterte. Der Komponist war 1835 im Alter von 34 Jahren gestorben. Auch Clara Wieck schwärmte. Beharrlich versucht sie, ihren Bräutigam davon zu überzeugen, dass »doch Bellini ein talentvoller Componist« sei. Doch Schumann winkte ab. Ehe »Du mich dazu bringst, daß mich solche Musik beglückt, [...] siehst Du mich durch eine Nähnadel krauchen« (Bw, S. 418 und 442). Die Introduktion des Stücks fuhrt in rezitativartigem Erzählton in die dramatische Sphäre der Oper ein, aus deren Kontext das Variationsthema stammt. Die Melodie »Ma non fia sempre odiata« erklingt in der Oper kurz vor der finalen Katastrophe. Der Pirat bittet in einer schlichten C-Dur-Cavatine, seiner betrogenen Liebe zu gedenken. Clara Wieck variiert die einzelnen Wiederholungen der Zeilen unterschiedlich und bezieht auch das Ritornell in die Variationen ein. Auf diese Weise gelingt ein reichhaltiges Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten. Der Eindruck einer großartigen, quasi-orchestralen Dichte entsteht durch die Ausnutzung aller Register im Klavier und die Ausfüllung des Tonsatzes durch weit gespreizte Akkordfiguren, die die Klangräume aufspannen, sowie Phrasen von partieller Mehrstimmigkeit in den Mittelstimmen - eine Technik, die Chopin perfektioniert und Thalberg zum pianistischen Standard erhoben hatte. Wer die Oper kannte, wusste, dass nach der Cavatine ein Orchesterzwischenspiel die im Wahnsinn zerbrechende, auf der Bühne umhertastende
Das Verhältnis zum Publikum
175
Hauptfigur, Imogene, begleitete. In Wiecks Stück klingt der zweite Teil der dritten Variation an dieser Stelle an. Das hier eingeschobene Adagio in AsDur steht in starkem Kontrast zur Bravour der übrigen Variationen. Wolfgang Held bezeichnet es einnehmend als »Claras Tombeau für den jungen Bellini« (Held 2007, S. 256). Die Passage besticht durch ein harfenartiges, impressionistisch-zartes Klangnetz, in dem die Töne der Melodie wie Irrlichter schweben. Ganz nebenbei übertrumpfte Clara Wieck frühere Konkurrenzkompositionen wie Thalbergs diverse Bellini-Paraphrasen oder Herz' Variationen »Les trois graces« op. 68 über dasselbe Thema. Als sie ihr Stück im Mai 1839 in Paris aufführte, war der alte Johann Baptist Cramer »entzückt« und Kalkbrenner wenig amüsiert, da auch er dieses Thema variiert hatte (Introduction, Variations et Finale sur l'airfavori de »Pirate« du Bellini »Ma non fia sempre odiata« op. 9 8 ; 1 8 . Mai 1839). Das zweite Stück, das im Sommer 1838 komponierte Scherzo d-Moll op. 10, öffnet andere Perspektiven. Es entstand auf Gut Maxen bei Dresden, wohin Friedrich Wieck seine Tochter ins Exil geschickt hatte, um sie aus Schumanns Sichtachse zu nehmen und heimliche Treffen zu unterbinden. »Mein Scherzo lieb ich sehr«, schrieb sie im Begleitbrief an ihren Vater (12. Juli 1838) und bat, es kritisch durchzusehen. Es kam Ende des Jahres parallel in einem Album des Verlags Breitkopf 8c Härtel und bei Schonenberger in Paris heraus. Rellstab fragte in seiner Kritik, wo denn der »Ernst zu dem Scherzo« bliebe, »nämlich die ganze übrige Sonate« {Iris, 4. Oktober 1839). Jetzt, als aufstrebender Podiumsstar, zielte Clara Wieck nicht darauf, sich in die deutschen Sonatendebatten einzumischen. Vielmehr orientierte sie sich an der internationalen Podiumskonkurrenz, Chopin, Thalberg und Liszt. Ihr Scherzo ist ein rasantes Solostück von bestechender Brillanz, weniger elegant als die Musik ihrer Kollegen, dafür mit kerniger, leidenschaftlicher Vehemenz. Die beiden Trios fuhren in sehnsüchtige Fernen, sowohl im ausdrucksstarken melodischen Kontrast als auch harmonisch. Es ginge »sehr schnell >appassionato que possibilehat er Geld, kann er sie ganz anständig ernähren?< mein Gott, wozu hat der Mensch ein Talent?« (Ji>, 24. August 1839; 19. Februar 1840). Ihres wollte sie jedenfalls ausgiebig nutzen. Dass sie sich überhaupt so selbstbewusste fürsorgliche Ziele setzte, stellte einen fundamentalen Ausbruch aus dem in Bürgerkreisen vorgesehenen passiven Verhalten für Ehefrauen dar (Gestrich 1999, S. 108). Hier dürften neben persönlichen Merkmalen auch die Besonderheiten ihrer Herkunft eine wichtige Rolle gespielt haben: das prägende väterliche Vorbild, ihre herausragende Position als älteste der Geschwister, aber auch die frühe Übernahme von Verantwortung für ihre Professionalisierung sowie die langjährige Auftritts- und Erwerbserfahrung. Für Clara Wieck war es selbstverständlich, berufstätig zu sein und Geld zu verdienen. Die Virtuosin wollte ihre persönliche und finanzielle Autonomie, die sie auf ihrer allein durchgeführten Paristournee 1839 gewonnen hatte, keinesfalls aufgeben. »Es schmerzt mich zu sehr [...], so ganz von ihm abzuhängen« (Jb, 26. September 1839). Ihre finanzielle Unabhängigkeit erhalten zu können, gehörte zu den wichtigsten Prämissen ihrer Ehepläne. Allein der Gedanke, dass die Einrichtung des gemeinsamen Haushalts aus Schumanns Kapital bestritten werden sollte, »peinigt mich, ich kann so nicht frohen Muthes meiner Verbindung mit ihm entgegensehen«, liest man im Tagebuch am 7. April 1840. Ihre Berufstätigkeit erforderte auch nach der Heirat Auftritte in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig verfocht Clara Wieck wie Robert Schumann aber auch das Ideal einer privaten Idylle, dem traulichen »Nest«, das sie in ihrer Kindheit vermisst hatte. Sie war sich des Paradoxes ihrer Pläne bewusst. »Mein Herz möchte vor Sehnsucht vergehen, und dazu Concertsorgen, welch ein Widerspruch!«, notierte sie sich drei Wochen vor der Hochzeit. Und sie hielt im September auch fest: »Es war mein letztes Concert als Clara Wieck - wehmütig war mir's ums Herz« {Jb, 31. August, 5. September 1840). Trotzdem entschied sie sich für den Namen Schumann. M i t dem Erhalt ihrer Selbständigkeit waren weitere Motive verbunden, wie die Sorge um ihr künstlerisches Spitzenniveau, ihrer Berufsgrundlage, sowie die Furcht, an virtuoser Attraktivität zu verlieren und von der Öffentlichkeit vergessen zu werden. Warum hätte sich Clara Wieck als Frau Schumann dem Publikum, das sie liebte, freiwillig entziehen sollen? Die Leipziger Jahre
189
Mehr ahnen als nachweisen lassen sich Verlustgefiihle und Entzugserscheinungen, wie ein Vermissen des »Flow« und des Genusses ihrer machtvollen Position als Virtuosin. Am ehesten deutet sich dieses Motiv im begeisterten Tonfall der Konzertberichte an Emilie List an, der sich merkbar von den dürren Einträgen ins Ehetagebuch unterscheidet. Auch die Beharrlichkeit, mit der Clara Schumann um ihre Auftritte kämpfte, spricht für sich. In der Abgeschlossenheit ihres Zuhauses musste Clara Schumann mit der drohenden Bedeutungslosigkeit als Podiumskünstlerin zu Recht kommen. »Robert will in Leipzig bleiben, wo ich gar nichts verdienen kann - werden wir denn genug haben ohne Sorge zu leben? - Nein der Himmel helfe!« Clara Wieck drängte 1840 nicht zuletzt deswegen auf Auslandsauftritte, weil sie »als Frau [ . . . ] nicht so viel« machen würde wie »als Mädchen«. »Bin ich erst verheirathet, so können tausend Hindernisse eintreten, daß ich nicht reisen kann.« »Immer und immer Pläne und immer kein Entschluß!« Doch Schumann brauchte ihre Nähe und machte daher die Entwürfe »gleich wieder zu Nichte«. Clara Wieck hatte gedacht, ihren Vorsprung so lange es ging auszunutzen, um wenigstens einige Jahre lang »noch ein kleines Capital« zu erwirtschaften, von dessen Zinsen sie leben könnten. So kalkulierte sie für sich allein 1840, auf einer mehrmonatigen England- oder Russlandtournee 5.000 Reichstaler gewinnen zu können. Das war realistisch. Die später von Januar bis Mai 1844 gemeinsam unternommene Reise nach Sankt Petersburg und Moskau brachte nach Abzug aller Unkosten, einschließlich der doppelten Haushaltsführung und der Versorgung der zwei kleinen Töchter in Schneeberg, einen Reinerlös von gut 2.300 Talern (Jb, 2. April bis 18. Mai 1840, S. 978ff.; Nauhaus, in: Tb 3, S. 10). Robert Schumann wollte dagegen auf keinen Fall vom Verdienst seiner Frau abhängen. Das von ihm favorisierte neue bürgerliche Versorgungsmodell konnten sich zwar nur Wohlhabende leisten. Doch dürfte Schumann darin auch ein Prestige gesehen haben. Einerseits verfügte er über Zinsen aus seinem väterlichen Erbe sowie über Einnahmen aus der Zeitung und aus dem Verkauf von Musikalien. Andererseits vertraute er darauf, dass sich seine künstlerische Produktivkraft in der Ehe überhaupt erst voll entfalten würde - zurecht, wie sich im Nachhinein zeigte, wenn auch nicht so rasch wie gehofft. Dafür aber benötigte Schumann verlässliche Strukturen und den stabilen Rahmen häuslicher Intimität. Er träumte von einer symbiotischen Zweisamkeit, deren Zustand er wie schon die Frühromantiker zur idyllischen Isolation verklärte. Dementsprechend sah sein Paarkonzept aus: »Das erste Jahr unserer Ehe sollst Du die Künstlerin vergeßen, sollst nichts als Dir u. Deinem Haus und Deinem 190
Paar-Konzepte
Mann leben [...] Das Weib steht doch höher als die Künstlerin, und erreiche ich nur das, daß D u gar nichts mehr mit der Oeffentlichkeit zu thun hättest, so wäre mein innigster Wunsch erreicht« (Bw, S. 571). Schumann fand die weltabgeschiedene Zweisamkeit vermutlich höchst erstrebenswert und malte sich das Glück daher auch für seine Frau entsprechend attraktiv aus. Da ihm schon die damals vierstündige Reise von Leipzig nach Dresden ein Abenteuer war, wie Liszt halb gerührt, halb amüsiert Marie d'Agoult verriet (in: Seibold 2005, 1, S. 142), schreckte ihn das unstete Virtuosenleben. Gleichwohl barg seine extrem eskapistische Vision auch unverkennbare Züge kollektiv akzeptierter männlicher Allmachtsfantasie, nämlich die berühmte Virtuosin ganz für sich allein besitzen zu wollen. Doch so einfach ließ sich ein Stern nicht ins Wohnzimmer nageln. »Er will, ich soll ein Jahr in Ruhe verleben, und ich erkenne wohl seine Zärtlichkeit für mich«, notierte sich Clara Wieck (Jb, 26. September 1839). Aber die Vision lockte sie nicht wirklich, und die Braut reagierte diplomatisch. »Der Gedanke an das nächste Jahr! wenn wir immer bei einander seyn können, jedes Gefühl miteinander theilen, zusammen spazieren gehen, von der Vergangenheit sprechen«, antwortete sie ihm und entfaltete dann ihre neuesten Reisepläne (Bw, S. 571ff). Dass derartige Männerträume nicht ungewöhnlich waren, lehrt das Beispiel von Friedrich Theodor Vischer. Der fand 1844 in Thekla Heinzel eine Frau, die seinem fantasierten Idealbild entsprach: »Hohe Gestalt muß sie haben, dunkle Augen und Haare, Stil und Anmut und etwas von höherer Bedeutung«. Und er träumte, sie würde sein »Geschöpf« und sein »Werk« sein: »Ich kriege ein ganz anderes Weib als der Prinz Albert von England«, nämlich keine Queen Victoria. Er würde als Herr im Haus regieren und sie »mich pflegen, ich werde es gut haben«. Seine Frau sah ihre Aufgaben offensichtlich anders. Die Ehe scheiterte (in: Sturm, S. 151f). Beide, Wieck und Schumann, träumten von einer einfachen, überschaubaren Idylle. Schumann fantasierte sie blumiger seine Braut. Statt »großer Spazierfarthen« wollten sie lieber »Arm in Arm zusammen durch Wiesen und Felder« gehen. Tanzen könnte man auch zu Hause, gelegentlich ein »Glas Champagner [...] schlürfen« inklusive. Die »neuesten« Kleider müssten nicht sein, doch »ein Stirnband alle Jahre darf im Budget nicht vergessen werden«. »Tische und Stühle und Blumen vor dem Fenster«, mehr brauchte es nicht (Bw, S. 136). Indessen wusste Schumann, dass Clara Wieck für eine Häuslichkeit, wie er sie sich wünschte, ungeeignet war. Sie hatte keine traditionelle Mädchenerziehung genossen, sondern große Teile ihrer Kindheit und Jugend im Rampenlicht gearbeitet und auf Tourneen in Hotels verbracht. Ohnehin war der Erhalt ihres Berufs eine Voraussetzung für die geplante
Die Leipziger Jahre
191
Künstlergemeinschaft. So sprang Schumann über seinen Schatten und bot sich als Reisebegleiter an, in der festen Uberzeugung, auch diese Aufgabe erfüllen zu können. Seine Braut nahm die Offerte zunächst gar nicht ernst und lehnte sie auf seine Nachfrage hin sogar ab, was ihn nachhaltig verstimmte. »So gern hätte ich Dir auch einen Beweis meines Concertreisetalents damit abgelegt«, schrieb er. »Dann bin ich auch ärgerlich auf Dich [...] also über Deine Delicatesse wegen der Copenhagener Reise« (Bw, S. 926ff). Als sie Anfang März 1842 dann doch zusammen nach Dänemark aufbrachen, zeigten sich ziemlich bald die Grenzen. Weder kam Schumann mit dem ständigen Transit, den ununterbrochen neuen Situationen, Pflichtbesuchen und Bekanntschaften, noch mit der Vertauschung der traditionellen Rollen gut zurecht. Er kehrte um und wartete mit Tochterchen Marie auf die Rückkehr seiner Frau, unfähig, die Stille im Haus produktiv zu nutzen. »Miserables Leben« (Tb 3, S. 209). In Leipzig blühte der Klatsch. Man verbreitete Scheidungsgerüchte, Clara hätte ihn verlassen. (Bw, S. 1181 und 1192). Es spricht für die Qualität der Partnerkommunikation, dass daraus kein fundamentaler Dissens entstand, sondern man sich für die nächste Reise anders zu wappnen gedachte. »Vorher möchte ich so gern noch ein Clavierconcert und eine Symphonie schreiben«, hatte Schumann gleich zu Beginn der Ehe schon angemeldet (Tb 2, S. 122). Zur Ehe gab es keine Alternative. Ledige Männer (und besonders Künstler) flößten wenig Vertrauen ein und hatten kaum Chancen auf ein zufrieden stellendes Leben in gesellschaftlicher Anerkennung. Schafften sie den wirtschaftlichen Aufschwung nicht, so blieben sie lebenslang Untermieter in möblierten Zimmern oder noch weniger komfortablen Unterkünften. Ledige Frauen führten bloß ein geduldetes Schattendasein, meist als Anhängsel der Herkunftsfamilie, bis die Eltern, deren Pflege sie im Alter übernahmen, starben. Damit die gemeinsame Zukunft gelang, mussten die Wünsche einander angeglichen werden. Diese tief emotionale Diskussion lässt sich im Brautbriefwechsel und in den Ehetagebüchern verfolgen. Anfangs zerrte Clara Wieck ihren Bräutigam noch ziemlich schonungslos aus seinen duftigen Träumen. »Du vertraust auf den Ring? mein Gott das ist nur ein äußeres Band. Hatte Ernestine nicht auch einen Ring von Dir und, was noch mehr sagen will Dein Jawort? und doch, Du hast das Band zerrissen. Also der Ring hilft gar nichts [...] Bleiben wir uns ohne Ringe treu, so ist das viel mehr« (Bw, S. 46). Später lernte sie, ihre anfänglich recht forsche Rhetorik zurückzunehmen, da sie auf ihren Bräutigam verstörender wirkte als beabsichtigt. Clara Wieck kannte den hochsensiblen, stimmungs- und wetterabhängigen Hypochonder (Nauhaus, in: Tb 3, S. 12; Held 1998, S. 117ff), der 192
Paar-Konzepte
seine Träume wie seine Ängste vor ihr ausbreitete. Schon vor fünfJahren hätte er einmal befürchtet, »den Verstand zu verlieren«, gestand Schumann 1838. Das Gefühl »bemächtigte sich meiner mit einer Heftigkeit, daß aller Trost alles Gebet dagegen wie Spott verstummt [...] Clara, der kennt keine Leiden, keine Krankheit, keine Verzweiflung, der einmal so vernichtet war« ( B w , S. 95). Außerdem war die Kommunikation mit dem schweigsamen Künstler nicht immer einfach. Schumann wusste, welche Macht er damit ausüben konnte, und kultivierte sein Schweigen als »geheimnißvolle[n] Zug« seines Charakters: »Es liegt in meiner Methode«, hatte bereits der Achtzehnjährige 1828 sein Verhalten anderen gegenüber analysiert. »Ich spreche da nicht viel [...]; auf einmal steh' ich auf u. ich lasse merken, was ich sagen könnte, wenn ich Lust hätte; dann fühl'ich recht, wie jener sich unterdrükt fühle; und wie dieser es fühlt, dass ich dies fühle« (Tb 1, S. 141). Doch faszinierte Clara Wieck offenbar gerade die psychische Komplexität »zwischen Zartsinn und Zerstörungslust«, so Wolfgang Held (1998, S. 63), Roberts besondere Empfindsamkeit und Empfänglichkeit, die die Quelle für seine fantastische Kreativität, seinen Humor und seine musikalisch-literarische Poesie bildeten. Nach Sabinina war auch Schumanns äußerliche Erscheinung attraktiv, groß und „stattlich", „alles an ihm atmete Macht und Kraft« (in: Lossewa 1997, S. 105). Clara Wieck bewunderte seine Kunst und liebte Schumanns unnachahmliche musikalische Sprache. »Er hat mir heute viele seiner Lieder gezeigt - so hatte ich sie nicht erwartet! mit der Liebe wächst auch meine Verehrung für ihn. Es ist keiner unter den jetzt Lebenden, der so begabt mit Musik wie Er« (Jb, 4. April 1840). Nur mit ihm schien eine gleichrangige Gemeinschaft möglich. Jeder andere Bewerber war demgegenüber ein Langweiler. Die Ehe bot ihr als Frau einerseits Schutz, andererseits war sie felsenfest davon überzeugt, ihrem Liebsten einen sicheren Halt vor den inneren Abgründen, den Höllennächten und Auflösungsfantasien geben zu können, denen Schumann seine Musik abtrotzte. Diese Aufgabe war ihr wichtig und festigte ihre Position. »Zwar ist das Weib schwächer als der Mann, doch in der Liebe stark« (Bw, S. 87), so bekräftigte sie ihre Vorzüge und reihte sich damit in den Reigen der großen Liebenden aus Literatur und Geschichte ein. Und Schumann wusste, dass er kaum wünschen konnte, diesen virtuos jagenden Merlin zu einem Huhn zu domestizieren, nicht zuletzt, weil damit ihr musikalischer Zauber, der ihn selbst zu poetischen Höhenflügen inspirierte, zerstört würde. Die Utopie ihrer Gemeinschaft hing von der künstlerischen Gleichrangigkeit beider ab. Schließlich war es vor allem Clara Wiecks ungewöhnliche Professionalität, die den Studenten Schumann anfangs so fasziniert hatte. »Höre, am Klavier lieb' ich Dich doch beinahe am meisten.« (Bw, S. 696). Die Leipziger Jahre
193
Nach dem jahrelangen Prozess steigerte sich der Erwartungsdruck immens, nicht bloß unter den Liebenden selbst, sondern auch gegenüber Angehörigen und der Öffentlichkeit. Die Ehe mit dem anspruchsvollen Programm einer idealen Künstlergemeinschaft sollte und musste gelingen. W i e alle im Rampenlicht stehenen Persönlichkeiten hatten auch die Schumanns Vorbildfunktion. Daraus wuchs die selbst auferlegte Pflicht, mit Erfüllung der eigenen Wünsche auch das biedermeierliche Idyll glänzend auszufüllen. Zur komplexen Dialektik der eigenen Innen- und Außensicht gehörte, dass Clara Schumann offenbar daran lag, eine perfekte, bescheidene und sparsame Ehefrau zu geben, einmal, um dem Vorwurf zu entgehen, ein »eheuntaugliches Luxusweib « (Hausen 1988, S. 94) zu sein. Andererseits konnte sie damit ihren Mann vor spöttischer Nachrede schützen, indem sie eine entsprechende bürgerlich hierarchische Fassade aufzog. Die Gemeinschaft sollte eine doppelte Erfolgsgeschichte werden, nämlich die Freisetzung beiderseitiger größerer künstlerischer Potentiale in einem harmonisch funktionierenden My-home-is-my-castle-Programm. Allerdings ließ sich eine derartige Musterehe aufgrund der widersprüchlichen Prämissen im Familienkonzept kaum realisieren. Die Unsicherheit des künftigen Lebens betraf nicht bloß Schumanns labile Gesundheit. Vielmehr barg ihre Zukunft allein schon deshalb konkrete Risiken, weil sie materiell gleichsam auf Luft, nämlich auf musikalischen Schallwellen, baute. Ihre gesamte Energie investierten beide in ein sich verflüchtigendes Produkt, dessen symbolischer Wert zwar stetig stieg, doch schwer in Brot und Butter umgerechnet werden konnte. Es musste gelingen, in den Werken etwas so Anziehendes zu schaffen, dass die Rezipienten sie als etwas Wertvolles ansahen, in das sie investierten. Dazu sollte die Erfindungsgabe lebenslang sprudeln, das Genie sich immer wieder selbst übertrumpfen. Ihr Leben baute ausschließlich auf die Zuversicht in die Kräfte des eigenen Talents. Im Rückblick kann man staunen, wie viel den Schumanns davon umzusetzen tatsächlich gelang. Vor diesem Hintergrund erhielt die Ritualisierung des gemeinsamen Alltags ihre Funktion, die Quartettmorgen und Soireen, musikalische Monatsanfänge und -abschlüsse, Geburts- und Festtagskompositionen, private Vor- und Uraufführungen. W i e in vielen bürgerlichen Familiendokumenten rückten auch bei den Schumanns vorrangig Zeugnisse von Freundschaftskult und häuslicher Behaglichkeit ins Blickfeld. Man präsentierte ausgiebig die private, häusliche Sphäre und nicht die profane Berufstätigkeit (Bertz 2004, S. 48). Infolgedessen geriet im Rückblick späterer Generationen in Vergessenheit, wie riskant diese neue bürgerliche Existenzform als freie Künstler in 194
Paar-Konzepte
der entstehenden modernen Gesellschaft war. Permanenter Erfolgsdruck vor einer Kulisse unruhiger politischer beziehungsweise wirtschaftlicher Krisen lastete auf den Künstlern. Jederzeit konnte das schützende » Nest« fortgeweht werden. Das tägliche Dokumentieren sämtlicher Aktivitäten, die ständigen disziplinierenden Protokolle der geleisteten Arbeit, die den Moment des Schöpferischen wenigstens noch statisch greifbar machten, das gebetsmühlenartige Bestätigen bürgerlicher Tugenden und Tatkraft (»immer fleißig«, Tb 3 passim), die Besuchertabellen, die Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben, der gerauchten Zigarren und verbrauchten Taschentücher, die ganze, immens viel Zeit in Anspruch nehmende Produktion von Tage- und Haushaltsbüchern, Reisejournalen, Brief- und Lektürelisten, dem »Braut«und »Projektenbuch«, dem »Erinnerungsbüchelchen für die Kinder«, dem »Dichtergarten«, den Poesiealbumblättern und der Familienkassette - das alles geschah auch im Dienst einer Selbstvergewisserung der flüchtigen Existenz. So knüpften die Schumanns zumindest symbolisch ein ganzes Gewebe von Sicherheitsnetzen aus kontrollierbaren Belegen ihrer privaten Ereignisse und Leistungen. Und selbst mit seiner Sexualbuchhaltung befand Schumann sich im Einklang mit so illustren Zeitgenossen wie Victor Hugo, Gustave Flaubert, Jules Michelet oder Alfred de Vigny (Geschichte des privaten Lebens 4, S. 544). Nach jahrelangem Dauerstress durch den Prozess litten beide zu Beginn ihrer Ehe unter Erschöpfungssymptomen. Man brauchte Zeit für sich, um sich an die physische Gegenwart des Anderen und an den neuen Alltag zu gewöhnen und Bedürfnisse, Gewohnheiten und Marotten kennen zu lernen. Clara Wieck war in Berlin schon um sechs Uhr früh munter im Tiergarten herumgelaufen. Schumann schlief bekanntlich gern lange. Wenn eine Sprinterin und ein Flaneur ihren Weg gemeinsam machen wollten, so musste jeder Tempo und Kräfte des anderen berücksichtigen. Das galt wörtlich auf ihren Wanderreisen, etwa im Juni 1841 ins Elbsandsteingebirge oder bei der Brocken-Besteigung im September 1844, und es galt auch im übertragenen Sinne. In den ersten Wochen gaben sich ohnehin zahllose Besucher gleichsam die Klinke in die Hand. Jeder wollte das endlich erreichte häusliche Glück des Musterpaars leibhaftig sehen. Trotzdem begann der Start in der Inselstraße mit einem ernüchternden Schock. »Es ist schlimm, daß mich Robert in seinem Zimmer hört wenn ich spiele, daher ich auch die Morgenstunden, die schönsten zu einem ernsten Studium, nicht nutzen kann« (Tb 2, S. 103).
Die Leipziger Jahre
195
Künstlergemeinschaft Wünsche und Wirklichkeit Drei Romanzen op. 11 »Wir geben dann auch Manches unter unseren beiden Namen heraus, die Nachwelt soll uns ganz wie ein Herz und eine Seele betrachten und nicht erfahren, was von Dir, was von mir ist. Wie glücklich bin ich«, so schwärmte Schumann im Juni 1839 (Bw, S. 571). Die Idee inspirierte ihn. Der Entwurf von Künstlerbünden gehörte offenbar zu Schumanns kreativen Imaginationsräumen, mit denen er sich beim Schreiben und Komponieren umgab. Dabei spielten nicht immer reale Personen mit. Die geheimnisvolle Pauline Comtesse d'Abegg, deren Namen chiffriert die Grundlage seiner gleichnamigen Abegg-Variationen op. 1 bilden sollte, war eine von der Pianistin Meta Abegg ausgehende Erfindung Schumanns (Köhler, in: Schumann-Interpretationen I, S. 2). Zwischen realen und romanhaften Gestalten büeben die Grenzen fließend. Freunde, denen er »schönere Namen« gab, hätten im Laufe der Zeit »ihre Rollen verändert« und wären zu »Fantasiemenschen geworden«, so Schumanns Selbstanalyse. »A propos - von heute an nenn ich Sie nicht mehr Eleonore, sondern Aspasia«, kündigte Schumann Henriette Voigt 1834 an. »In den Davidsbündlern bleibt jedoch Eleonore stehen« (Tb 1, S. 339, S. 371; Wasielewski 1880, S. 329). Auch Clara Wieck zählte zu den Menschen, die Schumann schon 1831 zu Fantasiegestalten inspirierte. Zwar hatte er sie durchaus als nervtötende, kapriziöse Göre erlebt, doch Kraft ihres tiefsinnigen Spiels verzauberte ihn das unbegreifliche, mignonhafte Wesen immer wieder. Zunächst gestaltete sich die romantische Kommunikation allerdings etwas einseitig. Das Mädchen tauchte in Schumanns Essays und Kompositionen mehrfach auf, etwa unter dem Namen »Zilia« oder »Chiara«, wie in den literarischen Schwärmbriefen und in einzelnen als Genreszenen gestalteten Rezensionen, oder musikalisch porträtiert als »Chiarina«, wie im Carnaval op. 9 Nr. 11. Sie war aber in der Regel selber kaum aktiv daran beteiligt, sondern gab bloß die Folie für seine Phantasie. Die verschiedenen Grade zwischen rein erfundenen und tatsächlich vorhandenen Situationen können nicht immer klar unterschieden werden, da die entworfene und die vorhandene Welt in Schumanns Konzept der 1830er Jahre zu einer Art »Lebensroman« verschmolzen. Mit Clara Wieck, so hoffte er, ließe er sich auch realisieren. Fassbarer als die literarischen Fantasien sind in dieser Hinsicht die musikalischen Zitate von Clara Wieck in Schumanns frühen Klavierwerken, 196
Paar-Konzepte
den Impromptus über eine Romanze von Clara Wieck op. 5, den Davidsbündlertänzen op. 6 oder der f-MolI-Sonate op. 14. Dort wurde jeweils ein musikalischer Gedanke Clara Wiecks aufgegriffen (in op. 5 der Bass aus dem Thema ihrer Romance variée op. 3, in op. 6 die erste Mazurkaphrase aus den Soire'es musicales op. 6 Nr. 5, in op. 14 ein heute verschollenes Andantino de Clara Wieck), in den Schumann sich einfühlte, um dann eigene Erfindungen daraus zu entwickeln. Dieses Weiterkomponieren suggerierte, dass man sich gleichsam in einer gemeinsamen musikalischen Sprache unterhielte. Zur Verschmelzungsfantasie hatte schon die symbolische Aufladung ihrer Namenskoppelung auf Titelblättern oder Programmzetteln beigetragen, wie etwa Clara Wiecks Widmung ihrer Romance variée op. 3 an Schumann. Die frühen spielerischen Korrespondenzen blieben noch mit hoffmannesken Spuk- und »Doppelgänger«-Geschichten verbunden. So wurde verabredet, zur selben Zeit »das Adagio aus Chopins Variationen« op. 2 zu spielen, während sich ihre Geister »über dem Thomaspfbrtchen« träfen (Bw, S. 7ff). In Schumanns fis-Moll-Sonate op. 11 findet sich dann der erste Versuch einer Kollektivsignatur. Inzwischen hatte die fantasierte sympoetische Gemeinschaft ein anderes kompositorisches Niveau erreicht und erfolgte biografisch vor dem Hintergrund eines ersten Liebesversprechens. Zwischen dem wild stürmenden, turbulenten Kopfsatz von Schumanns Sonate und Wiecks grellem Ballet des Revenants op. 5 Nr. 4 bestehen Korrespondenzen, bei denen heute nicht mehr entschieden werden kann, welches Motiv von wem stammt (Klassen 1990, S. 44ff). Hier haben beide ihre eigene Musik von gleichem Motivmaterial ausgehend entworfen. Ohne Beispiel ist das von Schumann für die Erstausgabe in Auftrag gegebene Titelkupfer. Ein William-Blake-hafter, frei schwebender Engel, Flügel und Kopf umschlungen von Blüten- und Blattornamentik, zu seinen Füßen zwei heraldische, aus Greif und Löwen gemischte Fabelwesen, breitet ein Tableau aus, auf dem der enigmatische Titel steht: »Pianoforte-Sonate. Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius«. Ein schockierendes Dreieck, künstlerisch vereint, obwohl (oder gerade weil) in der Realität ein Kontaktverbot zwischen den Liebenden galt, die sich zu diesem Zeitpunkt noch siezten und einander keineswegs sicher waren. Als die Sonate im Juni 1836 erschien, war Schumann das »Räthselhafte des Titels«, der einen exklusiven Geheimbund suggerierte, überaus wichtig, mitsamt der verborgenen Botschaft an die Empfängerin, die seine Musik in einer privaten Uraufführung 1835 zum Klingen gebracht hatte. In späteren Ausgaben stutzte er das Wundersame auf Normalmaß zurecht und widmete die »Große Sonate« unter seinem bürgerlichen Namen brav dem »Fräulein Clara Wieck«.
Drei Romanzen op. 11
197
Als junger Teenager ließ sich Clara Wieck begeistert von Schumanns literarisch-musikalischen Doppelgängergeschichten zum kreativen Spiel verfuhren. Je erwachsener sie wurde und je ernsthafter ihre Gefühle für Schumann sich festigten, umso weniger war sie bereit, sich auf die frühere, spaßhafte, musikalisch halluzinierte Symbiose einzulassen. Ganz im Gegenteil, sie weigerte sich, Schumanns Fantasieprodukt »Chiara« zu authentifizieren, indem sie sich damit identifizierte. Hier dürfte die frühe Erfahrung des jungen Stars im Umgang mit Selbst- und Fremdaufmerksamkeit eine zentrale Rolle gespielt haben. Clara Wieck kannte ihre Funktion als Idol und konnte ihre Bühnenwirkung sowie ihre durch Tone charakterisierte musikalische Person von der eigenen Lebenswirklichkeit offenbar klar unterscheiden. Nur dadurch konnte sie sichern, dass die von Schumann geäußerten Gefühle für sie »wirklich« und nicht Teil eines ästhetischen Spiels oder einer Projektion waren. Schumann wollte sogar bemerkt haben, »wie Du als Kind mit ihm viel Ähnlichkeit hattest«, nachdem er Georg Nikolaus von Nissens Biographie W. A. Mozarts von 1828 gelesen hatte (Bw, S. 79 und 311). Er dächte an sie »wie ein Pilgrim an das ferne Altarbild«, hatte er der Zwölfjährigen geschrieben, und nicht »wie der Bruder an seine Schwester oder der Freund an die Freundin«. Doch genau das wollte sie sein, nämlich seine »Freundin Clara Wieck« (Bw, S. 3ff), aus Fleisch und Blut, und nicht die entrückte raffaelitische Madonna aus Tieck und Wackenroders Herxensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, an die Schumann hier literarisch anknüpfte. Nicht als Star oder als bloße Folie für frei wuchernde Fantasien und unkontrollierbare Emotionsschübe, sondern als Mensch gesehen zu werden, lag Clara Schumann zeitlebens am Herzen. So gestand die Achtzehnjährige, dass sie ein »kleines Zettelchen« am meisten gefreut hätte, auf dem Schumann versicherte, er Hebte sie um ihrer selbst willen. Ein Vierteljahrhundert später mahnte die Künstlerin Theodor Kirchner: »Lieber Freund, bedenken Sie auch, daß es Ihre Fantasie ist, die mich wie mit einem Glorienscheine umgiebt - ich habe den treuen Künstlersinn und ein treues Herz, nichts mehr« (in: Kirchner 1996, S. 121). Der einzige, der sie von Beginn an ohne Schutzschild, sozusagen »pur« erlebt hatte, nicht im Gewand einer strahlenden Virtuosin, sondern ganz am Rande ihrer Kräfte, nur noch aus Notwehr handelnd, das war Johannes Brahms während der fundamentalen Krise von Schumanns Zusammenbruch und Tod. Clara Wieck war indessen nicht die einzige Grazie in Schumanns illustrer Musengemeinschaft, die sein frühes Klavierwerk inspiriert hatte. So verknüpfte Schumann in den berühmten »Sphinxes« ASCH und SCHA, die 198
Paar-Konzepte
den Carnaval op. 9 untergründig durchziehen, den Herkunftsort Asch seiner damaligen Verlobten, Ernestine von Fricken, mit den musikalisierbaren Buchstaben seines Namens zu einer anagrammatischen Chiffre für ihren Seelenbund, aus der dann die »Soggetti« der kleinen karnevalesken Szenen gebildet wurden. Wenn Schumann 1838 versuchte, Clara Wieck dazu zu bewegen, den Carnaval
in ihrem Repertoire gegen die
Davidsbündlertanze
op. 6 auszutauschen, so dürfte neben ästhetischen Gründen ein Motiv darin gelegen haben, dass der Carnaval mit einer anderen Verlobten verwoben war und er inzwischen lieber die Vereinigung mit der jetzigen, Clara Wieck, musikalisch präsentiert gesehen hätte. In Schumanns Davidsbündlertänzen der
fis-Moll-Sonate
op. 6 vollführte der vom Titelblatt
bekannte Dreierbund (Clara, Florestan und Eusebius)
einen »Polterabend«, so Schumann. »War ich je glücklich am Klavier, so war es als ich sie componirte.« Den Zyklus eröffnen zwei Takte von Clara Wiecks G - D u r - M a z u r k a op. 6 Nr. 5. Schumann zitierte sie originalgetreu. D a s kleine Motiv wird in Schumanns eigene Musik integriert und scheint im Zyklus immer wieder durch. Dessen einzelne Abschnitte signieren im Autograph chiffrierte Siglen: » E . « und »F.« (Eusebius und Florestan), die Schumann als Alter E g o nutzte. Beharrlich wartete der Komponist auf eine Rückmeldung. Uber die Davidsbündler »gehst D u mir sehr flüchtig hinweg, ich meine, sie sind ganz anders als der Carnaval und verhalten sich zu diesem wie Gesichter zu Masken« (Bw, S. 93 und 127). W i e immer auch die Gesichter hinter der Florestan- und Eusebiusverkleidung aussehen mochten, Clara Wieck (und später Clara Schumann) behielt trotzdem den Carnaval im Programm, vermutlich aufgrund der Bühnenwirkung des Zyklus. M i t Wiecks Notturno op. 6 Nr. 2, dessen Melodie als »Stimme aus der Ferne« in Schumanns Novellette op. 21 Nr. 8 auftauchte (T. 198ff), entfaltete sich dann eine neue Qualität musikalischer Kommunikation. Die sehnsüchtige und tiefsinnige Melodie bekundete mit ihrer tonalen Ambivalenz, der schwebenden Metrik und der abwärts schreitenden Quint-Skala wichtige Züge von Ubereinstimmung in den Musiksprachen beider. Von »seltsam verschlungenen Arabesken«, »einem zu tief gegründeten Gemüte« entsprungen, um spontan verständlich zu sein, die aber doch »zartes, überwallendes L e ben« enthielten, schrieb Schumann in seiner Rezension (GS 1, S. 250f). Hier konnte man ahnen, dass der von ihm ersehnte romantische Gleichklang der Seelen zwischen ihnen möglich wäre, dass die eine Stimme für den anderen spräche und umgekehrt. A u f seine Frage, »was dachtest D u dabei? Schwermüthig ist es hinlänglich, meine ich«, wusste sie allerdings nichts zu antworten. » D u mußt mir etwas componiren für die Zeitung, sonst laß ich mich von
Drei R o m a n z e n op. 11
199
Dir scheiden«, so bekniete er seine Braut (Bio, S. 100). Anders als Schumann stellte Wieck ihre kreativen »espaces imaginaires« indessen nicht durch literarisch formulierte Fantasien her, sondern durch Klangräume, mit denen sie sich beim Klavierspiel umgab, um darin zu komponieren. Das war die Luft, wo sie nur noch »in Tonen« atmete (in: Litzmann 2, S. 274). Erst ab 1838, als der gemeinsame Lebensweg in greifbare Nähe rückte, schien sich die Komponistin ernsthafter mit einem Gleichklang der musikalischen Sphären zu befassen. Aus Anlass der wiederholten Bitte Schumanns um eine Komposition für die Beilage seiner Zeitung teilte sie ihm mit: »Für Dich habe ich schon seit langer Zeit eine Romanze angefangen, und es singt ganz gewaltig in mir, kanns aber nicht zu Pappier bringen.« Vermutlich sprach sie von der späteren g-Moll-Romanze op. 11 Nr. 2. Sie erschien im September 1839 in der NZfM, dort unter dem Titel Andante und Allegro. Ihr Incipit ist auf einem Albumblatt mit dem Datum »Dresden Nov. 1838« überliefert. Der Titel »Romanze« assoziierte eine bereits triviale, verkitschte Gattung einfacher Machart und wurde daher von Chopin, Liszt oder Mendelssohn Bartholdy lieber vermieden. Als Wieck in Paris 1839 an weiteren Stücken arbeitete, die sie zusammen mit der g-Moll-Romanze als kleines Album veröffentlichen wollte, bat sie Schumann daher um pragmatische Titelvorschläge. »Willst Du mir nicht einen Namen dazu suchen? einen für Franzosen verständlichen?« Doch Schumann erwies sich in diesem Fall als ungeeigneter Ratgeber, weil er zu intensiv von der Musik eingenommen war und ins Schwärmen geriet. »Notturno« passte nicht, antwortete sie, es wäre doch mehr ein Walzer. Vermutlich ging es hier um die dritte Romanze in As-Dur. »Heimweh« oder »>Mädchen's Heimweh< - da wird Dein V[ater] aber schäumen«, lauteten seine indiskutablen Alternativen. »Das Heft überschreibst Du: Phantasiestücke« (Bw, S. 557-629). Abgelehnt. Es blieb bei Romanzen. Als dritte kam die bei der Publikation an den Anfang gerückte Romanze in esMoll hinzu. Die Trois Romances op. 11 erschienen 1840 parallel bei Richault in Paris und Mechetti in Wien mit einer Widmung an Robert Schumann. Wenn in den Romanzen die virtuosen Elemente und der brillante Ton im Vergleich zu den vorherigen Werken zurücktraten, so aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung. Mit ihrem Opus 11 nahm Clara Wieck bewusst den Diskurs des innigen, dabei kompositorisch anspruchsvollen lyrischen Klavierstücks auf, dessen intime Zwiesprache sich an Gleichgesinnte wandte, die bereit waren, den Tönen aufmerksam zu lauschen und sich auf die geheimnisvolle »poetische« Sphäre einzulassen. Dieses Publikum las romantische Dichtung, studierte die Neue Zeitschrift für Musik oder die Gazette Mu200
Paar-Konzeple
sicale, ging zu Kunstausstellungen, besuchte Museums- und Privatkonzerte sowie gepflegte Salons und griff zuweilen auch selbst zum Instrument. Aus der Pariser Perspektive mochte auch noch das für deutsche Musik als charakteristisch geltende, in sich gekehrte Sentiment eine Rolle gespielt haben, eine Komponente, die Clara Wieck während ihres Aufenthalts in Abgrenzung zur französischen Szene kultivierte und als deren Expertin sie dort auftrat. Gleichzeitig dürften es die ersten Werke sein, bei deren Entstehung bereits ein imaginärer Dialog mit dem ersten Adressaten der Stücke, nämlich Robert Schumann, stattfand. Mit ihrem geheimnisvollen dunklen Ton taucht die introvertierte es-MollRomanze op. 11 Nr. 1 in die Nachtsphäre ein, die Wolfgang Held an Schumanns Kompositionen so eindrücklich beschrieben hat (1998, S. 117ff). Aus dem tiefen Register steigt ein verhaltener Gesang auf. Melodische und begleitende Figuren greifen so einander, dass die Hierarchie zwischen ihnen zeitweise aufgehoben scheint. Das Verfahren, das die Komponistin an Chopins Nocturnes studiert haben könnte, erinnert an die Unschärfe von Formen, die im diffusen Licht verfließen. Diese Stimmung prägt das Stück. Mit der Tonart und dem vollgriffigen Klaviersatz gehen dabei die Anforderungen weit über die üblichen Genregrenzen hinaus. Dagegen schlägt das dritte Stück in As-Dur schon eher einen konventionell romanzenhaften Ton an. Ihr sentimentaler Zug dürfte Schumann zu dem Titelvorschlag »Mädchens Heimweh« verleitet haben. Doch das Stück hat es in sich. Auch wenn die Melodie hier traditionell in der Oberstimme liegt, so bilden die Unterstimmen nicht einfach eine Begleitung. Vielmehr konstruiert die Komponistin über einem Orgelpunkt einen fünf- bis sechsstimmigen linearen Satz mit Liege- und kontrapunktischen Gegenstimmen, durch den die schlichte Romanzenweise ein nobles und anspruchvolles Fundament erhält. Als Mittelteil erklingt ein kunstvoller Tanz. Dabei werden von rechter und linker Hand unterschiedliche metrische Schwerpunkte gesetzt, so dass nicht nur rhythmische, sondern auch harmonische Reibungen entstehen. In dieser im Takt sich drehenden und gleichzeitig außer Takt geratenen Mazurka evoziert die Komponistin eine wie von fern erklingende Erinnerung an Chopin. Auch die g-Moll-Romanze op. 11 Nr. 2 beginnt im tiefen Register. Ihre einen Oktavzirkel rundende Andante-Melodie erhält einen als sehnsuchtsvoll drängend beschreibbaren Zug. Drei miteinander verschränkte, auf sieben Takte zusammengezogene Halbsätze verstärken den Sog-Effekt. Darüber hinaus beschleunigt der Rhythmus den Fortgang. Zugleich verhakt Drei Romanzen op. 11
201
die Komponistin die melodische Linie mit weich pulsierenden, tupfenden Begleitakkorden zu einem durchbrochenen Band. Zwar liegt dem Stück ein dreiteiliges Liedmodell zugrunde. Doch scheint alles organisch aus einem Anfangsimpuls herauszuwachsen. Dieser HörefFekt entsteht, weil die Komponistin zwischen den Hauptteilen vermittelnde Ubergänge konstruiert, die einen eigenen melodischen Ausdruck formulieren und damit in der Hierarchie schon fast gleichrangig neben den thematischen Partien stehen. Auf diese Weise dominiert - anstelle eines Kontrastes - der Eindruck von Wandlung und Rückkehr den Verlauf. Am Ende verlangsamt sich das Tempo, und die Romanze klingt in geheimnisvollen Pianissimo-Akkorden gleichsam unendlich weiter. Nicht der bekannte »Schumannton«, sondern ihre eigene, Wieck-spezifische Nachtseite breitet sich darin aus. Bei den Romanzen op. 11 entstanden die als Ubereinstimmung zwischen Wieck und Schumann bewerteten Erfindungen unabhängig voneinander. »Im März«, schrieb Schumann, »hatte ich einen ganz ähnlichen Gedanken; Du wirst ihn in der Humoreske finden. Unsere Sympathien sind zu merkwürdig«. Gemeint war vermudich das Überleitungsmotiv aus Wiecks gMoll-Romanze op. 11 Nr. 2 (T. 55ff.) und eine ähnlich lautende Phrase aus Schumanns ebenfalls in g-Moll stehender Humoreske op. 20 (T. 678ff). Er empfand die Stelle »wie von Beethoven [...] höchst innig und voller Leidenschaft«. In Schumanns zweiter der Drei Romanzen fiir Klavier op. 28, die im Dezember 1839 komponiert wurden, finden sich auch Ähnlichkeiten bei der Differenzierung des Liedsatzes. Wie in Wiecks g-Moll-Stück (T. 18ff.) wurden Melodie und Begleitung aufgespalten und jeweils zweistimmig in beiden Händen gefuhrt. Schumann verlegte in seiner Fis-Dur-Romanze die Begleitung in die äußeren Stimmen, die die Melodie im Tenor umranken. Zur Verdeutlichung dieser in der Tiefe verschlungenen Stimmen wählte er eine Notation auf drei Systemen. Beide Romanzenzyklen bieten mit ihrer subtilen Vielschichtigkeit und dem differenzierten Satz ein hoffnungsvolles, neuartiges Konzept für diese Gattung. Die größte Attraktion dürfte für Schumann darin gelegen haben, dass die Komponistin in der g-Moll-Romanze (wie schon im Notturno op. 6 Nr. 2) eine schwerelos »schwebende« Melodie entwarf. Sie galt als musikalischer Topos für das Poetische, für die Unendlichkeit des Imaginären, dessen Gestalt- und Grenzenlosigkeit sich nach frühromantischer Kunstauffassung der begrifflichen Festlegung entzog (Loock 2007, S. 355ff). Hier hatte sich das Imaginäre in der Fantasie der Künstlerin zu einer musikalischen Struktur verdichtet, und es konkretisierte sich in der sinnlichen Wahrnehmung. Satztechnisch nutzte die Komponistin dabei die Differenz zwischen Takt, Metrik 202
Paar-Konzepte
und rhythmischen Akzenten, um Stimmen zu kreieren, die frei zwischen die metrischen Schwerpunkte gesetzt und dabei doch in einem mehrstimmigen linearen und durch Zusatztöne diffus verwischten harmonischen Konzept gebunden waren. Ihre Künstlergemeinschaft hatte ein neues Stadium erreicht. »An Deiner Romanze hab' ich nun abermals von Neuem gehört, dass wir Mann und Frau werden müßen. Du vervollständigst mich als Componisten wie ich Dich«, so Robert Schumann. Der bislang nur geträumte oder fantasierte poetische Gleichklang rückte in greifbare, lebenswirkliche Perspektive. Auch die diskursive Art der künstlerischen Auseinandersetzung zwischen beiden Komponierenden erreichte eine neue Qualität, wie der ausfuhrliche Briefwechsel um Korrekturen und Änderungsvorschläge zu den Romanzen dokumentiert. Da keine Autographe erhalten sind, können die einzelnen Sachargumente zwar nicht mehr nachvollzogen werden. Beeindruckend bleibt indessen die in den Briefen erkennbare Beharrlichkeit, mit der Clara Wieck ihre Entwürfe verteidigte. Sie wären in ihrem »Urtheil oft weit von einander« entfernt, konstatierte Schumann. »Daß wir uns darüber später ja keine bitteren Stunden machen!« (Bw, S. 562 und 629). Die Idee einer schöpferischen Künstlergemeinschaft hatte bereits die Literaten des Sturm und Drang fasziniert, die sich 1772 im Göttinger »Hainbund« zusammentaten. Zwar löste sich der studentische Männerclub mit dem Ende der Studienzeit seiner Mitglieder 1775 wieder auf. Erhalten blieb aber der von Heinrich Voss herausgegebene Musenalmanach als Publikationsorgan. Dieses Vorbild mochten die Brüder Schlegel im Sinn gehabt haben, als sie 1798 mit dem Athenäum die führende Zeitschrift der literarischen deutschen Frühromantik gründeten. Als »Castor und Pollux« sprudelten auch Achim von Arnim und Clemens Brentano in ihren gemeinsamen Fantasien vor geplanten »Liedern der Liederbrüder«, die sie im Männerbund dichten wollten. Daraus wuchs das Projekt Des Knaben Wunderhorn, dessen zwei Teile 1805 und 1808 erschienen. Während von Arnim seine Künstleridylle dann in der Ehe mit Bettina Brentano fortzufuhren gedachte, erhoffte sich Clemens Brentano von seiner Lebensgefahrtin hauptsächlich eine Stütze seiner emotionalen Exaltationen zwischen manischer Schwärmerei und destruierender Depression (Schultz 2002, S. 96ff). Einen die homonomen Grenzen erweiternden Ort bildete die 1799 in Jena bezogene Wohnung von Dorothea Veit, Friedrich, August Wilhelm und Caroline Schlegel, wo sich für kurze Zeit eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft etablierte, in der auch Novalis, Tieck und Schelling häufig zu Gast Drei Romanzen op. 11
203
waren. Ahnliche Ziele, nämlich die gemeinschaftliche Produktion von Kunst, setzten sich auch Lord Byron, Ciaire Clairmont, der Arzt Polidori und das Dichterpaar Mary und Percy B. Shelley. In dieser Gemeinschaft wurde 1816 Mary Shelleys Roman Frankenstein konzipiert. Schon ihre Eltern, Mary Wollstonecraft und William Godwin, hatten eine Künstlergemeinschaft gebildet und - in getrennten Wohnungen - ein umfangreiches Werk hervorgebracht (Schabert 1997, S. 420ff). Beispiele für produzierende Paare, wie die Geschwister Dorothy und William Wordsworth oder Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdy (zumindest während der Jugendjahre) waren bekannt. Ebenso inspirierten sich George Sand und Frédéric Chopin. In ihrer acht Jahre dauernden Lebensgemeinschaft schufjeder 30 Werke. Sand störten die durch die Nacht flirrenden Klaviertöne Chopins schon in der Kartause von Valdemosa nicht. Ihr Landgut in Nohant war ohnehin weitläufig genug, um sich notfalls aus dem Weg zu gehen, und in Paris bewohnten sie zwei nebeneinander liegende Pavillons. Liszt und Marie d'Agoult bildeten eine Zeitlang eine literarische Produktionsgemeinschaft, in der d'Agoult Liszts literarische Ideen zu Artikeln für die Gazette Musicale ausformulierte. Ihr Anteil daran blieb auf Liszts Wunsch jedoch anonym. Bei den Frühromantikern funktionierte die Einrichtung eines produzierenden Gemeinschaftsbundes nur während des Studiums. In den künstlerischen Ehebund der Schumanns flössen dagegen neben einschlägigen frühromantischen Vorbildern zudem Reste einer langen handwerklichen Tradition familiärer Arbeitswerkstätten mit ein, in der alle Mitglieder an der musikalischen Produktion und Reproduktion beteiligt waren. Doch ging der Plan einer Kollektivsignatur noch über ein gut funktionierendes, sich wechselseitig ergänzendes Arbeitsteam und auch über sympoetische Veröffentlichungen in einem entscheidenden Punkt hinaus. Er implizierte eine künstlerische Symbiose. Solche Vorstellungen wurden durch die Intimität einer Kernfamilie, in der die Partner in familiärer und wirtschaftlicher Autonomie als Liebes- und Lebensgemeinschaft zu Hause arbeiteten, wesentlich verstärkt. Im symbiotischen Kollektiv konnte mit der Innen- zugleich eine Außenperspektive eingenommen und so der kreative Spielraum ins Unendliche ausgedehnt werden. Allerdings barg es auch stets die Gefahr, das eigene Ich zu verlieren. Insofern hielten sich Faszination und Furcht die Waage. Negative Aspekte wie Rivalität und Konkurrenz fehlten im Idealmodell. Auch die schwierige Situation, sich mit einem jeweils andersartigen Arbeitsstil des Partners auseinandersetzen zu müssen und gelassen zu bleiben, wenn der oder die andere genau das nicht tat, was man selber für den besten Ansatz hielt, taucht im gemeinsamen Ehetagebuch der Schumanns kaum explizit auf. 204
Paar-Konzepte
Aus den heute erhaltenen Dokumenten lässt sich eine wechselseitige, sich ergänzende Unterstützung zweier sehr unterschiedlich arbeitender Partner rekonstruieren. Lange vor der Ehe bestanden bereits Formen künsderischer Arbeitsteilung. Beide gaben sich gegenseitig ein erstes Feedback ihrer Kompositionen, und sie bildeten sich gemeinsam musikalisch weiter. Clara Schumann probte neueste Stücke, wie die später in Robert Schumanns Klavierkonzert op. 54 eingegangene »Fantasie in A-Moll« im August 1841 im Konzertsaal {Tb 2, S. 180), arrangierte Klavierauszüge und Klavierfassungen seiner Werke, half beim Einrichten der Partituren und Kopieren der Stimmen. Sie brachte seine Werke zum Klingen und garantierte deren Fordeben im Repertoire. Oft nahm sie aktiv an der Probenarbeit von Chor- und Orchesterwerken teil, vor allem in Dresden und Düsseldorf. Gegenseitig erledigten sie Korrespondenzen füreinander, exzerpierten Gedichte und Schriften. Im Alltag überwog Clara Schumanns Anteil darin, ihrem Mann den Rücken frei zu halten und einen funktionierenden, störungsfreien Haushalt hinzubekommen. Sie organisierte die privaten Voraufführungen und Hauskonzerte und kümmerte sich um das Wohl der Gäste. Tagtäglich galt es, für die nötige Ruhe im Haus zu sorgen. Daran mussten sich auch die Kinder halten. Notfalls schirmte sie ihren Mann sogar ab, wie im Dresdner Maiaufstand 1849, als die Bürgerwehr sich in ihrer Straße aufstellte und Schumann dazu haben wollte. »Nachdem ich ihn zweimal verleugnet, die Leute aber drohten, ihn suchen zu wollen, flüchteten wir mit Marien zur Gartentür hinaus auf den böhmischen Bahnhof« (in: Litzmann 2, S. 186). Umgekehrt war Robert Schumann auch ihr erster Hörer und Rezensent. Außerdem verwaltete und ordnete er ihre Autographe und Entwürfe, führte Verhandlungen mit Verlegern um ihre Kompositionen und beriet sie in inhaltlichen Fragen. Er lenkte in ihre Konzertpläne ein, wenn auch widerstrebend und mit Mendelssohns Unterstützung mehr oder weniger dazu gedrängt. Gelegendich beschäftigte er sich auch allein mit den Kindern, am liebsten, um mit ihnen musikalische Überraschungen »für Mama« einzuüben. Ausgelöst durch die unzulänglichen akustischen Verhältnisse herrschte bei der Verteilung der Arbeitszeit tatsächlich von Beginn an eine krasse Asymmetrie, die alle zuvor so rosig visionierten symbiotischen Fantasien mit einem Hieb über den Haufen warf und ihre Gemeinschaft in eine empfindliche Schräglage brachte. Doch jetzt gleich wieder eine neue Wohnung suchen, nachdem die Wände kaum trocken waren? Hier setzte Robert Schumann seine Interessen durch, sehr wohl im Bewusstsein einer Einseitigkeit. »Sie muß meine Lieder so oft durch Stillschweigen und Unsichtbarkeit erkaufen« (Tb 2, S. 127). Clara Schumann stand zurück, wenn auch nicht klaglos. Nach dem Frühstück durfte
Drei Romanzen op. 11
205
er sich in sein »Stübchen« zurückziehen, während sie ihre beste Übezeit, die Morgenstunden, nicht professionell nutzen konnte, sondern auf den frühen Abend verlegte, wenn er ins Kaffeehaus ging. Hinzu kamen noch die Schüler beider, die den Zeitraum weiter einengten. »Wenn ein Mann eine Symphonie componirt, da kann man wohl nicht verlangen, daß er sich mit anderen Dingen abgiebt — muß sich doch sogar die Frau hintenangesetzt sehen!« Clara Schumann meldete freundlich ihre Bedürfnisse an. Der im Schaffensfieber Komponierende blieb weiterhin unzugänglich. »Zuweilen kränkt mich diese Kälte«, mahnte sie. Später drohte sie an: »Ich möchte mich wohl auch bei ihm als Schülerin melden, ich hätte dann öfter das Glück, ihm vorspielen zu dürfen« (Tb 2, S. 141ff. und 183). Ihr blieb die Übung, auf Zehenspitzen durch die Wohnung zu schleichen. »Kein Laut durfte ihn in der Zeit stören, weswegen die Tür zu dem Zimmer, wo Frau Schumanns Instrument stand, zugenagelt und mit Matratzen verstopft war«, so beschrieb Sabinina die Dresdner Wohnsituation 1850 (in: Lossewa 1997, S. 204). Der Egoismus dieser dicht gedrängten Kreationstage entsprang nicht zuletzt der Panik, dass die wertvollen gedanklichen Entwürfe sich verflüchtigten, wenn sie nicht schnell genug festgehalten werden konnten. Dieses Getriebensein kannte sie aus eigener Erfahrung. Beide ließen sich während des aufreibenden Gestaltungsprozesses, wo die in der Fantasie schwebende Musik in einem konkreten Tonsatz auf Papier materialisiert werden musste, weder gern unterbrechen, noch in die Karten blicken. Daher wartete auch Clara Schumann lieber ab, bis ihr Mann das Haus verlassen hatte, um frei schaffen zu können. »Alle Zeit, wo Robert aus war, brachte ich mit Versuchen, ein Lied zu componiren« zu (Tb 2, S. 134). Zwar war es in Clara Schumanns Sinne, dass ihr Mann ungestört produzierte, und in kreativen Intensivphasen war sie bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Schließlich hatte sie sich zugetraut, diesen inspirierenden, dabei psychisch komplexen und labilen Künstler glücklich zu machen, indem sie ihm ein sorgenfreies Leben ermöglichte. Doch wollte sie nicht auf diese Weise den Preis für sein Werk zahlen. Die von Robert Schumann halbherzig versprochene Umkehrung der Unterstützung blieb ebenso aus wie seine schon im Dezember 1840 versprochene Aussicht, eine Lösung zu finden, »daß Klara spielen kann, so oft sie Lust hat« (Tb 2, S. 132 und 149). In ihren gemeinsamen Plänen hatte die Braut zwar gelobt, die Künstlerin mit der Hausfrau zu vereinigen, nicht aber, die erste durch die zweite zu ersetzen. Den Haushalt erledigte ohnehin das Personal, und Clara Schumann wollte ihre Zeit nicht ausschließlich mit den für bürgerliche Frauen üblichen stillen Hand- und Dekorationsarbeiten oder mit Blumengießen verplempern. Das 206
Paar-Konzepte
hätte der idealen Künstlergemeinschaft fundamental widersprochen, kam allerdings Robert Schumanns in den Tagebüchern niedergelegten Wünschen doch sehr nahe. Das Üben konnte auf andere Tageszeiten verschoben werden, wenn auch ungern. Aber auch zum Komponieren brauchte sie - zumindest phasenweise den Klangrausch, der sie animierte und ihr ermöglichte, sich kreativ zu entfalten. Dazu reichte allerdings das kleine Zeitfenster am späten Nachmittag kaum. Da beide nicht parallel schaffen konnten, wiederholte sie ihren Vorschlag, auf internationalem Parkett zu konzertieren, während ihr Mann in Ruhe Sinfonien und Konzerte entwerfen könnte. Es spräche nichts gegen ihr Reisen, so Clara Schumann an Emilie List und sie fasste ihre Rolle in den bemerkenswerten Satz: »Ich bin eine Frau, versäume zu Hause nichts, verdiene nichts« (in: Wendler, S. 11). Vom eingespielten Gewinn hätte man auch eine andere Wohnsituation herstellen können. Das Aushandeln der Arbeitszeit blieb ein beharrlicher Streitpunkt, nicht zuletzt deshalb, weil beide unabhängig voneinander davon überzeugt waren, dass sie ihre Kräfte jetzt, so lange sie jung waren, nutzen müssten. Ganz im Sinne des vormärzlichen Jugendkults hatte Clara Wieck schon mit gut zwanzig Jahren befurchtet, zu alt zum Heiraten zu sein. Ihren Schaffensdrang begründete sie mit einem hohen Berufsethos. »Täglich wenigstens zwei Stunden« zu üben bezeichnete Clara Schumann sogar noch im neunten Schwangerschaftsmonat als »Pflicht an mir selbst« {Tb 2, S. 178). Hier konkurrierten die beiden tatsächlich um Ressourcen und um Zukunftschancen. Auch die Schumanns kannten ihre empfindlichsten Punkte genau und wussten sich zu verletzen. Clara Schumann benutzte dazu offenbar das Lamento über die wirtschaftliche Situation, Robert Urteile über ihr Spiel. Ein uneingestandenes Motiv dürfte seine unterschiedlich akute Eifersucht auf ihre professionelle Karriere, die Publikumsgunst und die allgemeine öffentliche Anerkennung gewesen sein. Sie beneidete ihn umgekehrt um die ausgefüllte Berufszeit und die Möglichkeit, uneingeschränkt musikalisch arbeiten zu können. Hirschbach beurteilte die Lage schonungslos: Schumann wäre die Karriere nur gelungen, weil »der schützendes Genius seiner Clara«, des »Lieblings Leipzigs«, ihm über die Klippe geholfen hätte. »Freilich Schumann selbst mochte davon nichts wissen« (in: Borchard 1991, S. 195f). Schumann setzte sich sehr stark unter Erfolgsdruck. In Krisensituationen entlastete er sich in Form einer nur mäßig gezügelten, aggressiven Kritik an ihren Interpretationen. Dieser Zug verschlimmerte sich womöglich in dem Maße, wie Schumann gleichsam das Leben davonzuschwimmen begann Drei R o m a n z e n op. 11
207
und die Schwankungen zwischen Depression und Agression mit Stadien des Kontrollverlusts einhergingen. Das gab Anlass zu dramatischen Szenen, auch Ubergriffen. Offensichtlich gelang es immer wieder, Kompromisslinien zu definieren, sonst hätte Clara Schumann nicht allein den virtuosen Standard halten, sondern zwischen 1840 und 1847 Lieder (u. a. op. 12, op. 13), Klavierstücke (op. 14, op. 15), eine Sonate (WoO), Präludien und Fugen (op. 16), ein Klaviertrio (op. 17) und ein Konzertfragment komponieren können. Kleine Fluchten zum Klavierspiel boten etwa die Phasen, in denen Robert Schumann nicht gerade komponierte, sondern Korrespondenzen oder die umfangreichen Buchführungen erledigte. Die Tagebücher geben die Aushandlungen nur bruchstückhaft wieder. Vielmehr spiegeln sie ein stetes Einschwenken Clara Schumanns auf die Linie ihres Mannes. Abgesehen von einer literarischen Pose dürfte ein Stück weit auch eine Form von Selbstschutz darin liegen, ihren Mann in kritischen Phasen nicht noch mehr zu reizen. »Einige kleine Urtheile [ . . . ] hätte ich mir gern noch erlaubt«, schrieb sie nach einem Quartettabend, »doch furchte ich, mein lieber Robert, Du erzürnst Dich gleich, und ärgern will ich Dich nicht« (Tb 2, S. 144) - auch eine Form von Gesprächsangebot. Bezeichnend ftir ihre Haltung ist, was sie über die Ehen der von ihr sehr geschätzten Wilhelmine Schröder-Devrient dachte. Es wundere sie nicht, »daß kein Mann mit ihr zu leben im Stande« sei, da ihr »das feine Gefühl« fehle, »das einen lehrt, die schwachen Seiten anderer mit Zartheit zu behandeln« (in: Litzmann 2, S. 120). Schließlich galt es auch, den Partner nicht vorzufuhren. Währenddessen behielt Clara Schumann im Hintergrund sehr wohl die Fäden für das Wohlergehen ihrer jungen Familie in der Hand. Drohte die biedermeierliche Idylle tatsächlich wirtschaftlich abzustürzen, so zog sie die Reißleine und organisierte Tourneen. Sie wusste, welchen Freund sie in Mendelssohn Bartholdy hatte, der Schumann von der Notwendigkeit ihres Konzertierens überzeugte. Trotz der erkennbaren Asymmetrie zwischen beiden verteilte sich die Künstlergemeinschaft doch nicht vollständig in das komplementäre Modell eines produzierenden männlichen und reproduzierenden weiblichen Pols, auch wenn Clara Schumann diese Sichtweise später kultivierte. Der Erhalt von Clara Schumanns professionellen Kompetenzen, einschließlich der Komposition, spielte in der Auseinandersetzung vermutlich eine größere Rolle, als die Tagebücher wiedergeben. Erst die gegenseitige Augenhöhe garantierte ja einen Expertendiskurs und das Verständnis für die Leistungen, etwas, das sie sich nicht nur emotional, sondern auch als künstlerische Solidargemeinschaft voneinander wünschten, wie in der Präambel des Ehetagebuchs fixiert wurde: »Es kömmt genau hinein, was Du vorzüg208
Paar-Konzepte
lieh studirt, was Du componirt, was Du Neues kennengelernt hast und was Du davon denkst; dasselbe findet bei mir statt«, so Robert Schumann {Tb 2, S. 100). Auch wenn das Paar nicht ausschließlich untereinander kommunizierte, so bot doch das Gegenüber zu Hause die erste Resonanz für Clara wie für Robert Schumann. Nach den Liedern wirkte sich die Erfahrung mit Robert Schumanns Kammermusik auf die Beschäftigung Clara Schumanns mit Sonatenkonzepten aus, ihr eigenes Klaviertrio reizte ihren Mann, sich wieder näher mit der Gattung zu befassen, und sein Klavierkonzert animierte sie zum Entwurf eines zweiten. Auch zu seiner Dresdner Chorproduktion 1848 steuerte sie drei Stücke für gemischten Chor bei. Noch zwei Jahre zuvor hatte der Verlag Breitkopf 8c Härtel sie erfolglos um Vokalquartette gebeten (in: Steegmann 1997, S. 31). Von Hermann Härtel kam im Dezember 1845 der Vorschlag, ein Doppelporträt der Schumanns zu verbreiten. Bislang konnten nur Einzelbildnisse, vor allem von der berühmten Virtuosin, vom Publikum erworben werden. Je bekannter auch Robert Schumann wurde, desto mehr wuchs die Nachfrage nach Bildmaterialien des in der Öffentlichkeit inzwischen als mustergültig stilisierten Künstlerpaars. Man einigte sich, den Dresdner Bildhauer Ernst Rietschel zu beauftragen, der zwei Jahre zuvor ein Denkmal des sächsischen Königs angefertigt hatte (Porträts, S. 49£; Rietschel, S. 11ff.und 162ff). Rietschel war ein gefragter Porträtist. Von ihm stammt auch das monumentale Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. Die exklusive Wahl bezeugt, wie hoch man die wachsende Prominenz des Künstlerpaars einschätzte. Ganz im Sinne der Selbstpräsentation der Schumanns, aber durchaus auch mit Blick auf die öffentliche Funktion, die der Auftrag erfüllen sollte, entwarf Rietschel ein Relief-Medaillon, das die Idealisierung der Künsdergemeinschaft in zweifacher Hinsicht verstärkte (Abb. 7). Einmal betonte das Bildmotiv, ein Doppelporträt im Profil, die Gleichrangigkeit der gemeinsam der Kunst dienenden Partner. Rietschel folgte hier einer Darstellungstradition, die meist Männern vorbehalten blieb, etwa den Gelehrten Jacob und Wilhelm Grimm oder den Humboldts. Darüber hinaus enthoben die strenge klassizistische Komposition sowie die glättende Uberformung der Köpfe mit ihren korrigierenden Konturen die Porträtierten der Alltäglichkeit. Beide wurden ästhetisch idealisiert, sowohl Robert Schumanns gemütliches Profil als auch das seiner Frau, die zur Zeit der Modellsitzungen in Rietschels Dresdner Atelier Ende Januar 1846 kurz vor der Niederkunft des vierten Kindes stand, das am 8. Februar geboren wurde, während das Medaillon ein klassisch proportioniertes, glattes, schlankes Mädchenprofil wiedergibt. Die-
Drei Romanzen op. 11
209
ser überhöhende Charakter fallt besonders im Vergleich zu anderen Partnerbildern auf, wie etwa von Karl Friedrich Schinkel, der sich und seine Frau im Dreiviertelprofil in Alltagskleidung und vertraulicher Pose (den Arm um sie legend) als privates Paar mit zerzausten Haaren und Lebensspuren in den Gesichtern porträtierte (um 1810). Rietschel präsentierte stattdessen ein Künstlerpaar, das als »denkmalwürdig« aufgebaut wurde (Busch-Salmen 1996, S. 815f). Zunächst setzten die Schumanns allerdings Rietschel in Verlegenheit, weil sie darum stritten, welcher Kopf wo stehen sollte (Rietschel, S. 249; Tb 3, S. 412 und 755f). Im ersten Entwurf hatte der Bildhauer nämlich das Frauenprofil in den Vordergrund gesetzt, eine Anordnung, die auch Ferdinand Hiller unterstützte. Für Clara Schumanns Positionierung im Vordergrund sprachen ihre internationale Bekanntheit und nicht zuletzt auch ästhetische Gründe. Ihr Mann beharrte indessen auf dem Vorrang des Komponisten vor der Virtuosin und unterstrich damit das Gefälle im Partnerideal. Er bekam, was er wollte. Das Doppelporträt entpuppte sich als Verkaufsschlager, dessen Erfolg bis ins 20. Jahrhundert anhielt. Der Stecher Friedrich Schauer stellte im Auftrag des Verlags auch eine Stahlradierung her. Sie kostete 15 Neugroschen und kam 1848 als Beilage der Allgemeinen musikalischen Zeitung heraus. Nach der Vorlage Rietschels arbeitete Theodor Benedikt Kietz 1850 eine Elfenbeinminiatur in länglichem Format aus, an den Seiten jeweils von stilisierten Lorbeerzweigen flankiert, die man auch als Brosche für vier Friedrichsdor (etwa zwanzig Reichstaler) erwerben konnte, und er setzte den Entwurf außerdem als Stahlstich um. Diese Miniaturkopie sandte Clara Schumann ihrem Mann im September 1854 nach Endenich (Porträts, S. 49ff. und 121ff.; Endenich, S. 143). Zur Ausgabe des Doppelmedaillons hatte Johann Christian Lobe zwei biografische Notizen verfasst, die dem gleichen Aufbauschema folgen. Das heißt, Lobe unterschied nicht wischen männlicher und weiblicher Biografie. Vielmehr konzentrierte er sich bei beiden strikt auf die künstlerische Entwicklung (in: Porträts, S. 121ff). In einem Fall, am Anfang ihrer Ehe, war die Idee einer Kollektivsignatur, die das Rietschelsche Medaillon plastisch präsentierte, tatsächlich gelungen. In der ersten Jahreshälfte 1841 entstanden die Zwölf Gedichte aus F. Rückerts Liebesfrühling für Gesang und Pianoforte. Sie erschienen im selben Jahr im Verlag Breitkopf 8c Härtel unter den Namen Clara und Robert Schumann mit den unterschiedlichen Opuszahlen 12 (Clara Schumann) und 37 (Robert Schumann) als gemeinsamer Zyklus, ohne dass die Autorschaft der einzelnen Lieder gesondert gekennzeichnet war.
210
Paar-Konzepte
Liederfrühling und Schubiadenschätze Kompositionen der frühen 1840er Jahre Schon vor der Hochzeit hatte Schumann seine Braut zu animieren versucht, Lieder zu schreiben und ihr gelegentlich Gedichte zur Lektüre geschickt mit der Bitte, eine Auswahl anzukreuzen. Auch bei der Suche nach einem Opernstoff bezog er sie ein. Sie möge Hoffmanns Erzählung Doge undDogaressa lesen, »denke Dir alles auf den Brettern: sag mir Deine Ansicht, Deine Bedenklichkeiten«. Noch zündete der Funke nicht. »Denkst Du etwa, weil ich so viel componire, kannst Du müßig sein«? »Hast Du angefangen, so kommst Du nicht wieder los« ( B w , S. 980f). Während ihrer Ausbildung hatte Clara Wieck Gesangsstunden bei dem Dresdner Sänger und Gesangspädagogen Johann Aloys Miksch genommen und gelegentlich auch selber eigene Lieder aufgeführt. Zwischen 1834 und 1836 arbeitete sie außerdem mit dem Liederkomponisten Carl Banck zusammen. Schon vorher entstand vermutlich das einzige eindeutig identifizierbare Beispiel von mehreren in den Jugendtagebüchern erwähnten Liedern ihrer Mädchenzeit, nämlich ein 1834 publizierter Walzer (WoO) auf einen Text von Johann Peter Lyser. Inzwischen gelten auch die ursprünglich unter Friedrich Wiecks Namen erschienen Kerner-Lieder »Der Wanderer« (WoO) und »Der Wanderer in der Sägemühle« (WoO) als frühe Kompositionen von Clara Wieck. Zumindest für den »Wanderer« existiert ein Aufführungsbeleg. Danach wurde das Lied zusammen mit einem nicht erhaltenen dritten Kerner-Lied (»Alte Heimath«) am 13. Dezember 1831 in Kassel aufgeführt (Draheim/Höft 1992,2, S. 4f). Angesichts der übersprudelnden Liederfülle Schumanns verwundert es nicht, dass die Künstlerin zunächst zögerte, bevor sie die Herausforderung annahm. Vorsichtshalber stapelte sie tief: »Ein Lied, das kann ich gar nicht, ein Lied zu componiren, einen Text ganz zu erfassen, dazu gehört Geist« (Bw, S. 984). Erst im Spätherbst 1840 begann sie sich erneut mit Liedkompositionen auseinanderzusetzen. Zwischen 1840 und 1853 entstanden fünfundzwanzig Lieder. Es wäre ihr endlich gelungen, »Dreie zu Stande zu bringen«, vermeldete sie im Dezember 1840, nämlich die Lieder »Am Strande« von Robert Bums und die beiden Heine-Vertonungen, »Ihr Bildnis« und »Volkslied«. Sie wären allerdings »von gar keinem Werth, nur ein ganz schwacher Versuch«, ließ sie im Ehetagebuch wissen (Bw, S. 980ff; Tb 2, S. 134). Robert Schumann bekam sie mit der devoten Widmung »in tiefster Bescheidenheit« zu Weihnachten geschenkt, eine durchaus gängige Methode, um Kompositionen der frühen 1 8 4 0 e r Jahre
211
dem unmittelbaren Konkurrenzdruck auszuweichen. Mit diesen Liedern hatte Clara Schumann indessen eine musikalische Sprache gefunden, die die Pläne einer Kollektivsignatur aktualisierten. »Wir haben die hübsche Idee sie mit einigen von mir zu durchweben und sie dann drucken zu lassen«, hielt Robert Schumann fest (Tb 2, S. 134). Lieder waren sozusagen die »Popmusik« der zeitgenössischen intellektuellen Avantgarde, weil sie in einem Format von zwei bis drei Minuten ein Maximum an Gefühlsausdruck ermöglichten. Wer 1840 Kunstlieder schrieb, ging nicht naiv mit Texten um, sondern hatte eine genaue Vorstellung von Poesie. Allein die bibliophile Aufmachung von Gedichtbänden, Anthologien und Almanachen bestätigten das Besondere darin. Von Gedichten wurde Verzauberung erwartet, eine artifiziell gestaltete, ästhetisch geformte Sprache sowie ein untergründig komponiertes Konzept. Man war sensibilisiert für spezifisch poetische Elemente, wie das oszillierende Spiel von Mehrdeutigkeiten, den beredten Umgang mit Nicht-Gesagtem, den affektiven Einsatz von Schlüsselreizen im Vokabular, von syntaktischen Raffinessen und semantisch Unvorhersehbarem, für eine durchgestaltete Metrik, lebendige Rhythmen, betörende Farben oder verstörende Klänge. Lesen ist ein interaktiver Vorgang, bei dem visuelle Wortmuster und bildliche Satz- oder ganze Textformen dekodiert, zugleich aber die Informationen mit eigenem, selbst erworbenem Vorwissen abgeglichen werden, und zwar unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwelle, wie Sabine Groß die Ergebnisse kognitionswissenschaftlicher Leseforschung zusammenfasst (1994, S. 13ff). Danach bedeutet Lesen, in den Prozess einer aktiven Sinnkonstruktion einzutreten, indem während des Vorgangs, mitten in einem Satz oder einer Phrase, ständig Vermutungen angestellt oder Vorausentscheidungen getroffen und revidiert werden. Sowohl semantische als auch syntaktische Elemente geben den Lesenden mehr oder weniger deudich eine Richtung vor, aktivieren ihr Handlungswissen und lösen damit vorausschauende Bedeutungskonstruktionen aus (Groß 1994, S. 17). Literarische, und vor allem poetische Texte unterbrechen den gewöhnlichen Leseautomatismus. Sie erzwingen Langsamkeit. Die im Text angestoßenen Assoziationen lenken von Bekanntem fort, übliche Lesestrategien funktionieren nicht. Um zu verstehen, was gerade passiert, wandern die Augen wieder zurück, lesen genauer, schauen voraus, bleiben sinnend an einem Wort haften. Man beginnt noch einmal. Lyrik liest sich nicht ausschließlich linear. Vielmehr verführt die rätselhafte Sprache zum Suchen und Entdecken. Verknappte Diktionen fordern zu eigenen Ergänzungen heraus. Dieser 212
Paar-Konzepte
von der Autorintention steuerbare Prozess lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die sprachlichen Kunstmittel selbst. Für die Leser entfaltet sich das Herumstreifen im Unbekannten als hedonistischer Akt, dessen ästhetisches Vergnügen durch die Herausforderung eines neu zu konstruierenden Sinns gesteigert wird. Autoren können bestimmte »Wegweiser« anlegen und die Leser zwar lenken. Doch bleibt die Aneignung individuell. Eigene Erfahrungen, Lebensalter, psychophysische Konstellationen, das soziale Umfeld, Bildung und möglicherweise auch die Genderprägung spielen eine Rolle, abhängig von zeitgenössischen Gefuhlsdiskursen und der Lesesituation. Daher bleibt das Urteil über ein Textverständnis historischer Personen riskant. Welche Tücken rückwärtige Projektionen bergen, verdeutlicht ein von Sabine Groß zitierter Beispielsatzes: »Er flog nach Kairo« (1994, S. 20). Heute der modernen Verkehrstechnik zugeordnet, gehörte der Satz um 1840 in den Kontext des Wunderbaren und verwiese für die Schumanns auf fliegende Teppiche im Märchen oder auf die fantastische Luftschifffahrt des Giannozzo aus Jean Pauls Roman Titan. Während man sich darüber leicht verständigt, erweist sich die Diskussion um einen zeitabhängigen Gefuhlskontext als weitaus heikler. Da Gefühle zu anthropologischen Grundkonstanten gehören, fällt es schwerer, die eigenen bei der Lektüre romantischer Dichtung ausgelösten Empfindungen von denen der lesenden Schumanns, genauer, den individuellen von Clara oder Robert Schumann, zu trennen. Trotzdem muss davon ausgegangen werden, dass manche emotionale Schlüsselreize in den Liedern unter- oder überschätzt werden, weil ihre Gefühls- und Erfahrungswelt zu weit von der heutigen entfernt liegt (Brändle u. a. 2001, S. 9ff). Der Horizont der Lyrik-Leserin Clara Schumann kann kaum überzeugend erschlossen werden. Es fehlen verlässliche Informationen über Textwahl und Leseverhalten. Sie las nicht ausschließlich, was Robert Schumann oder Emilie List ihr empfahlen, auch wenn Vorschläge herzlich willkommen waren und sie sich für die Vertonung offensichtlich auf Schumanns Rat verließ. Inwieweit die ausgewählten Textvorlagen den eigenen Stimmungen entsprachen, ob sich die Komponistin mit den Inhalten identifizierte oder ob es sie reizte, sich fantasievoll in bestimmte Situationen eines lyrischen Ichs einzufinden, lässt sich nicht festlegen. So dürfte auch für Clara Schumann die Erfahrung zugetroffen haben, dass die eigene emotionale Erregung und deren künstlerische Umsetzung zwei verschiedene Vorgänge waren. Der kreative Akt des Komponierens erforderte einen gewissen Abstand zu den in Töne umzusetzenden Emotionen. Es »ist sonderbar, dass ich da, wo meine Gefühle am stärksten sprechen, aufhören muß, Dichter zu seyn«, hatte sich Kompositionen der frühen 1 8 4 0 e r Jahre
213
Schumann als Siebzehnjähriger notiert. Wo »aber mein eignes Selbst nicht mitzufühlen braucht, wo nur die Phantasie u. ein Gedanke herrschen muß, dicht'ich freier, leichter u. besser« {Tb 1, S. 30). Sicher spielte Clara Schumann ihre eigene Textkompetenz sowohl ihrem umfassend belesenen Mann als auch der literarisch gebildeten Freundin List gegenüber herunter. »Du fragst mich, ob ich nicht von Göthe lese, was denkst Du? Ich habe keine Zeit«, antwortete sie Schumann aus Paris 1839. Sie läse »französische Commedien von Beaumarchais« und wollte »später nachholen«, sich mit deutschen Dichtern zu beschäftigen. »Ich fühle mich manchmal recht unglücklich in mir selbst - wenn ich mich so in meinem leeren Kopf umsehe«. Sie behauptete 1840, von Byron »nie Etwas« erfahren zu haben, dabei hatte der Schriftsteller Ernst August Ortlepp ihr im Januar 1839 in Stuttgart einen Band mit eigenen Übersetzungen von Byron-Gedichten geschenkt (Bw, S. 556; Tb 2, S. HOf. Jb, 26. Januar 1839). In der erzwungenen Stille während der ersten Ehemonate hatte sie offenbar genug Freiraum zum Lesen. Jedenfalls nahm Walter Scotts Roman Das Herz von Mid-Lothian Anfang Dezember 1840 »alle meine Gefühle in Anspruch«, wie sie schrieb, vor allem durch die Lebendigkeit der Charaktere, die »Einem vor der Seele stehen«, eines ihrer raren literarischen Urteile {Tb 2, S. 131). Die Affinität von Lyrik zur Musik beruht bekanntlich auf den poetischen Schallformen, nämlich Ton- und Klangfarbe, Versmetrik, Rhythmus, Melodie, Lautfolge und -Verteilung, Akzente, Tempo, Dynamik oder Pausen, die den individuellen Klangcharakter jedes Gedichts prägen. Er lässt sich durch eine analoge Musikalisierung ästhetisch überhöhen. Doch eine viel ambitioniertere Herausforderung lag um 1840 darin, die medialen Verschiedenheiten von Dichtung und Musik herauszuarbeiten, weil erst die Eigenständigkeit beider Künste eine synästhetische Entfaltung ihrer Potentiale auf der höheren Ebene des Kunstlieds ermöglicht. Hier spielt die Harmonik als genuin musikalisches Mittel eine zentrale Rolle, nicht zuletzt deshalb, weil dadurch der Ausdruck komplexer Gefühlslagen simultan gebündelt werden kann. Poetische und musikalische Schallformen unterscheiden sich neben qualitativen Merkmalen unter anderem in der ästhetischen Bewertung. Während im 19. Jahrhundert die metrisch strenge Bindung Verse von Prosa trennte und aus dem Alltäglichen heraushob, gehörte in der zeitgenössischen artifiziellen Musik eine regelhafte Metrik, notiert in Takten, zur grammatikalischen Basis. Dagegen befreite sich musikalische Poesie - zumindest im ästhetischen Verständnis Robert Schumanns - von den metrischen Fesseln, wie die außerhalb der Taktschwerpunkte »schwebende« Melodie von Clara Wiecks 214
Paar-Konzepte
Notturno oder die atemlosen prosodischen Phrasen in ihrer Ballade (op. 6 Nr. 2 und Nr. 4). »Metrisch-rhythmische Verwirrspiele, asymmetrische Syntax, musikalische Rezitative und die Auflehnung wider die Tyrannei des Taktes«. (Appel 1991, S. 13) kennzeichneten die kreative Auseinandersetzung damit. Wenn Schumann im letzten Stück der Kinderszenen op. 15 den »Dichter« sprechen lässt, so bricht die Melodie aus dem metrischen Gerüst aus und bewegt sich ungebunden weiter, ein extremes Mittel, um die poetische Freiheit von Musik zu behaupten. Diese spezifische Poesie entwickelte Schumann als musikalisch autonome Kunstform, auch wenn sie durch literarische Anstöße inspiriert war. Beides, romantische Poesie wie Musik, leben von Unsagbarkeitstopoi, was sie nicht bloß als emotionale »Herzenssprache« attraktiv macht, sondern nach Auffassung der Frühromantik für die Funktion von Kunst als sinnliche Vermittlung des Absoluten prädestiniert. Auch hier sind die Unterschiede der medialen Mittel größer als ihre Gemeinsamkeiten, wie etwa Aussparungen durch textliche oder harmonische Ellipsen. Gedichte fahren ein ganzes Arsenal poetischer Stilmittel zur Substitution des Unsagbaren beziehungsweise zur Erzeugung diffuser Mehrdeutigkeit auf, wie Wort-, Satz-, Gedankenoder Klangfiguren. Ihren Sinn konstruieren Lesende in der eigenen Fantasie. Musik verfugt nur in Ausnahmefällen, wie bei Leitmotiven, über denotative Zeichen. Gerade diese Offenheit, Unsagbares erfahrbar zu machen, indem Stimmungen, Atmosphären aufgebaut werden, die die Verse umhüllen, ihre Botschaft verstärken, in eine bestimmte Richtung lenken oder eine von der Wortbedeutung abweichende semantische Ebene etablieren, psychologisieren oder konterkarieren, definierte den hohen Rang von Musik im romantischen Poesiekonzept. Im artifiziell organisierten Klang wird das Unbenennbare des Gefühls kodiert und somit allgemein kommunizierbar. Darin liegt die Attraktion einer musikalischen Poesie. Die Entscheidung der Komponierenden, Vers- und Strophenformen zu übernehmen oder die dichterische zugunsten einer eigenen, musikalischen Komposition aufzulösen, ist ein ästhetischer Akt der Sinnkonstruktion. Bei der Wahrnehmung von Musik lassen sich nach Ulric Neisser wie beim Lesen interaktive Vorgänge beobachten. Danach entwickeln Hörer »andauernd mehr oder weniger spezifische Bereitschaften (Antizipationen) für das, was als nächstes kommen wird«, und vergleichen die eintreffenden akustischen Signalen mit den erlernten Schemata (Neisser in: Mosch 2004, S. 133). Sie können bedient oder umgangen werden. Da Musik sich in Raum und Zeit entfaltet, geben die Komponierenden allerdings das Rezeptionstempo und den Weg der Aneignung vor. Wann und wo man verweilt, einem Gedanken Kompositionen der frühen 1840er Jahre
215
nachhängt oder zurückblickt, wird etwa durch Dehnungen beziehungsweise Auszierungen von Wörtern oder Wiederholungen fixiert, aber auch durch Änderungen der Harmonik, der Melodie oder des Rhythmus, auch vermittels Modifikationen in der Kooperation von Stimme und Klavier oder Einarbeitung von eigenständigen Verläufen beider, weiterhin durch Hinzufugen von Vor-, Zwischen- oder Nachspielen. M i t der exponierten Tonart, durch Tempo, Takt und Metrik, der Registerwahl sowie durch Entscheidungen für eine individuelle Sprachvertonung stellen Komponierende sozusagen eigene »Wegweiser« auf, die für ihre Lieder gelten. Sie können die literarische Autorintention verstärken, müssen es aber nicht. Gerade die davon abweichenden Wege bieten eine mit ästhetischem Vergnügen verbundene neue Herausforderung. Allerdings werden durch die Autorität der komponierten Lieder als eigenständige Kunstwerke nun auch die exklusive Lesart und der in der Fantasie der einzelnen Komponierenden konstruierte Sinn gleichsam ins Allgemeine gehoben und das in der Notation kodierte Gefühl für alle Interpreten verbindlich - nicht immer zur Freude der Dichterinnen und Dichter. Bei dem ersten, im Dezember 1840 komponierten Lied wählte Clara Schumann Robert Burns' Gedicht »Am Strande« (WoO). Im Zentrum steht ein lyrisches Ich, das sich in eine Traumwelt zurückzieht. In der von Clara Schumann benutzten deutschen Ubersetzung Wilhelm Gerhards verdunkelt sich die Atmosphäre von Strophe zu Strophe. Dagegen hebt die Komponistin andere Momente heraus. Das ganze Lied grundiert eine bewegte pulsierende Unruhe. Anfangs bezogen auf die »Fluth, die uns getrennt«, in der das Meerbeziehungsweise Wasser-Motiv als Chiffre für das Ungewisse steht, wandelt sich die Bewegung allmählich in eine innere des Herzens, die der Gedanke an den fernen Geliebten auslöst. Die Tonart hellt sich nach und nach auf. In Clara Schumanns Vertonung erhält das Tröstliche des Traums mehr Gewicht als der damit verbundene Realitätsverlust. Das Lied wurde in ihrem Comeback-Konzert am 31. März 1841 von der Altistin Sophie Schloß uraufgeführt und kam im Juli 1841 als Beilage zur Neuen Zeitschriftfür Musik heraus. Noch im Januar 1841 konkretisierte Robert Schumann den Plan einer gemeinsamen Liedausgabe und schlug nun die parallele Neukomposition von Liedern aus Friedrich Rückerts Liebesfrühling vor. Den Gedichtband hatte er ihr schon 1837 geschenkt. Für die Komposition traf er offenbar allein eine Auswahl. Vermutlich war vorgesehen, dass jeder sechs Lieder komponierte. Während er seine Beiträge in der zweiten Januarwoche fertig hatte, lieferte Clara Schumann ihre Rückert-Lieder erst Monate später. Anfang des Jahres belasteten sie zunächst erste Schwangerschaftsbeschwerden, dann wurde 216
Paar-Konzepte
die knappe Arbeitszeit fiir die Konzertvorbereitungen genutzt. Komponieren funktionierte nicht auf Knopfdruck. Ohnehin brauchte es Mut, sich an den Kräften eines Kollegen zu messen, aus dem Lieder förmlich heraussprudelten. »Ich habe mich schon einige Male an die mir vom Robert aufgezeichneten Gedichte gemacht, doch will es gar nicht gehen - ich habe kein Talent zur Composition« {Tb 2, S. 141), jedenfalls nicht im Robert Schumannschen Kompositionstempo. Es ging dann aber doch. Zum seinem Geburtstag, am 8. Juni 1841, lagen vier Rückert-Lieder vor. Robert Schumann wählte drei davon aus und gliederte sie an zweiter (»Er ist gekommen«), vierter (»Liebst du um Schönheit«) und elfter (»Warum«) Position in seinen Gesamtentwurf ein. Dass hier noch eine Bearbeitungsstufe zum >Einpassen< ihrer Lieder stattfand, darf man vermuten, es lässt sich allerdings nicht belegen. Der ganze Zyklus folgt nur in groben Zügen der vorgegebenen Text-Dramaturgie. Rückert hatte seinen Liebesfrühling in fünf programmatischen »Sträußen« zusammengefasst: »Erwacht«, »Entflohen«, »Entfremdet«, »Wiedergewonnen« und »Gefunden«. Dagegen entwarf Schumann eine davon unabhängige eigene Ordnung der zehn Sololieder und zwei Duette, nach der die Lieder sich, so Schumann, »wie Frage und Antwort auf einander« bezögen (in: Hallmark 1994, S. 279). Er etablierte ein Strukturprinzip, indem gleiche Aspekte von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Diese unterschiedlichen Perspektiven gehen nicht in weiblich oder männlich auf, selbst wenn ein größerer Teil der von Robert Schumann vertonten Gedichte ein männliches lyrisches Ich und zwei der von Clara Schumann vertonten ein weibliches lyrisches Ich haben. Offenbar spielte hier eher die Tonart-Disposition eine Rolle, wie Rufiis Hallmarks Zusammenstellungen zeigen. Obwohl sie unabhängig komponierten, kannte Clara Schumann die Lieder und Duette ihres Mannes sicher, so dass ihre Vertonungen zumindest ein Stück weit darauf reagiert haben mochten. Die Herausforderung, Lieder zu komponieren, lag nicht allein in der »geistvollen« Reflexion des Textsinns. Darüber hinaus wirkten in der zeitgenössischen Gattung »Lied« zwei zentrale Spannungsmomente zusammen, nämlich einmal das Ansehen des Liedes als unmittelbarer Gefühlsausdruck in der schlichtesten sangbaren Form und zum zweiten der Anspruch einer artifiziellen Komposition. Bei der Vertonung galt es daher, einen Weg zu finden zwischen einfacher Erscheinung und hohem Kunstaufwand. Die Lieder aus dem Schumannschen Liebesfrühling gingen von geschulten Ausführenden aus. Rückerts Vorlagen boten diese Mischung aus schlichten, um Gefühlswahrheit bemühten lyrischen Subjekten bei einem hohen Aufwand an poetischen Kunstmitteln. Clara Schumann verteilte die Rollen auf eine Kompositionen der frühen 1840er Jahre
217
schlichtere Singstimme und einen durch differenziertere Kompositionstechnik gestalteten Klaviersatz. Den Kunstcharakter von Rückerts Versen spiegelten darüber hinaus auch diskrete tektonische sowie klangdramaturgische Entscheidungen, während die anspruchsvolle Harmonik und der Rhythmus, wie auch in Robert Schumanns Liedern, ein zentrales Mittel für die emotionale Interpretation der Gedichte war. Das aus Rückerts zweitem Strauß (»Entflohen«) genommene Gedicht »Er ist gekommen« (op. 12 Nr. 1) erzählt mit wenigen Worten die Geschichte einer stürmischen Liebe, vom ersten Herzklopfen bis zur nachträglichen Erinnerung an das Vorübergegangene. Alle drei Strophen beginnen mit dem gleichen Verspaar: »Er ist gekommen / In Sturm und Regen«. Zudem wird der Reim der zweiten Zeile jeweils im letzten Vers der siebenzeiligen Strophe noch einmal aufgegriffen (»Regen / ent-gegen / Wegen / ver-wegen / Segen«. Bewegungsverben, kurze, aus fünf Silben bestehende Zeilen und der rasche Rhythmus verleihen dem Gedicht einen dynamischen Schwung, der erst durch die neunsilbige Langzeile am Ende jeder Strophe retardiert. Genau diese rasche Dynamik wählt Clara Schumann als wesentliches Merkmal ihrer Vertonung. Vier Takte Vorspiel evozieren eine stürmische Atmosphäre. Sehr schnell und leidenschaftlich jagt das eintaktige Grundmotiv in drei Ansätzen hoch. Aus den Spitzentönen entsteht das Hauptmotiv der Singstimme. Rhythmisch verstärkt die Melodie die schwungvolle Verve von Rückerts Versen. Mit einem zusätzlich eingeschobenen Zweivierteltakt nutzt die Komponistin auch dessen metrische Raffinesse, nämlich die Wirkung der das innere Tempo dämpfenden Langzeile im Gedicht. Formal ist die Vertonung als variiertes Strophenlied angelegt. Nur die dritte Strophe setzt sich davon ab. Hier arbeitet die Komponistin Rückerts aufhellenden Rückblick auf die Winterstürme des Herzens plastisch heraus. Die Tonart wechselt von f-Moll nach As-Dur, das Tempo beruhigt sich und die stürmischen Wogen im Klavierpart flauen ab. Soviel inneren Sturm, wie hier am Anfang entfacht wird, fand der Rezensent der Allgemeinen musikalischen Zeitung dann doch unangebracht für das Herzklopfen einer »Mädchenbrust in ihrer entzückenden Beklemmung« (AmZ 1842, Sp. 61). Eine inhaltliche Klammer im Schumannschen Zyklus bildet die Regenund Wettermetapher zu den Tränentropfen des ersten Lieds von Robert Schumann mit der Verszeile »Du sollst nicht vor den Wogen zagen« (op. 37 Nr. 1), während das nachfolgende dritte Lied (Robert Schumann »O ihr Herren«, op. 37 Nr. 3) mit einer musikalisch-motivischen Anknüpfung fortfährt: 218
Paar-Konzepte
Der kadenzierende Quintfall der Singstimme am Schluss des zweiten wird zum Quartauftakt des dritten Lieds umgekehrt. Das zweite von Clara Schumann vertonte Rückert-Gedicht (»Liebst du um Schönheit« op. 12 Nr. 2) variiert kunstvoll die Frage nach dem Liebesmotiv. W i e im ersten Gedicht hat der Dichter die Schlusszeile jeder Strophe abgesetzt. Während die ersten drei Zeilen jeweils fünfsilbig in ruhigem daktylischem Rhythmus abfallen, lockert die auftaktige siebensilbige vierte Zeile den strengen Duktus auf. Die Komponistin nutzt diese metrische Besonderheit in ihrem Lied zu einem ausdrucksvollen Abgesang (»Liebe die Sonne / Sie trägt ein gold'nes Haar«). Rückerts Strophen sind gleich mehrfach von verbindenden Klammern durchwirkt, einmal durch die identische zweite Zeile der ersten drei Strophen (»O nicht mich liebe!«), die in der letzten zu »O ja mich liebe!« variiert ist, sowie durch die gleich anlautenden ersten (»Liebst du«) und dritten Verse (»Liebe«) mit ihrem appellativen Charakter. Von den vierundsechzig Wörtern des Gedichts stehen 14 mit dem Leitmotiv Liebe in Verbindung, davon kumulieren gleich fünf in der letzten Strophe: »Liebst du um Liebe / O ja mich liebe! / Liebe mich immer / Dich lieb ich immerdar«. Elf der einundzwanzig Vokale dieser Strophe lauten »i« und fünf »e«. Bei einem so hellen, dichten Klangflirren muss gegengesteuert werden, damit der Gesang nicht unerträglich schrill wird. Ein samtenes Des-Dur in gemäßigtem Tempo und die Mezzolage der Stimme dämpfen die Farbe mild ab. Gerader Takt, schlichte Rhythmik und einfache Melodieschritte in der Singstimme verstärken die klaren, eindeutigen Aussagen des Gedichts. Die regelmäßig in der Haupttonart wiederkehrende erste Phrase strukturiert das ganze Lied. Je zwei Strophen hat die Komponistin dabei zu einer übergeordneten Einheit zusammengefasst, so dass in der Vertonung ein im Gedicht angedeuteter Parallelismus von »Sonne« und »Meerfrau« sowie »Frühling« und »Liebe« verstärkt wird. Auf die Schlüsselreize »Liebe« und »Schönheit« reagiert vor allem der Klaviersatz. Unter dem festen Halt der Oberstimme bilden aufsteigende Akkordfiguren einen anmutig aufgelockerten, vollstimmigen Grund. Dass die Schönheit von »Sonne« und »Meerfrau« nur ablenkt, wird harmonisch durch die kühn eingefädelte Wendung des Abgesangs in die subdominantische Sphäre beleuchtet. Affirmativ wirken Rückerts trochäische Verse in dem Gedicht »Warum willst du Andre fragen« (op. 12 Nr. 3), aus dem vierten Strauß (»Wiedergewonnen«), Auch hier führt ein kurzes Vorspiel mit einem bogenförmigen Vorder- und Nachsatz in den Tonfall und die Grundstimmung des As-DurLieds ein. Die Bogenform und der fließende Dreiertakt übersetzen Rück-
Kompositionen der frühen 1840er Jahre
219
erts beschwingte antithetische Verspaare frei in Musik. Innerhalb der ersten Strophen steigert der Dichter die Spannung mit der Kulminierung der Beschwörungsformel: »Glaube nicht (als was dir sagen / diese beiden Augen hier)«. In der Vertonung trägt nicht nur die durch dissonierende Nebentöne angereicherte Harmonik, sondern auch die diskrete kontrapunktische Mehrstimmigkeit des fließenden Satzes, die als Reflex des antithetischen inneren Dialogs in Rückerts Versen erscheint, zum besonderen Ausdruck bei. Doch an nachdrücklichen Stellen unterbricht die Komponistin dieses Prinzip: »Sieh die Augen an!« Eindringlich stoppt der Gesang. Innehalten auf einem Septakkord, Pause, ein jetzt folgendes textloses kleines Zwischenspiel hängt der Aufforderung wie sinnend nach. Der zweite Teil des Lieds steigert sich dann noch mal zum emphatischen »ich liebe dich« im Gesang, eindringlich leise wiederholt, während die Spannungskurve zurücksinkt. Augen sagen mehr als Lippen. Ein Nachspiel im Klavier bekräftigt diesen Ausgang. Wie ein Schlusschoral hebt danach das letzte Duett des Zyklus an: »So wahr die Sonne scheinet« (op. 37 Nr. 12). »Ich möchte meiner Frau an ihrem Geburtstag [...] eine kleine Freude bereiten mit Folgendem: Wir haben zusammen eine Anzahl Rückertscher Lieder componirt«, so bot Robert Schumann dem Verlag Breitkopf 8c Härtel die Lieder zum Verkauf an. »Ist es Ihnen nun möglich, dies Heft bis zu jener Zeit fertig zu bringen?« (in: Hallmark 1994, S. 274). Es klappte. Clara Schumann erhielt als Geburtstag-Überraschung am 13. September 1841 einen Andruck des Liebesfrühlings. Das Presseecho auf die kollektive Liedveröffentlichung klang allerdings durchmischt. Nicht zu wissen, welches Lied von wem stammte, irritierte die Rezensenten. Im Urteil der Allgemeinen musikalischen Zeitung enthielt die Sammlung »vortreffliche Lieder«, darunter auch das vierte und elfte des Zyklus, während am zweiten nicht nur die unangebrachte Leidenschaftlichkeit, sondern auch die üppige Begleitung störte, »schwülstig und schwer« {AmZ 1842, Sp. 61f). Friedrich Rückert bedankte sich mit beschwingten Versen (»Meine Lieder / Singt ihr wieder«), die die Schumanns gleich an die Presse weiterreichten, da sie das junge Künstlerpaar adelten, während sie das Autograph wie eine Reliquie aufbewahrten. In späteren Auflagen löste Robert Schumann das Rätsel der Autorschaft, was dazu führte, dass man die Lieder auseinanderdividierte. Seit der Wiederentdeckung der Komponistin im 20. Jahrhundert wurden nun ihre Lieder allein unter einem »Frauenlabel« aufgeführt. Als gemeinsamer Zyklus, wie ursprünglich gedacht, sind die Rückert-Lieder nach wie vor selten zu hören.
220
Paar-Konzepte
Das erste Ehejahr war um. Claras künstlerische Bilanz konnte sich sehen lassen. Es war ihr trotz der häuslichen Beschränkung gelungen, sich weiterhin als Künstlerin auf der Bühne zu behaupten und sich darüber hinaus als Komponistin zu präsentieren, die mit den Liedern ein neues Gebiet erobert hatte. Gleichzeitig gelangen ihre Pläne, dem Mann ein »gemütliches Nest« zu richten und ihm ein freies Komponieren zu ermöglichen. Robert Schumann hatte über hundertzwanzig Lieder und seine erste Sinfonie komponiert, die in Clara Schumanns Come-back-Konzert uraufgeführt wurde, eine zweite war im Entwurf ebenso fertig wie die erste Fassung des Klavierkonzerts. Als Krönung ihres erfolgreichen Jahrs sahen die Schumanns aber das alles überblendende Hauptereignis an, die glücklich verlaufene Geburt der Tochter Marie am 1. September 1841. Hochzeitstag, Clara Schumanns Geburtstag, Taufe - »die Feste hören überhaupt nicht auf« (Tb 2, S. 185). Nach dem erfolgreichen Neuanfang im März 1841 folgten weitere Einladungen. Die Künstlerin nahm im Herbst 1841 ein Engagement in Weimar an und konzertierte dort am 21. und am 25. November. Überraschend tauchte Liszt auf. Er verbreitete sogleich »Partylaune« und überrumpelte die Schumanns mit dem Charme seiner bohèmehaften Gesellschaft. »Der Champagner floß wie in Bächen« (Tb 2, S. 194). Um ihr ambitioniertes musikalisches Engagement zu fördern, sagte Liszt seine Mitwirkung in Clara Schumanns Leipziger Konzert am 6. Dezember 1841 zu. Publikumswirksam inszenierte er ihren Auftritt, indem er die Virtuosin mit einem Blumenstrauß von ihrem Platz abholte und auf das Podium führte, unter »allgemeinem Händeklatschen«, so Clara Schumann an Emilie List. Die gemeinsame Exekution von Liszts zusammen mit Chopin, Herz, Thalberg, Pixis und Czerny komponierten Kollektiwariationen Hexameron wurde der Hit des Abends, während Robert Schumanns d-Moll-Sinfonie und Ouverture, Scherzo und Finale op. 52 (beide in erster Fassung) nur lau wegkamen. Schumanns Enttäuschung schlug in Kritik an ihrem Spiel um, das ihn »nicht befriedigt« hatte (Tb 2, S. 195). Das Duo mit Liszt dagegen machte so »Furore, so daß wir einen Teil wiederholen mussten« (in: Wendler, S. 106f.) und es auch in Liszts eigenem Konzert am 13. Dezember 1841 noch einmal boten. Danach luden die Schumanns die ganze Leipziger Künstlerrunde samt Liszt noch zu einer privaten Soirée ein. Liszts Vorschlag, anschließend zusammen nach Halle weiterzureisen, schlugen sie aus. Seit drei Wochen hätte sie keinen Ton gespielt, »sondern immer componirt«, schrieb Clara Schumann ihrer Mutter (29. Dezember 1841). Die Fülle musikalischer Ereignisse löste bei Clara Schumann offensichtlich einen musikalischen Energieschub aus, so dass sie auch neue Kompositionspläne hegte. Kompositionen der frühen 1840er Jahre
221
Es drängte das »Künstlerherz« immer vorwärts, so hatte Robert Schumann seine eigene kreative Unruhe im Tagebuch skizziert, und auch Clara Schumann war davon getrieben. Ohnehin wäre über das Kind noch nichts zu berichten, außer dass es tränke und schliefe. Noch im September 1841 komponierte sie ein weiteres Stück, das, so Robert Schumann, »einen recht schönen Charakter athmet«. Es könnte nach Gerd Nauhaus sowohl eine erste Version des c-Moll-Scherzos op. 14 als auch der Kopfsatz ihrer Klaviersonate g-Moll (WoO) gemeint sein (Tb 2, S. 187 und 516). Teile der Sonate entstanden im Herbst 1841, die Kompositionszeit des Scherzos ist dagegen nicht belegt, auch ein Kompositionsautograph fehlt. Beide Stücke enthalten ein Eigenzitat aus dem Rückert-Lied »Er ist gekommen / In Sturm und Regen« (op. 12 Nr. 1). Von der eindringlichen Wasser- und Wellenmotorik war die Komponistin offenbar längere Zeit eingenommen. In dem 1845 veröffentlichten Scherzo op. 14 besticht der Kontrast zwischen dem stürmisch con fuoco dahinjagenden Scherzopart in c-Moll mit dem »Sturm- und Regen«-Motiv und dem ruhigen Trio in As-Dur. Dass das in schnell fließenden Figuren eingebettete Hauptthema gleich vierstimmig exponiert ist, merkt man beim Hören nicht sofort. Charakteristisch für die Kompositionsart sind die Bezüge, die zwischen den Scherzoteilen und dem Trio zahlreiche Korrespondenzen bestehen. Metrisch changiert das Scherzo zwischen einem Dreivierteltakt und einer Sechsachtelgruppierung, die sich im Höreindruck als belebendes Element mitteilt. Die Eingangsmelodie aus an- und absteigenden Terz- wie Sekundschritten nimmt bereits die Umrisse des Triothemas vorweg. Zur ruhenden Insel wird dann das Trio durch eine akkordische Satztechnik in langen Notenwerten. Dabei sind im Trio-Thema zwei Taktarten verschränkt: der Vordersatz hat eine Dreiviertel-, der Nachsatz eine Zweiviertelgliederung. Gleichzeitig beschleunigt der Rhythmus den Nachsatz erheblich. Wenn das Stück insgesamt »organisch« wirkt, so aufgrund der sorgfältigen Über- und Rückleitungen, die die Kontraste zwischen Scherzo und Trio vermitteln. Clara Schumann widmete das Stück der dänischen Pianistin Josepha Tutein, die sie in Kopenhagen kennengelernt hatte. Mit dem Projekt, eine Klaviersonate zu komponieren, stellte sich Clara Schumann einer weiteren Herausforderung. Klaviersonaten hatten in den 1830er und 40er Jahren kein glückliches Image. Manche gerieten zu trocken und zu gelehrt, andere zu speziell und zu schwer. Die Komponistin, die erfolgreich Beethoven-Sonaten vor einem großen Publikum gespielt hatte, mochte jetzt gereizt haben, ein Stück zu erfinden, dass einerseits spontan verständlich war 222
Paar-Konzepte
und andererseits den musikalischen Ansprüchen der Gattung genügte. »Es ging!« liest man im Tagebuch. »Ich war selig wirklich einen ersten und zweiten Sonatensatz zu vollenden«. Zwei weitere kamen vier Wochen später dazu. »Klara hat ihre Sonate fertig«, trug Robert Schumann unter dem 15. Januar 1842 ein {Tb 2, S. 198f). »Viel reiner im Satz als sie je geschrieben«, teilte er auch Mariane Bargiel mit, wie Gerd Nauhaus im Vorwort der Ausgabe der Sonate für Klavier g-Moll (WoO) zitiert. Mit ihrer Sonate knüpfte Clara Schumann an einen Expertendiskurs an, in dem die Sonaten von Schumann oder Chopin für sie sicher zu den Fixpunkten gehörten. Dabei dürften nicht nur Stücke, die als »Sonaten« bezeichnet waren, eine Rolle gespielt haben, sondern auch andere größere Formen wie Chopins Balladen oder dessen Fantaisie-Polonaise op. 61 etwa, in denen heterogene Elementen zusammengeschweißt wurden. Neue Formkonzepte und eine veränderte Definition im Verhältnis von thematisch-motivischem Material zum Ganzen standen im Vordergrund. An Clara Schumanns Sonatenexperiment lassen sich zwei Tendenzen beobachten, nämlich einmal die Aufwertung formaler Zwischenpartien wie Uberleitung, Schlussgruppe und Coda im Verhältnis zu Haupt- und Seitensatz und zum zweiten die Absicht, einen organischen Ablauf auch durch die Setzung ähnlicher motivisch-thematischer Bildungen zu gewinnen. Im Kopfsatz der Sonate ist die Hierarchie zwischen Hauptthemen und überleitenden Passagen zwar nicht aufgehoben, doch deutlich abgeflacht. Uberleitung und Schlussgruppe erhalten eine eigene Ausdrucksqualität, deren Profil sich im Verlauf des Satzes individualisiert. Der auffällige energetische Schwung der Sonate dürfte daher rühren, dass die Komponistin eine dynamische Metrik bevorzugte, in der Phrasen geschickt verkürzt beziehungsweise verschachtelt werden. So suggerierte sie ein drängendes Gefühl von »immer vorwärts«. Da schon der Hauptsatz ein berückend lyrisches Moment enthält, gibt die Komponistin dem Seitensatz eine andere Funktion als traditionell erwartet. Er steht überraschenderweise in der Mediante Es-Dur und soll »um vieles schneller« erklingen. Mit ausgreifenden Akkordfiguren werden eher Flächen als thematische Partien erzeugt. Erst in der Schlussgruppe retardiert der Schwung und beruhigt sich. Hier werden bereits das Tempo und das Eingangsmotiv des folgenden langsamen Satzes antizipiert. Das Adagio in Es-Dur hebt zunächst an wie ein Beethovensches, intensiviert dann aber den Ausdruck durch die eindunkelnde Wiederholung der ersten Phrase in Moll, in tiefer Lage. Dazu tritt ein sehnsuchtsvoll in die Ferne strebender zweiter Gedanke in B-Dur über fließenden Sextolen. Übergreifende Kompositionen der frühen 1840er Jahre
223
Motive verbinden den dritten Satz, ein anmutiges Scherzo in G-Dur, mit dem Schlussrondo, nämlich eine Pendel- und eine Drehfigur. Beide tauchen auch schon im Hauptthema auf. Die Umrisse des Rondothemas ähneln Clara Schumanns Heine-Lied »Sie liebten sich beide« op. 13 Nr. 2. Im Unterschied zum Rückert-Zitat im Kopfsatz kann hier allerdings nicht eindeutig entschieden werden, ob das Thema tatsächlich als eine bewusste Reminiszenz zu hören ist, oder vielleicht nur eine von der Komponistin in diesen Jahren insgesamt favorisierte Formulierung. Die Sonate blieb in der Schublade. Offenbar wollte Clara Schumann den schnellen Erstentwurf noch weiter aus- oder überarbeiten, einiges vielleicht eleganter verknüpfen oder interessanter gestalten. Was genau sie daran nicht zufriedenstellte, oder warum sie das Sonatenprojekt nicht wieder vornahm, bleibt unklar. Sie trennte 1845 das Scherzo aus der Sonate heraus und veröffentlichte es mit drei anderen zwischen 1842 und 1843 komponierten Sätzen in den Quatre Piecesfugitives op. 15. Erst 1991 wurde das im Archiv des Robert-Schumann-Hauses in Zwickau erhaltene Manuskript publiziert. Lieder ließen Clara Schumann tatsächlich nicht ganz los. Zwischen 1840 und 1843 komponierte sie ein Dutzend weiterer Lieder, aus denen sie eine Auswahl zusammenfasste. Sechs Lieder mit Begleitung des Pianoforte componirt und Ihrer Majestät der regierenden Königin von Dänemark Caroline Amalie ehrfurchtsvoll zugeeignet von Clara Schumann, so lautete der imposante Titel der Erstausgabe ihres Opus 13, die im Januar 1844 bei Breitkopf Sc Härtel erschien. In Kopenhagen hatte Clara Schumann im März 1842 die Herzen nicht nur ihres bürgerlichen, sondern auch des königlichen Publikums im Sturm erobert. Die Herrscherfamilie lud sie als einzige der Künstlergruppe zu sich an den Tisch, und sie ließ sich die angebotenen »Delicatessen schmecken«. Man gab sich familiär, unterhielt sich mit ihr (ein Ereignis, das Clara Schumann stets als besonders erwähnenswert festhielt) und forderte sie zum Hofball auf, wo die Prinzen sie umgirrten. Zum Abschied schenkte ihr die Königin eine »wundervolle Brillant-Broche«, zusätzlich zum bar gezahlten Honorar (Bw, S. 1168 und 1190). Die Tournee endete glücklich und füllte wie gehofft die Leipziger Haushaltskasse auf. Clara Schumann nahm in ihr Opus 13 ein weiteres Rückert-Lied auf, »Ich hab' in deinem Auge den Strahl / Der ewigen Liebe gesehen« (op. 13 Nr. 5), das sie zum Geburtstag ihres Mannes am 8. Juni 1843 komponiert hatte. In Rückerts Versen aus dem ersten Strauß des Liebesfrühlings (»Erwacht«) pulsiert ein feines irritierendes Herzklopfen in den metrischen Triolen am Ende der Verse. Rückert nutzte bekannte Bilderreize. In der ersten
224
Paar-Konzepte
Strophe stehen der »Strahl der Augen« sowie die »Rosen« auf den Wangen für die ewige Liebe, in der dritten werden Strahl und Rose zu Symbolen, die jedes Mal neu an das Gesicht der beziehungsweise des Geliebten erinnern. Diesen Bezug stellt im Lied eine Bogenform her, die dritte Strophe erklingt als variierte Reprise der ersten. Im Unterschied zu Rückert wählt die Komponistin eine gleichmäßige Periodik, zieht die Zeilen zu Langversen zusammen und vertont sie weitgehend syllabisch. Als melodische Höhepunkte ragen die Schlüsselwörter »Liebe« und »Herzen« heraus. Zwei weitere Rückert-Lieder sortierte sie aus. Das erste, »Die gute Nacht, die ich dir sage« (WoO), in F-Dur, zum 8. Juni 1841 verschenkt, hebt choralhaft an wie ein einfaches Abendlied. Doch verdunkelt es sich schon innerhalb der ersten Phrase nach d-Moll. Im weiteren Verlauf tritt der choralhafte Charakter immer mehr in den Hintergrund, während sich die Klavierstimme als interpretierender Gegenpart des Gesangs entfaltet und ihn am Ende ablöst in einem Nachspiel. Diese satztechnische Entscheidung korrespondiert mit dem Inhalt des Gedichts, in dem die lyrischen Personen als beredte Botschaften Melodien hin und her schicken. Im zweiten, auf den 8. Juni 1843 datierten Lied »O weh' des Scheidens, das er that« (WoO) dominieren musikalische Verzweiflungs- und Trauergesten: Tritonussprünge in der Gesangsmelodie sowie herbe Dissonanzen im Klavier. Die drei von Clara Schumann in Opus 13 aufgenommenen Geibel-Lieder dürften aus dessen erstem Gedichtband genommen worden sein. Damit machte der 25jährige Emanuel Geibel sich 1840 schlagartig bekannt. Er traf das biedermeierliche Lebensgefuhl offenbar ins Mark. Nach Heine gehört Geibel zu den meistvertonten Dichtern des 19. Jahrhunderts (Herttrich 1993, S. 123). Clara Schumanns Lieder »Liebeszauber« (op. 13 Nr. 3), »Der Mond kommt still gegangen« (op. 13 Nr. 4) und »Die stille Lotosblume« (op. 13 Nr. 6) entstanden vermutlich 1842 und 1843. Geibels »Liebeszauber« (op. 13 Nr. 3) verbreitet einen Stimmungszauber, den eine Nachtigall mit ihrem Gesang evoziert. Davon ist die bewegte triolische Klavierbegleitung inspiriert, die das ganze variierte Strophenlied durchzieht. Rosenbusch, Wipfelrauschen, Rehlein und »süßer Schall« bilden für das lyrische Ich ein unerträglich liebliches Ambiente, von dem es sich in der letzten Strophe abwendet. Ein herber Missklang zieht das Herz zusammen. Dieser Kontrast zwischen säuselnder Idylle und Weltschmerz grundiert auch das Abendlied »Der Mond kommt still gegangen« (op. 13 Nr. 4). Im Unterschied zu dem berühmten Modell von Matthias Claudius ist der Bezug hier subjektiver auf die Empfindung des lyrischen Ichs allein gerichtet. In der Vertonung entwirft die Komponistin eine individuelle Melodie in Des-Dur mit einer cha-
Kompositionen der frühen 1840er Jahre
225
rakteristischen mediantischen Aufhellung in der dritten Phrase, getragen von einem vollgriffigen Klavierpart. Ein dunkles, ges-Moll streifendes Nachspiel begleitet das einsame, melancholische Ich »in die Welt hinaus«. Die »Lotosblume« von Geibel (op. 13 Nr. 6) wirkt heute wie eine leicht schlüpfrige jüngere Schwester von Heines gleichnamigem Gedicht, das Robert Schumann 1840 in den Myrthen op. 25 Nr. 7 vertont hat. Lotos, die Traumblume der Frühromantik, symbolisiert einen Mythos von Wiedergeburt und Unendlichkeit. Als magisches Narkotikum enthält die Pflanze rauschhafte Qualitäten zum Erreichen von Trancezuständen (Kandeler 2003, S. 10), die sich leicht mit erotischen Komponenten verbinden lassen. Die weiße Lotosblume, tagsüber fast geruchlos, entfaltet ihren verführerischen Duft erst nachts. In Geibels Gedicht verzaubert sie ihre ganze Umgebung und buhlt mit dem Mond, er »gießt alle seine Strahlen / In ihren Schoß hinein«. Als trauernder Dritter umsingt sie ein weißer Schwan. Doch vergeblich. Blume, »kannst du das Lied verstehn?« Dieses Motiv greift die Komponistin in ihrer Lesart als Pointe auf. Den atmosphärischen Hauch von Exotik in den klangvollen Versen vermittelt das As-Dur-Stück als eine fast schon impressionistisch weiche Stimmung, hervorgerufen durch die mit Nebentönen farbig bereicherte Harmonik und vor allem durch die stete Repetition einer eintaktigen rhythmischen Begleitfigur aus Triole und Achteln im Klavier. Nicht Schmachten, sondern eher verzagende Sehnsucht unterstreicht die nach Ces-Dur entrückte Schwanenstrophe. Das Lied endet auf einer unaufgelösten Dissonanz, ein leiser, verstörender Nachklang der unmöglichen Liebeskommunikation, die die Komponistin hinter den schmachtend wirkenden Bildern hervorhebt. An dem ausweglosen Schlussklang störte sich schon der Rezensent der Allgemeinen musikalischen Zeitung wie auch spätere Autoren. Man wünschte eine »Milderung dieser scharfen Dissonanzen« und überhaupt weniger fühlbare »Härten der Begleitung«. Insgesamt wurde die Komponistin jedoch beglückwünscht zu ihrem »anmuthig duftenden Blumenkranz« von Liedern, aus denen »sinnig-milder Ernst« spräche, der »durch ihr seltenes Reproductionstalent [...] doppelt anziehend« wäre (AmZ 1844, Sp. 255). Die Lieder wollten keinen »geräuschvollen Triumphzug durch die Salons machen«, glaubte auch der Rezensent der Neuen Zeitschrift fiir Musik und legte sie einem »empfängliche[n] Gemüth« ans Herz, um sich »in stiller Klause« (.NZfM 1844, S. 97) daran zu erquicken. Diesem Missverständnis gaben schon die Gedichte Vorschub, und es wurde in den Liedern noch verstärkt, obwohl allein schon deren Tonartenwahl hier Grenzen setzte. Die empfundene und von Dichtern wie Komponierenden behauptete Einfachheit ent226
Paar-Konzepte
stand als Resultat einer sorgfältigen sprachlichen wie musikalischen Komposition, so wie auch die lapidaren Kurzschlüsse in Heines Buch der Lieder Teil einer poetischen Stilistik waren. Den Dichter hatte Clara Wieck 1839 in Paris kennen gelernt, er wohnte wie sie in der Rue des Martyrs. Da galt Heine bereits als eine Art Institution. Man suchte ihn auf wie seinerzeit Goethe in Weimar. Allerdings musste Clara Wieck erst darauf warten, dass der Dichter ihr in angemessener Begleitung seine Aufwartung machte, denn als Fräulein konnte sie ihn weder besuchen noch empfangen, ohne sich zu kompromittieren. Stattdessen traf sie den damals schon kranken Heine im Haus Meyerbeer. Man blieb auf freundlicher Distanz (Bw, S. 468). Heines Buch der Lieder kam 1827 heraus, vor der Emigration nach Paris, und erschien 1839 in dritter Auflage. Obwohl Heines Spott sich üppig über die philiströsen Bildungsbürger ergoss, dürfte es doch das gleiche Lesepublikum gewesen sein, das neben Rückert und Geibel auch seiner Lyrik zum Erfolg verhalf, selbst wenn sie verschiedenen Welten anzugehören schienen. Heine formulierte im Vorwort zur zweiten Auflage des Buches der Lieder von 1837 eine tiefe Sprach-Skepsis: »Seit einiger Zeit sträubt sich etwas in mir gegen alle gebundene Rede.« Es wäre »in schönen Versen allzu viel gelogen worden, und die Wahrheit«, so Heine, scheue »sich in metrischen Gewändern zu erscheinen« (Heine 1969, 1, S. 45). Gleichwohl schwärmt auch diese Lyrik durch die Fülle synästhetischer Entwürfe, mit wispernden Blumen und süß duftenden Klängen. Allerdings bricht der oft unvermutete Absturz ins Triviale hohles Pathos oder Sentimentalität, und darüber nachzusinnen gehört zum hedonistischen Lesevergnügen. Die »Wahrheit« erscheint hier lebenserfahren. Ins Blickfeld rücken gleichsam die Ränder großer Gefühle, nicht das Erhabene der Liebe, sondern die Leere danach. Den Stoff bieten alltägliche Geschichten, im Gewand reimoffener Verse, freierer Rhythmen (als etwa bei Rückert oder Geibel) und einer mitunter logikfernen Syntax, angelehnt an Modelle volkstümlicher Lyrik mit ihrer schlichten Moral. Das Heine-Lied, mit dem das Heft Opus 13 eröffnet wird, »Ich stand in dunklen Träumen« (op. 13 Nr. 1) aus dem Buch der Lieder (Heimkehr XXIII), entstand 1840. Misslungene Liebe und ein Leben, das nur in der Fantasie noch lebt, bilden den Stoff. Wirklichkeits- und Traumebene verwischen, als das Bild der Geliebten »heimlich zu leben« beginnt, eine Erfahrung, die Robert Schumann in der Zeit ihrer Trennung seiner Braut auch als eigenes Erlebnis mitteilte, womöglich in Kenntnis dieses Gedichts (Bw, S. 569). Clara Schumann setzt sich über Heines durch metrische »Stolpersteine« belebte Verse hinweg. Sie vertont sie in freiem Rhythmus und setzt die Versmetrik in Kompositionen der frühen 1840er Jahre
227
variable musikalische Phrasen um. Trotzdem erhält das Stück eine geschlossene musikalische Form durch die Rahmung eines gleich lautenden Vor- und Nachspiels. Mit ihrem »romantischen« Durchgang und den »Seufzer-Figuren markieren die einleitenden Takte wie Wegweiser eine melancholische Gesamtstimmung des Lieds. In dem Moment, wo sich das »Antlitz« des Bildes belebt, hellt sich auch die Tonart auf und rückt - zumindest in einer Schicht - vom Ausgangspunkt Es-Dur weit in den mediantischen Bereich hinein, während die Rückkehr des lyrischen Ichs auf den Boden der Realität (»Daß ich dich verloren hab!«) auch harmonisch in die Ausgangstonart zurückfuhrt. Schuberts Fassung dieses Lieds aus dem so genannten Schwanengesang D 957 kannte die Komponistin nicht. Mit dem Gedicht »Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht / Er fiel auf die zarten Blaublümelein / Sie sind verwelket, verdorret« {Neue Gedichte, »Tragödie« 2, in: Heine 1, S. 281), nahm Heine tatsächlich eine volkstümliche Vorlage auf. Sie war von Wilhelm von Waldbrühl 1825 in der Rheinischen Flora veröffentlicht worden (Heine 1969,1, S. 902). Aus dieser Zeit datiert auch die von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio aufgezeichnete Volksweise im Viervierteltakt. Heines Version ist sozusagen ein frühes »Objet-trouvé«. Sein Kunstcharakter wird durch die neue Kontextualisierung als Mittelstück der dreiteiligen »Tragödie« und die Autorisierung durch den Dichter hergestellt. Gleichzeitig kommen die unpathetischen, prosarhythmischen Verse der poetischen Autorintention entgegen. Da Heine die vierte Strophe, die das Eingangsbild mit bänkelsängerischem Trost abrundet (»Auf ihrem Grab Blaublümelein blühn I... I Der Reif sie nicht welket, nicht dörret«) streicht, bleiben die verdorrenden Frühlingsblüten in seiner Version unaufgelöst stehen. Ihr Sinn erschließt sich erst, wenn man beim Lesen »hin und her« wandert wie die handelnden Figuren der Geschichte. Das reimlose, jambisch anhebende Gedicht lebt von der Spannung zwischen dem zu erwartenden hohen Stil einer »Tragödie« und dem lapidaren Gleichmut, mit der die Katastrophe einer romantischen Liebe erzählt wird. Ihre Protagonisten brennen hoffnungsvoll durch und verirren sich glücklos im Gestrüpp des Lebens wie seinerzeit Clemens Brentano und Auguste Bußmann. Im weiteren Sinne lässt sich diese Konstruktion auch als Chiffre für die Heimatlosigkeit der frühromantischen Intellektuellen lesen, deren ästhetischer wie politischer Idealismus nirgends einen Ort fand. Clara Schumann hat Heines Vorlage unter der Uberschrift »Volkslied« (WoO) im Dezember 1840 komponiert. Anstelle volksliedhafter Einfachheit entstand hier allerdings ein melancholisches Kleinod im Neunachteltakt, in den die melodischen Phrasen variabel eingepasst sind, mit einer anmutigen
228
Paar-Konzepte
Zwiesprache zwischen Klaviersopran und Singstimme in dunklem f-Moll. In ihrer im Lied musikalisch ausgedrückten Sinnkonstruktion rückt die individuelle Komponente der Geschichte ins Blickfeld. Wenn sie auch alltäglich sein mochte, so ist sie für diejenigen, denen sie passiert, doch eine Tragödie, unabhängig davon, ob man den Inhalt des Gedichts wörtlich oder allegorisch liest. Die Komponistin setzt dem misslungenen Aufbruch im Nachspiel ein rührendes kleines Epitaph und unterstreicht damit mehr den Kunstcharakter der Vorlage als dessen Volkstümlichkeit. Ob sie Zuccalmaglios Weise gekannt hat und das Lied aus diesem Grund aussortierte, ist nicht mehr zu bestimmen. Eines von Heines berühmtesten Gedichten, die auf Brentano zurückgehende »Lorelei«, »Ich weiß nicht was soll es bedeuten, / Daß ich so traurig bin« (Buch der Lieder, Heimkehr II, in: Heine 1, S. 129f.), zu dem Friedrich Silcher 1838 eine längst zum Volkslied gewordene Weise entworfen hat, transferiert Clara Schumann 1843 in eine dramatische Ballade. Sie arbeitet in ihrer Lesart das in dem märchenhaften Stoff enthaltene Motiv des Unheimlichen und latent Gewalttätigen der sirenenhaften Sagenfigur heraus. Das »alte Märchen« klingt hier in einer archaisch anmutenden abwärts gerichteten Melodiewendung in Moll an. Diese faszinierende »Lorelei« (WoO) verursacht Aufruhr und Schrecken. Unruhig und von Beginn an verstörend dissonant rollt ein bewegtes Wasser- und Wellenmotiv ab. Auch seine spätere Mutation in harfenartige, den »Abendsonnenschein« vergoldende Akkorde besänftigt kaum. Sie präludieren der Lorelei auf dem Felsen. Die kämmt »mit goldenem Kamme« ihr Haar (ein magisches Verfuhrungsmotiv) und singt. Doch anstelle der Stimme erklingt ein instrumentales Zwischenspiel, in dem der pochende Rhythmus des Anfangs und das archaische Mollmotiv wieder auftauchen. Dieser Gesang ist nicht verführerisch, sondern bedrohend. Dazu steigert sich die Musik dramatisch. Die Verse werden in hektische Prosa aufgelöst, der Gesang wirkt atemlos, durch große Auf- und Absprünge gewaltig, mit verschärften Begleitakkorden gefüllt, zum Fortissimo aufgedreht: »Und das hat mit ihrem Singen / Die Lorelei getan«. Hier standen sicher Erfahrungen mit Schuberts Erlkönig D 328 im Hintergrund. Warum sie dieses Experiment nicht weiter verfolgte, muss offen bleiben. Womöglich spielten gattungsästhetische Fragen eine Rolle. Folgt man den in der Neuen Zeitschrift für Musik Anfang der 1840er Jahre formulierten Liedvorstellungen Robert Schumanns, der damals einer der fuhrenden Stimmen im ästhetischen Diskurs war, so fällt das Kriterium der stilistischen Angemessenheit bei der Liedvertonung auf. Einer schlichten Vorlage einen »dramatischen oder theatralischen Anstrich« zu geben, fand Schumann unpassend (GS 2, S. 85f). Diesen Kategorienfehler könnte sich Clara Schu-
Kompositionen der frühen 1840er Jahre
229
mann angeheftet haben, als sie ihre »Lorelei« (WoO) in die Schublade versenkte. Mit ihrem leidenschaftlichen Entwurf verstieß sie womöglich gegen Kriterien der Innerlichkeit. Das auf einen bürgerlichen Intimitätskult zielende Kunstlied war eines der ästhetischen Repräsentationsmodelle, stand der »natürliche« schlichte Ausdruck doch gerade für Gefuhlswahrhaftigkeit. Schließlich stilisierte sich das Künstlerpaar Schumann als Garant dieses Ideals. Da dürfte auch nicht besonders forderlich gewesen sein, dass ausgerechnet Franz Liszt die gleiche Kompositionsidee wie Clara Schumann hatte und 1843 eine dramatische »Loreley«-Ballade veröffentlichte. Von den über 30 Vertonungen des Liedes »Sie liebten sich beide« (op. 31 Nr. 2) aus Heines Buch der Lieder (Heimkehr XXXIII) ist Clara Schumanns die frühste. Das Gedicht besticht durch seine ironische Brechung in der Kopplung konträrer Aussagen. Zur Wirkung trägt die Vers überbindende Verteilung der syntaktischen Einheiten bei. Dadurch staut sich der Rhythmus. »Sie liebten sich beide, doch keiner / Wollt es dem andern gestehn«. Heines strukturelle Vorgaben, zwei Strophen mit vier gleich anlautenden Zeilen, werden als musikalische Gliederung übernommen. Auch die lyrische Brechung setzt die Komponistin um, indem sie die sich gegenüberstehenden Aussagen auf zwei verschiedene Tonlagen verteilt. Mit der einfachen Melodie, Quartauftakt und der überwiegend syllabischen Musikalisierung folgt das Lied dem volksliedhaften Gestus von Heines Gedicht. Der wiegende Sechsachteltakt und die »Seufzer«-Motive im Gesang evozieren einen melancholischen Einschlag. Er wird durch diffuse Harmonien im Klavier noch unterstrichen. Kaum ein Klang bleibt ungemischt, dabei sind die dissonierenden Zusätze so diskret gesetzt, dass sie atmosphärisch und nicht im avantgardistischen Sinne provozierend wirken. Das Lied steht wie aus einem Guss. Dass die Komponistin daran sorgsam gefeilt hat, lässt die von Joachim Draheim und Brigitte Höft 1992 veröffentlichte Erstfassung erkennen. Einzelaffekte treten zugunsten einer Gesamtwirkung zurück. Seine ausgewogene Faktur macht das Lied fast zu einem »Klassiker«, und der Verzicht auf Virtuosität sowohl im Gesang als auch im Klavier dürfte erheblich zu seiner heutigen Beliebtheit beitragen. Beide Klangpartner sind in ein einheitliches Konzept verwoben und behalten dabei jeweils eigene Konturen. Weder begleitet das Klavier schlicht den Gesang, noch tritt es als dialogisierender Partner ihm gegenüber, sondern es umschließt ihn. Innerhalb der mehrstimmigen Struktur des Satzes bildet die Solostimme eine Schicht im instrumentalen Klangraum. Erst beide zusammen ergänzen sich zum Stück. Romantische Lyrik und musikalische Poesie können so zu einer neuen Einheit verschmelzen. 230
Paar-Konzepte
Heines lapidarer Liebesspott evoziert bei Rezitationen gewöhnlich Heiterkeit. Dagegen beleuchtet Clara Schumanns Vertonung die Pointe aus der Perspektive der lyrischen Personen und spürt deren tragischer Kommunikationsunfähigkeit nach. Wie auch bei den übrigen Heine-Vertonungen hat sie die als semantisches Paradox formulierte ironische Brechung nicht als allgemeine Dekonstruktion des Liebespathos, sondern vor allem als poetisches Stilmittel gelesen, um Aussagen zu potenzieren und die psychische Komplexität widersprüchlicher Gefühle auszudrücken. Das heißt: In ihrer Sinnkonstruktion verspottet der Dichter seine Figuren nicht. Zwar entlarvt er das große Erhabene durch den Kontrast mit der prosaischen Winzigkeit. Doch geschieht dies in ästhetisch anmutigen, reizvollen Formen. Dem entsprechen im Lied der schlichte Rahmen sowie die verhaltenen, durch Nebentöne mehrdeutig verfremdeten Harmonien. Heines Illusionsbruch, der zum Lachen reizt, spielt mit der Angst vor dem Misslingen, dem Versagen von Gefuhlssprache. Dahinter lauert die viel größere Gefahr, dass die Gefühle selbst relativiert und entwertet würden. Dieser existentiellen Dimension »romantischer Ironie« dürfte Clara Schumann schon allein deswegen nicht gefolgt sein, weil paradoxe Reaktionen zu ihren eigenen Erfahrungen gehörten, die sie gerade in Momenten besonderer Gefuhlsintensität erlebt hatte: »Das Glück« ihres ersten gemeinsamen Weihnachtsfests mit dem Geliebten bei der Familie der Mutter in Berlin »machte mich fast traurig minutenlang« (Jb, 24. Dezember 1839). Darüber hinaus dürfte sie die Negativität aus ethischen Uberzeugungen abgelehnt haben. Die Komponistin teilte Heines Pessimismus nicht. Während dessen Lyrik im Buch der Lieder auf eine Unvereinbarkeit von Illusion und Lebenswelt reagierte, wie sie Schlegel und Novalis formuliert hatten, und seine Welt verlorenen lyrischen Subjekte an der Wirklichkeit scheiterten wie die Intellektuellen der Frühromantik, arbeitete Clara Schumann eine Generation später daran, Ideal und Empirie im Leben zu einen. Als Expertin für die Evokation und Vermittlung eines beglückenden Kunsterlebnisses jonglierte sie selber zwischen den Welten und reflektierte seismographisch das unmerkliche Verwischen von Kunst und Wirklichkeit, samt der darin liegenden Gefahrdung. Aus dieser Perspektive insistierte sie darauf, einerseits fiktive Figuren von realen Personen zu trennen, doch andererseits die dargestellten Gefühle nicht als literarische Fiktion zu unterminieren. Schließlich gründeten Clara Schumanns eigene Familienpläne auf einem der Kunst gewidmeten Leben. Das konnte dauerhaft aber nur gelingen, wenn die im Liebesvertrag des Paars behaupteten Gefühle verbindlich blieben und beide Seiten daran arbeiteten, den Pakt auch durchzuhalten. Kompositionen der frühen 1840er Jahre
231
Idylle und Verlust Familienleben »Meine liebe Mama, beifolgend die Haare zu dem Armband; der Haarflechter wird sie sich schon aussuchen und reinigen. Das Päckchen mit den langen Haaren wünschte ich zu einer Schnur für meinen Mann«. Den Namen des Berliner Handwerkers hatte Clara Schumann vergessen, daher sandte sie ihrer Mutter das Material aus Leipzig, mit der Bitte, die Angelegenheit für sie zu erledigen. »Das Schloß kaufe ich hier« (an Mariane Bargiel, 10. und 13. Dezember 1841). Möglicherweise sollten die Gaben noch zu Weihnachten verschenkt werden. Schmuck aus Haaren rangierte hoch in biedermeierlichen Freundschaftsritualen. Neben einzelnen, in Ringen oder Amuletten aufbewahrten Locken, mit denen schon im 18. Jahrhundert ein begeisterter Austausch getrieben wurde, besaßen die aus Haaren eines geliebten Menschen geflochtenen Schmuckstücke die Bedeutung von profanen Reliquien. Schumann hatte seiner Verlobten ein Medaillon mit seinen Haaren gesandt, das sie »fortwährend« trug und küsste. Clara Schumann hütete auch einen blau emaillierten Ring mit einer Locke Mendelssohn Bartholdys (Biedermeier, S. 156; Bw, S. 544; Kat., S. 26). Auf der frühesten erhaltenen Daguerreotypie von sich und ihrer Tochter Marie trägt sie möglicherweise eine derartige Haarkette. Das undatierte Foto, eines der seltenen privaten Porträts, entstand vermutlich um 1844/45 in Dresden und zeigt die Künstlerin in einem (damals modischen) karierten Tageskleid, neben sich die vielleicht vierjährige Tochter Marie im Kinderkittelchen, vor der Kulisse einer Stadtansicht (Abb. 6). Auch dieses Bild, ein noch nicht reproduzierfähiges Original auf silberbeschichteter Kupferplatte, könnte als Geschenk für den Papa, eine der Großeltern oder Paten aufgenommen worden sein. Schenken genoss im Familien- und Freundschaftskult des Biedermeier einen großen Stellenwert. Ganz im Sinne des in Grimms Wörterbuch entfalteten Bedeutungsspektrums von einer Vertragshandlung des Gebens und Annehmens intensivierten Geschenke die Bindung untereinander. Deutlich wuchs dabei in der intimen Kommunikation dieser Zeit das ideelle Prestige des Geschenks über seinen materiellen Wert hinaus (Weber-Kellermann 1996, S. 305ff). Bei den Schumanns kann man das an den ritualisierten partnerschaftlichen Geburtstags- und Weihnachtsgaben verfolgen. In der Regel bestand ein Hauptteil der Partnergeschenke aus (nicht immer ganz fertigen) Kompositionen, oft auf aufwändig mit Schmuckrahmen und Blumengirlanden versehenem, ausschließlich für solche Zwecke gedrucktem Notenpapier 232
Paar-Konzepte
geschrieben und mit persönlichen Widmungen individualisiert. Wenn Clara Schumann kein eigenes Stück schenken konnte, so griff sie auf damals noch kostbare Partituren zurück und legte ihrem Mann Weihnachten 1851 Beethovens Oper Fidelio op. 72 und Mendelssohn Bartholdys Oratorium Elias op. 70 auf den Gabentisch, während sie Schumanns gerade entworfene Ouvertüre zu Goethes »Hermann und Dorothea« op. 136 bekam. Auch die übrigen in Haushalt- und Tagebüchern aufgelisteten Geschenke erhalten weniger profane, nützliche Dinge, wie noch die elterlichen Gaben in Clara Wiecks Mädchenzeit, als vielmehr Luxusartikel, etwa Parfüms und Seifen, exotische Früchte, Schokolade und Spielzeug für die Kinder. Die Schumanns übernahmen die in bürgerlichen Kreisen ganz neu eingeführten Weihnachtsbräuche mit Baum und Gabentisch als »häusliche Geschenkfeier« (Weber-Kellermann 1996, S. 308) und Höhepunkt familiärer Feste. Gerade erst hatten Aristokratie und Königshäuser die Lichter geschmückte Tanne hoffähig gemacht. Queen Victorias deutscher Gemahl, Prinz Albert, führte sie 1840 in Windsor Castle ein. Flächendeckend verbreitete sich diese Sitte dann tatsächlich erst im Bürgertum der Gründerzeit. Doch die kleine Schumann-Familie stellte Weihnachten 1841 sogar zwei auf. »Mein Mann bekam einen großen, Mariechen einen kleinen Baum, dabei ein Mitzekätzchen, ein Püppchen« und weiteres Spielzeug, so Clara Schumann an Emilie List. Als sparsame Hausfrau verzichtete sie allerdings auf Baumschmuck, wie sie ihrer Mutter versicherte, sondern steckte bloß Lichter auf, denn »Mariechen versteht es noch nicht« (Wendler, S. 108; an M. Bargiel, 22. Dezember 1841). Seit dem Empfindsamkeitskult des 18. Jahrhunderts konzentrierte sich die Vorstellung von Idylle zunehmend auf das eigene, häusliche Glück, wie sowohl Text- und Bildprogramme als auch die sie begleitenden ästhetischen und philosophischen Diskurse zeigen, die Klaus Bernhard nachgezeichnet hat. Imaginationen des goldenen Zeitalters der Antike, religiöse Paradiesvorstellungen und arkadische Orte, an denen Schäferin und Schäfer anmutig tanzten und musizierten, prägten die Idyllen des 18. Jahrhunderts. Landschaftstapeten und -Stoffe sowie die bukolische Strohhut-Mode überführten ihre Requisiten in die Alltagswelt zumindest der begüterten Schicht. Mit dem wachsenden Interesse an Anthropologie rückte die Kindheit als Zustand sorg- und mühelosen Glücks um 1800 ins Zentrum. So konnte die Idylle mit Rekurs auf Schiller als schwebender Zustand zwischen »naiv« und »sentimental« beschrieben werden. Doch erst Jean Paul versetzte das mythische Arkadien vollends ins bürgerliche Wohnzimmer. Er fokussierte die Idylle auf die kleinen Glücksmomente des Alltags, um sie »wie durch ein MiFamilienleben
233
kroskop« zu vergrößern (in: Bernhard 1977, S. 96ff). Anstatt das Erträumte weiterhin im fernen Arkadien zu suchen, boten die in romantischen Künsten entworfenen Idyllen die nähere Umgebung an. »Es war eine gewöhnliche kleine Blume«, so Hans Christian Andersen, das, wofür Naturforscher eine ganze Vorlesung bräuchten, »verkündete sie in einer Minute; sie erzählte von ihrer Geburt und von der Kraft des Sonnenlichts, das die feinen Blätter ausspannte und sie zum Duften zwang« (in: Einfachheit, S. 52). Idylle und Idyllisierung hingen untrennbar mit dem Gefühl des verlorenen Glücks, der Harmonie und eines Zustands der Ganzheit einer »heilen« Welt zusammen. Daher kultivierte man Idyllen besonders in schwierigen Phasen, in denen die Gegenwart als unüberschaubar komplex empfunden wurde. Die in der Kunst entworfenen Idyllen sollten eine ausgeglichene Stimmung auslösen. Der Weg führte über die Erinnerung. Man fantasierte sich zunächst in die kindliche Welt, in Momente des gefühlten Glücks zurück, um sich eine Haltung unbeschwerter Naivität anzueignen. Diesen Zustand verglich Jean Paul mit dem schwerelosen Auf und Ab des Schaukeins (in: Bernhard 1977, S. 102ff). In einem weiteren Schritt konnte man dann neu und gleichsam aus noch ungetrübter Erfahrung heraus auf die Welt blicken. Robert Schumann dokumentierte eine entsprechende ästhetische Produktionshaltung bei der Komposition der Kinderszenen op. 15: »Es war mir ordentlich wie im Flügelkleid«, so Schumann an seine Braut. Er charakterisierte die Musik als fragil und leicht wie Seifenblasen (Bw, S. 121). Ganz im Einklang mit der Jean-Paulschen Ästhetik sollte die aus einer imaginierten Kindheitsperspektive kunstvoll entworfene Musik heiter auf die Hörer wirken. Damit das schöpferische Subjekt beziehungsweise die Leser und Betrachter sich der Distanz zur idealisierten Kindheit bewusst blieben und nicht sich selbst mit dem Gegenstand der Fantasie verwechselten, setzte Jean Paul auf einen humoristischen Illusionsbruch. Doch die komplexen Schritte einer doppelten Selbstsuggestion vollzog das Publikum nicht immer mit. Künsderische Vorbilder nutzte man deswegen auch schlicht als Anschauungshilfe, um das Zuhause zur inselartigen Idylle zu stilisieren. Das gemütliche Heim und die harmonisch zusammenlebende, Wärme spendende Familie sollten den Fluchtort bieten gegen äußeren Druck, Stress und das Empfinden einer Fremdbestimmung durch politische Ausgrenzung oder ökonomische Zwänge. Dieser kollektive Wandel von Idylle wirkte wiederum auf die Kunst zurück. Dementsprechend definierte August Wilhelm Bohtz in der Allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaft und der Künste 1853 Idylle hauptsächlich als einen »Zustand«, in dem das, »was der Mensch in seiner Anlage ist, und das wirkliche Sein desselben ganz in Harmonie« vereint wären. Dazu passte die ästhetische Forderung, Schauplätze der 234
Paar-Konzepte
Idylle »real vorstellbar« zu gestalten und Charaktere mit der »Wahrheit des Gefühls« zu versehen (in: Bernhard 1977, S. 131ff). In der im selben Jahr neu erscheinenden Zeitschrift Die Gartenlaube verblasste dieser Zusammenhang bereits zur dekorativen Pose. Je weiter der Abstand zwischen dem bürgerlichen Alltag in den wachsenden, lärmenden, durch Industrie und Kohleöfen luftverpesteten Städten und der erhabenen Natur »draußen« mit ihrem Frieden und den ewig singenden Wäldern auseinanderklafften, desto intensiver wurde die idyllische Einfachheit beschworen. Doch auch diese »Natur« entstand mehr und mehr als künstliches Paradies in Gewächshäusern. Sowohl auf den biedermeierlichen Blumenstillleben der Zeit als auch in Clara Schumanns Blumenbüchern finden sich neben damals heimischen Gewächsen zahlreiche Exoten. Das verklärende Naturverständnis dokumentiert nicht zuletzt der die Idylle suchende touristische Blick etwa auf die Rheinlandschaft oder das Gebirge, die zu neuen Urlaubszielen wurden. So reisten die Schumanns im Frühsommer 1851 begeistert den Rhein herauf bis in die französische Schweiz, zum ersten Mal ohne jegliche Konzertverpflichtung (Knechtges-Obrecht, in: Kat., S. 206). Das in der Gartenlaube bebilderte schlichte ländliche Leben in gottesfiirchtiger Andacht entsprach tatsächlich einer sentimentalen Sozialromantik, die zum Gegenstand idyllischer Bildmotive etwa bei Ludwig Richter beziehungsweise ideologisierter Vorstellungen vom »einfachen« Leben wurde, fern von Politik und Kommerz. In bürgerlichen Haushalten las man rührselige Romane zur Unterhaltung, während Frauen und Mädchen Idyllen auf Sofakissen stickten. Dazu hatten weder Bäuerinnen noch Arbeiterinnen Zeit. Statt blühender Landschaften mit gaukelnden Schmetterlingen wurde jedes Fleckchen Acker zur Bewirtschaftung gebraucht (Reichholf 2007, S. 142f). Bauernproteste, Bergarbeiterstreiks und Weberaufstände zeugten von der realen Misere karger Existenzen. Für die idyllische Selbstinszenierung der Bürgerschicht stand seit dem späten 19. Jahrhundert das Schlagwort »Biedermeier«. Den dichtenden schwäbischen Lehrer »Weiland Gottlieb Biedermaier« hatten der Mediziner Adolf Kußmaul und der Dichter und Amtrichter Ludwig Eichrodt zunächst in den Münchener Fliegenden Blättern kreiert. Eichrodt veröffentlichte 1869 auch Biedermaiers Liederkunst, Lyrische Karikaturen. Biedermaier (später mit »ei« geschrieben) gab nicht nur einem bestimmten Möbelstil und einer Sparte von Genrebildern, sondern rückwirkend einer ganzen als bescheiden unpolitisch gesehenen Generation den Namen, deren häusliche Rituale in der Rückschau auf die gute alte Zeit, »wo Teutschland noch im Schatten kühler Sauerkrauttöpfe gemütlich aß, trank, dichtete und verdaute«, ironisch Familienleben
235
verklärt wurden (in: Biedermeier, S. 269 und 278). Der Humor ging bei der Rückprojektion allerdings verloren. Während die Schumanns zu Hause die idyllische Ideologie umzusetzen gedachten, wirkten sie gleichzeitig aktiv an der öffentlichen Verbreitung bestimmter Kindheits- und Familienbilder mit. In einer Zeit, in der Kinder mit Barrikaden und Straßenkämpfen vor der Haustür konfrontiert waren, boten die Idyllen einen Zufluchtsort. Werke wie das Album fiir die Jugend op. 68 und das Liederalbum fiir die Jugend op. 79, deren Titelblätter Ludwig Richter gestaltete, entstanden darüber hinaus aus pragmatischen Zwecken, nämlich zur Bereicherung einer angemessenen neuen Spielliteratur für Kinder auf der Grundlage eines niveauvollen künstlerischen Konzepts, wie Bernhard Appel herausgearbeitet hat. Damit war zugleich ein ästhetisches Ideal verknüpft. Deswegen verhandelte der Komponist auch zäh um eine entsprechend professionelle künstlerische Gestaltung, durch die die Ausgaben »auch als ein Festgeschenk« geeignet wären, was wiederum »dem Verkauf nur sehr förderlich sein« könne (in: Schumann-Interpretationen 2, S. 42). Schumann bediente damit eine wachsende Nachfrage. Das Album für die Jugend op. 68 war eines seiner erfolgreichsten Werke. Wie außergewöhnlich die Aufmerksamkeit der kleinen bürgerlichen Intellektuellenschicht, zu der die Schumanns zählten, für ihre Kinder war, erkennt man, wenn man sich vor Augen hält, dass 1840 Kinder im Tagebau und Fabriken, in Landwirtschaft, Gastronomie, Kleingewerbe und weiteren häuslichen Produktionsstätten arbeiteten, wo alle Familienmitglieder am Küchentisch Kleinwaren und Spielzeug produzierten. Hier sägte man Püppchen, Holzpferdchen, Hampelmännchen und »Klappern« aus, schmirgelte und lackierte, was die Schumann-Kinder unterm Weihnachtsbaum fanden. Noch die Kleinsten sortierten Knöpfe oder Fäden. Die tägliche Kinderarbeitszeit konnte bis zu 14 Stunden betragen. Erst die flächendeckende Schulpflicht im Deutschen Kaiserreich sowie das Heimarbeitsgesetz von 1911 schufen Kontrollmöglichkeiten, um Kinderarbeit zu begrenzen (Ploetz 1998, S. 695; Gestrich/Krause/Mittauer 2003, S. 59ff). Parallel zur Aufwertung der Kindheit in den bürgerlichen Schichten entstand bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine prosperierende Kinderbuch- und Spielzeugindustrie. Auf Warenmessen in Leipzig und Nürnberg wurden die Produkte vertrieben. Als »Glückpfand« der Liebe komplettierten Kinder das häusliche Idyll. Dabei war das Gebären für Frauen aller Schichten eine Sache auf Leben und Tod. So zählte Kindbettfieber zu den allgegenwärtigen Erfahrungen. »Mir graut, wenn ich das Wochenbett ansehe, das ich jetzt schon in meiner Wohn236
Paar-Konzepte
Stube stehen habe«, so Clara Schumann. »Meine Angst ist entsetzlich und meine einzigste Bitte zu Gott, daß er mich nicht von meinem Robert nimmt«. Die Niederkunft am 1. September 1841 zog sich hin. Neben der Hebamme assistierten noch ein Arzt und ein »Accoucheur« (Geburtshelfer), die selben, die schon Clara 1819 auf die Welt geholfen hatten, wie sie ihrer Mutter begeistert schrieb (an M. Bargiel, 28. August und 6. September 1841). Alles ging gut. »Wir waren ganz selig vor Glük« notierte der mitgenommene Vater {Tb 2, S. 184). Zwar gab es bereits Entbindungsanstalten, wie die von Carl Gustav Carus 1814 in Dresden gegründete, doch mieden bürgerliche Frauen sie, weil sie um ihren Ruf fürchteten (Honegger 1996, S. 208; Hudemann-Simon 2000, S. 197). Rückblickend kann man fast sagen: zum Glück, denn vor den durchgreifenden Hygienereformen von Ignaz Philipp Semmelweis gegen das Kindbettfieber, die erst in den 1860er Jahren und dann auch nur zögerlich umgesetzt wurden, schien die Infektionsgefahr in Krankenhäusern noch größer gewesen zu sein als in einem sauber geführten Privathaushalt. Ungeduldig hofften die Schumanns schon 1842 auf ein Geschwisterkind (Bw, S. 1176). Die zweite Tochter, Elise, wurde dann am 25. April 1843 geboren, am selben Tag wie die zweite Tochter von Queen Victoria, wie Clara Schumann genüsslich notierte. »Diesmal ging es leichter«. Zwar hatten sich die Eltern »einen Knaben gewünscht«, doch freuten sie sich über das gesunde Kind und rechneten auf weitere. »Wir sind ja auch noch jung« (Tb 2, S. 263). Clara Schumann stillte ihre Kinder nicht selbst, obwohl damalige Ratgeber dazu aufforderten, sondern engagierte Ammen dafür. Wieder folgte ein Mädchen,Julie, geboren am 11. März 1845. Elf Monate später, am 8. Februar 1846, kam das Kronprinzchen zur Welt. »Freudentag«, unterstrich der glückliche Vater im Haushaltbuch (Tb 3, S. 413). Der Kleine wäre »trotzdem, daß Du nie Pathenstelle bei meinen Kindern vertreten willst, nie mich besuchst, nach Dir Emil genannt worden«, teilte die stolze Mutter Emilie List mit. Allerdings geizten die Genien an seiner Wiege mit Lebenskraft. »Verhärtete Drüsen« machten ihm zu schaffen. »Er starb in meinen Armen an Zahnkrämpfen«, am 22. Juni 1847, so die Mutter. Fast immer »kränklich« hätte er »wenig Freuden auf der Welt gehabt. Nur einmal habe ich ihn lächeln gesehen«, hielt Schumann zur Erinnerung für die Geschwister fest. Wie sehr die Eltern ihn betrauerten, lässt sich kaum erschließen (in: Wendler, S. 131f. und 149; E. Schumann, S. 324). Ein Nachfolger reifte schon heran. Ludwig wurde am 20. Januar 1848 geboren. »Ein starkes, gesundes Kind«. Mitten in der Nacht weckte der Vater die Älteste, um den kleinen Bruder zu begrüßen. »Dick wie ein Posaunenengel«, so Clara Schumann, »Gott erhalte mir diesen Jungen, ich bin immer Familienleben
237
in Angst um ihn, weil er mich gar so selig macht!« . Er dürfte ihr Lieblingskind gewesen sein. »Notenschreiber Fickler«, »100 St. [ück] Cigarren«, »Nach V/2 Uhr Nachmittag ein Knäblein« {Tb 3, S. 498), trug Robert Schumann am 16. Juli 1849 ins Haushaltbuch. Ferdinand wäre »ein reizendes Kind voller Kraft und Gesundheit; ich war ganz wohl und erholte mich schnell, so daß ich in vollster Kraft wieder der Goethefeier beiwohnen konnte, wo Roberts Faustscenen aufgeführt wurden«, raffte Clara Schumann die Ereignisse zusammen. Angesichts der Begeisterung für ihre großen Mädchen und der intensiven Beschäftigung mit den beiden Ältesten schien die Rolle weiterer »Stammhalter« nicht mehr so vordringlich zu sein wie anfangs (E. Schumann, S. 326; Wendler, S. 152ff). Allmählich schlug die Euphorie um. Mit sechs Kindern fühlte sich Clara Schumann reichlich genug gesegnet. Aus Hoffnungen wurden Befürchtungen. Gleichwohl schien sie sich mit den Kindern dann doch abzufinden, waren sie erst einmal geboren. »Es ist doch eigen, wenn man so viel Kinder hat, freut man sich nicht auf Das, welches kommt, ist es aber da, so hat man es unbeschreiblich lieb, als hätte man Keines noch gehabt«, tröstete sie sich nach der Entbindung des siebten Kinds, Eugenie, am 1. Dezember 1851. Es wäre von »Allen das hübscheste« (an M . Bargiel, 13. Dezember 1851). Mechanische Verhütungsmittel wie Kondome und Pessare gab es im 19. Jahrhundert. Ihr Gebrauch sollte vor allem beim Militär und in der Prostitution die Infizierung durch Geschlechtskrankheiten eindämmen. Allerdings waren die Objekte aus Wachstuch oder Tierdärmen mit ihren delikaten Nähten nicht sonderlich komfortabel. Unter Ehepaaren blieben sie ohnehin verpönt. Abgesehen von religiösen Verboten und allgemeinen ethischen Erwägungen, bei denen die Funktion der Ehe zur Kinderaufzucht im Mittelpunkt stand, kursierten Gerüchte, sie könnten gesundheitsschädlich wirken und die Zeugungskraft beschädigen. Eine große Kinderschar trug nicht zuletzt zum Prestige bürgerlicher Familien bei, trotz oder gerade wegen der gesundheitlichen und finanziellen Risiken. Eheliche Schwangerschaften zu unterbinden, empfanden Männer außerdem als Betrug um die Erzeugnisse ihrer Potenz. Neben oralen und analen Verkehrsformen, unpopulären M a ß nahmen wie dem Coitus interruptus oder gar Enthaltsamkeit praktizierten bürgerliche Ehefrauen auch indirekte Methoden und versuchten durch Kräuterspülungen beziehungsweise Einnahmen, große körperliche Anstrengungen oder kalte Bäder Fehlgeburten herbeizuführen. Abtreibungen fielen unter ein Tabu, wenngleich sie vorkamen. Moralische Bedenken verhinderten allerdings eine allgemeine Diskussion darüber (Geschichte des privaten Lebens 4, S. 562ff). Auch die Schumanns beschäftigte dieses Thema.
238
Paar-Konzepte
Leider hätte sie die »traurige Entdeckung gemacht«, wieder schwanger zu sein, liest man in einem verzweifelten, streng vertraulichen Brief Clara Schumanns an ihre Mutter. »Unrecht kann es doch nicht sein [...], daß man sich einige Jahre Ruhe wünscht, und besonders, wenn man, wie ich, ein hohes Ziel in der Kunst verfolgt!« Die besten Jahre gingen in Schwangerschaften und Wochenbetten dahin. Doch ihr Mann dächte anders. »Ob es denn nicht besser sey, daß wir uns so innig liebten und viele Kinder bekämen, als wenn wir uns weniger liebten, und wenig oder Kein Kind hätten!« referierte sie dessen Argumente und stellte sich schicksalsergeben auf »ein Dutzend« ein (an M . Bargiel, 22. Juli 1852). Schumann fühlte sich in der Rolle des Familienvaters wohl. Die trüben Gedanken seiner Frau kamen indessen nicht von ungefähr. Im Sommer 1852 steckte ihr Mann erneut in einer tiefen gesundheitlichen Krise. »Es wird fast täglich schlimmer« (C. Schumann, in: Litz,mann 2, S. 270). »Traurige Ermattung meiner Kräfte«, so Robert Schumann (Tb 3, S. 601). Nachdem ein Kurzurlaub am Rhein keine Besserung brachte, schlug man Seebäder in Scheveningen vor. Schumann erholte sich gut. Kurz vor der Rückreise, am 9. September, erlitt Clara Schumann eine Fehlgeburt. »Klaras Gewissheit«, lautete die knappe Notiz vom 3. Oktober 1853. »Ich bin so entmutigt, daß ich es gar nicht sagen kann«, so ihr Kommentar (Tb 3, S. 637; Litzmann 2, S. 279). Die Auftrittspläne für die Wintersaison mussten wieder einmal revidiert werden. Nach einer Hollandtournee im Spätherbst 1853 folgte nur noch eine kurze Reise nach Hannover im Januar 1854. Danach verschlimmerte sich Schumanns Zustand dramatisch. Als das Kind dann am 11. Juni 1854 zur Welt kam, war sein Vater schon seit drei Monaten in der Heilanstalt in Endenich. Seinen jüngsten Sohn kannte Schumann nur von einem Foto (Abb. 14). Dafür wurden die Kinder (ohne Julie, die vorübergehend bei der Großmutter in Berlin wohnte) im Atelier als Pyramide arrangiert. Sie sollten ein wohlgefälliges Bild familiärer Ordnung und Harmonie spiegeln. Der Teenager Marie, madonnenhaft im Zentrum mit Felix auf dem Schoß, dessen Gewand noch Eugenie Schutz gab, hält Ludwigs Hand. Hinter ihr steht Elise, die ihre Arme fürsorglich um Marie und Ferdinand legt. Offenbar mühten sich die ins Objektiv blickenden Kinder um fröhliche Gesichter, was bei der langen Belichtungszeit nur den älteren gelang. M i t ihrem separaten Porträt von 1854 sandte Clara Schumann eine andere Botschaft nach Endenich. Auf Franz Hanfstaengls Foto bekundete sie traurig, in melancholischer Pose, ihre Sehnsucht nach dem Abwesenden (Abb. 12). Da Kinder innerhalb von sieben Tagen mit einem Namen angemeldet werden mussten, wählte Clara Schumann für ihren Jüngsten aus den drei Familienleben
239
amtlich vorgeschlagenen Felix aus, im Gedenken an Mendelssohn Bartholdy. Er »hat so ein liebliches Gesicht - ich kann ihn gar nicht ansehen, ohne an meinen theuren Robert zu denken, er ähnelt ihm sehr« (an M. Bargiel, 14. Juni 1854). Die Taufe verschob sie auf Schumanns Rückkehr. Als sich keine verlässliche Perspektive dafür abzeichnete, wurde Felix schließlich am 1. Januar 1855 getauft. Pate standen Clara Schumanns Freundin Mathilde Hartmann, die Hauswirtschafterin Bertha Bölling, die Clara Schumann in Düsseldorf tatkräftig den Rücken frei hielt, und Johannes Brahms. Der zweite männliche Pate, Joseph Joachim, konnte als Jude die Verantwortung formell nicht übernehmen. Gleichwohl fühlte sich Joachim, der sich im selben Jahr auch taufen liess, lebenslang seinem »Pathchen« verbunden. Wie Eltern heute auch, so dokumentierten die Schumanns vor allem bei den ersten Kindern aufmerksam jede Regung, ein frühes Lächeln, die ersten Wörter, Liedchen und Verse, Vorlieben und Unarten. Diese Aufmerksamkeit erscheint deswegen ungewöhnlich, weil wenig vergleichbare zeitgenössische Privatzeugnisse über das Verhältnis von Eltern und Kindern erhalten oder zugänglich gemacht sind. »Jede Kleinigkeit interessirt mich«, forderte Clara Schumann aus Kopenhagen ein. »Ob sie Haare bekommt, ob es lockig oder glatt ist, wie es mit den Zähnen geht, ob sie eigensinnig, oder friedfertig ist« (Bw, S. 1147). Maries erster Ausflug allein zum Großvater Wieck (Dresden, 26. März 1846), ihr erster Freund, »Helmchen«, der erste Schulweg, der musikalisch als »Kleiner Morgenwanderer« op. 68 Nr. 17 in das Album für die Jugend eingegangen ist (Appel, in: Schumann-Interpretationen 1, S. 443), sowie Streiche und Anekdoten, etwa die, dass die acht Monate alte Marie vom Porträt der in Kopenhagen weilenden Mama, das der noch unerfahrene Vater ihr zur Erinnerung in die Hände gab, die Farbe ableckte, oder die Weltweisheit der Sechsjährigen, »wenn Gott nicht wäre, so gäb's auch keinen Gott«. Auch Kindergeburtstage richteten die Eltern aus. Die Begeisterung lässt sich in Robert Schumanns am 23. Februar 1846 begonnenen Erinnerungsbüchelchen für unsere Kinder nachlesen, das Eugenie Schumann veröffentlicht hat. Außerdem legte Schumann ein Gedenkbuch fiir Marie an, in das er ihre Verse und Liedchen eintrug. Aus der Sicht zeitgenössischer Pädagogik verhielten sich die Schumanns fortschrittlich, indem sie Kindheit als eigenständigen Wert anerkannten. Erhalten geblieben sind etwa Schumanns kindgerechte Kompositionen, die zum frühen Unterricht verwendet wurden (Klavierbüchlein fiir Marie). Marie dichtete »fast täglich ein Verschen, und zeigt viel Anlage, was den Robert ganz glücklich macht« (an M. Bargiel, 28. September 1851). Die Eltern wollten auch keine diktierten Briefe lesen, sondern die Kinder »sollen selbst 240
Paar-Konzepte
nachdenken lernen«, mahnte Clara Schumann (in: Brunner, S. 110). In Dresden besuchten die Alteren den nach Friedrich Fröbels reformpädagogischen Ansätzen geführten Kindergarten von Adolf Frankenberg. Da diese neue Form einer kindliche Fähigkeiten und Bedürfnisse respektierenden »freien« Erziehung den politischen Behörden suspekt war, wurden die Fröbelschen Einrichtungen in Preußen 1851 verboten (Brunner, S. 136 und 158). Clara Schumann übernahm phasenweise die musikalische Ausbildung ihrer beiden Altesten. Ein schillerndes Privileg. Einerseits fühlte sich die Mutter »entschädigt für die große Mühe und Geduldsprobe« durch deren Fortschritte, die die Eltern von Beginn an kritisch bewerteten. Andererseits trieb sie die Kinder mit ihren hohen Anforderungen ständig an. »Sie hatten keinen Respect vor anderen«, so die Lehrerin 1851 an Marie von Lindemann. Doch »mit mir, wissen Sie wohl, ist nicht spaßen!« (in: Brunner, S. 158). Dazwischen wurden die Mädchen aber auch von Friederike Malinska, Mitglied des Chorvereins, unterrichtet. Sie studierte 1849 auf Wunsch von Schumann mit Marie und Elise heimlich den »Geburtstagsmarsch« op. 85 Nr. 1 als Überraschung für die Mutter ein (Brunner, S. 78). Die »Großen« durften manchmal mit auf Konzertreisen wie im Winter 1846/47 nach Wien. In Schumanns Reisenotizen für die beiden mischen sich dokumentarische und anekdotische Einträge. So zählte er neben Sehenswürdigkeiten und Prominenten, an die sie sich erinnern sollten, wie den Stephansdom, Jenny Lind, Fischhof, Lickl und Hanslick, auch ihr Kindermädchen Fanny und den Diener Ignaz auf. Die Anekdote, dass das Vater seine sechs- und viereinhalbjährigen Töchter in Wien ausschickte, um einen Brief zu besorgen, und die herumirrenden Kinder glücklicherweise auf dem Stephansplatz ihrer Mutter über den Weg liefen, fugte Eugenie aus dem Erinnerungsschatz ihrer Schwestern noch hinzu (E. Schumann, S. 323). Im Erziehungsprogramm zählten solche Reisen als Belohnung. Gleichzeitig gehörten brave, propere Kinder aber auch zur bürgerlichen Selbstinszenierung des Künsderpaars. Dazu spannte Clara Schumann schon mal ihre Schülerinnen Emilie Steffens und Marie von Lindemann ein. Die 20jährige Steffens war 1848 aus Detmold gekommen, um bei Clara Schumann zu studieren. Sie nahm aktiv am Familienleben teilt, wurde zu Weihnachten und zu Ausflügen eingeladen, gleichzeitig aber auch erstaunlich intensiv mit verantwortungsvollen privaten Aufgaben betraut. Die Balance zwischen Ehre und Ausnutzung lässt sich dabei schwer bewerten. So hatte Steffens 1850 die Bahnreise der neun- und siebenjährigen Tochter von Dresden nach Leipzig zu organisieren, wo beide Eltern in die Vorbereitungen zur Uraufführung der Oper Genoveva op. 81 involviert waren. »Bitte vergessen Sie nicht, [...] die guten seidenen Familienleben
241
Kleider für die beiden Ältesten machen zu lassen«. Sie sollte darauf achten, dass die Kinder »ganz reinlich gekleidet sind, damit sie sich gut präsentieren«. Und: »lassen Sie sie Donnerstag noch baden, und tüchtig die Köpfe waschen, und auch gehörig kämmen«. Man fühlt das Ziepen geradezu. Beim Abschied hatten die Eltern die fünfjährige Julie einfach vergessen. Peinlich. Man brachte den Kleinen etwas von der Reise mit. Julie erhielt eine Babypuppe, Ludwig bekam »Soldaten und ein schönes Bilderbuch«, ganz im Einklang mit der geschlechtsspezifischen Ordnung der Zeit (in: Brunner, S. 99fF). Soweit die Dokumente erkennen lassen, waren die Autoritäten innerhalb der Familie hierarchisch verteilt mit dem Vater als oberster Instanz. Ansonsten lag die Erziehungsverantwortung wie im neuen bürgerlichen Familienmodell auch hier offenbar weitgehend bei der Mutter. Obenan standen Tugenden wie Fleiß und Gehorsam, Disziplin, Selbstkontrolle und Reinlichkeit. Zur Belohnung verteilte man Lob, aber auch Geldstücke oder Geschenke. »Sie können mir einen Wunschzeddel von Jedem, der artig gewesen, mit schicken«, unterstrich die reisende Mutter. Ungehorsam und Faulenzen wurde bestraft. Es setzte auch Schläge. Doch hauptsächlich dreht sich alles um Papa. Darauf konzentrierte sich die Mutter, danach richteten sich der Haushalt und der gesamte Tagesablauf. Dem Ruhebedürfnis des Komponisten mussten sich auch die Kinder unterordnen und still sein, wenn der Vater arbeitete. Manchmal durften auch sie tagelang nicht üben (Brunner, S. 101; E. Schumann, S. 318). Obwohl die Schumanns sich in der Elternrolle gut gefielen, ist kein Familienbild überliefert, sondern nur Einzel- und Paarporträts. Neben Rietschels die Künstlergemeinschaft idealisierendem Doppelmedaillon lithographierte Eduard Kaiser Clara und Robert Schumann in Wien im Januar 1847 ohne musikalische Ingredienzien als schlichtes bürgerliches Ehepaar im biedermeierlichen Sinne (Abb. 8). Auf der rechten Bildseite sitzt die Frau als Halbfigur in Dreiviertelwendung aufrecht in einem Armlehnstuhl, dezent und hochgeschlossen gekleidet, die Hände sittsam auf dem Schoß gefaltet. Ihr Blick richtet sich seltsam leer ins Ferne. Der Mann nimmt frontal die linke Bildhälfte ein. Auch sein Blick, in Richtung der Betrachter, bleibt unfixiert und leicht trübe. Um ihn in erhöhte Position zu bringen und das Gefalle zwischen den Geschlechtern im Bildprogramm zu betonen, scheint er - anatomisch etwas gequält - auf einer Kante oder Lehne zu hocken. Trotz der körperlichen Nähe nehmen die Figuren keinen Kontakt zueinander auf. Robert Schumann gefiel das bei Diabelli vertriebene Porträt offenbar, denn er verschenkte es häufig. »Der Großvater schaut da so starr drein«, so der spätere Kommentar des Enkels Ferdinand. Seine Großmutter hätte das Bild nicht 242
Paar-Konzepte
gemocht, überlieferte er (in: NZflrf 1917, S. 79f). Die private, hausmütterliche Seite Clara Schumanns dokumentieren zwei möglicherweise nicht zur Veröffentlichung bestimmte Zeichnungen dieser Jahre, von Wilhelm Hensel 1847 in Berlin, die Clara Schumann in häuslicher Haube zeigt (Abb. 9), und eine von Jean-Joseph-Bonaventure Laurens 1853 in Düsseldorf gefertigte. In Hamburg entstand im März 1850 das einzige erhaltene Foto des Paares, eine Daguerreotypie von Johann Anton Völlner. Im Brief des Verlegers Schuberth, der ein neues Bild für die Werbung wünschte, sollten sie »einander gegenüber sitzend« aufgenommen werden. Vermutlich hing der Auftrag mit dem Erfolg des Albums für die Jugend op. 68 zusammen (Busch-Salmen 1996, S. 816; Abb. 10). Das erhaltene Original imaginiert ein hausmusikalisches Idyll. Clara Schumann posiert etwas abgerückt in feinem dunklem Kleid vor einem Klavier, die rechte Hand locker auf den Tasten, den Blick ins Leere schweifend, während sich Robert Schumann in Denkerpose auf das Instrument stützt und sinnend ihre Hand zu betrachten scheint. Da die Daguerreotypie noch nicht reproduziert werden konnte, fertigte man zur Verbreitung verschiedene Zeichnungen und Stiche an. Noch 1904 wurde das populäre Bild erneut kopiert. Dagegen weichen zwei Porträts, die Clara Schumann von sich machen ließ, auffallend vom häuslichen Idyll ab. In dem Ölgemälde des Düsseldorfer Malers Carl Ferdinand Sohn vom Herbst 1853 präsentiert sich eine geachtete Künstlerin in vornehmer Gelassenheit selbstbewusst im Zentrum zwischen zwei Halbsäulen positioniert, den Ellbogen locker auf ein reich verziertes Postament gestützt, auf dem ihre lässig abgestreiften Handschuhe liegen. Die elegante Kleidung, ein aufwändig gestuftes, mit einer Fibel geschlossenes, weit ausgeschnittenes Oberteil, der filigrane Spitzenschleier und ein um die Schultern gelegter großer Kaschmirschal, unterstreicht den vornehmen sozialen Status (Abb. 11). Clara Schumann schenkte das Bild ihrem Mann zu Weihnachten. Der musste sich allerdings erst darin einfinden. Sohns »herrliches Portrait [...], lebensgroß in Oel gemalt« wäre seit einigen Tagen in Leipzig ausgestellt und zöge »zahlreiche Bewunderer herbei«, hieß es in den Signalen fiir die musikalische Welt (9. November 1854). Ein Kniestück, »in genialer Charakterauffassung, mit blendender Pracht«, urteilte die NZflW (1854, S. 71). Ein vergleichbares, wenn auch ganz anders umgesetztes Bildprogramm enthält ein früheres, 1844 von August Wilhelm Wedekind gefertigtes Porträt als Halbfigur (Abb. 5). In ihm gab der Maler vor allem dem reichen Goldschmuck Glanz, der auf den zurückhaltenden Farben der raffiniert gefältelten und geschmokten Kleidung (eisgraue Seide, ecrufarbene durchsichtige Spitzen und dunkelgrauer Samt) als besonders wertvoll Familienleben
243
hervorsticht. Ob die Porträtierte wirklich Clara Schumann darstellt, scheint allerdings offen zu sein. Die unterschiedlichen Bilder dieser Jahre korrespondieren mit den verschiedenen Rollen, die Clara Schumann mit dem ihr eigenen Perfektionismus unter einen Hut zu bringen suchte. Dass von acht Kindern sieben das Erwachsenenalter erreichten, während im Durchschnitt nur etwa die Hälfte aller Neugeborenen soweit kam, spricht für gute Hygiene, gesunde Lebensführung und eine ausreichende Ernährung. Insgesamt überstand auch die Mutter die Strapazen ständiger Schwangerschaften offenbar bravourös, selbst wenn sie jedes Kind mit Zahnverlust zahlte (an M. Bargiel, 19. November 1851). Die Schumanns ließen ihre Kinder impfen - vermutlich gegen Pocken (Bw, S. 1182; Hudemann-Simon 2000, S. 200f.) - und auch die Mädchen draußen spielen. Dafür zu sorgen gehörte zu den Belangen der »Hausfrau«. Jedoch entsprach das zeitgenössische Ideal durchaus nicht der »Nur-Hausfrau« des 20. Jahrhunderts, die ihr blank gescheuertes kleines Familienreich mit Pfannkuchen regierte. Vielmehr erwartete man kluges Haushaltsmanagement. Neben emotionalen Komponenten, wie Wahrung des >Hausfriedens< und gemütlicher Ausschmückung des Heims, galt es, umsichtig und sparsam zu wirtschaften. Clara Schumann engagierte Haus- und Kindermädchen, beaufsichtigte deren Arbeit, zählte die Wäsche nach, schlichtete Zank und Streit. Ihre erste Köchin brachten die Schumanns wegen Diebstahls sogar vor Gericht (Tb 2, S. 263). Hier mischte sich ihr Mann in der Regel nicht ein. »Gesucht wird zum baldigen Antritte eine gute Köchin, welche zugleich alle Hausarbeiten versieht«, annoncierte Clara Schumann 1852 in der Düsseldorfer Zeitung. Ihrer Kinder wegen wollte sie keine »Dienstboten ohne Bildung« (in: Kat., S. 200; Brunner, S. 99). Umsichtig versuchte die Hausfrau auch während ihrer Abwesenheit, alles bis ins Detail zu kontrollieren. Ihre generalstabsmäßigen Anweisungen waren detailliert und aufwändig. Gewohnt an Professionalität, erwartete sie selbstverständlich deren prompte Erledigung, auch von Schülerinnen und Freundinnen. »Ist Elisens Kleid mit fester Taille gemacht? daß ja Alles sitzt, sonst ärgere ich mich« (in: Brunner, S. 105). Ein wichtiger Posten war die Wische. Saubere Kleider galten als »Prestigeobjekte« (Bertz 2004, S. 18). Ihre Pflege kostete Zeit und Geld. Da die oft schweren Stoffe nur mühsam zu reinigen waren, nähte man Hemden und Kleider mit abnehmbaren Krägen. Vornehme Frauen trugen außerdem mehrere Schichten Unterröcke, Korsette und leinene Leibwäsche. Die Auftrittsgarderobe zählte extra. Auf der Bühne benutzte Clara Schumann flache weiße Seidenschuhe, die mehrfach wieder aufgearbeitet wurden. Da Dienstleistungen in Dresden günstiger waren als in Düsseldorf, ließ sie vieles dort erledigen und schickte im September 1852 ein Paket
244
Paar-Konzepte
mit einem Kleid, das sie »möglichst schön gefärbt« haben wollte, »vielleicht Kornblumenblau« oder braun, Krägen und Bänder »zur Wäsche«, Leinwand und Wollstoff zum Nähen sowie sechs Paar Schuhe zur Reparatur an Marie von Lindemann. Die sollte sie zu einer bestimmten Näherin bringen, aber »bald«., »denn ich brauche sie [...] spätestens bis zum 24ten Oktober«. Hüte und Handschuhe wurden fertig gekauft (Brunner, S. 179; Fashion 1, S. 196ff). Der von Renate Brunner veröffentlichte Briefwechsel Clara Schumanns mit Emilie Steffens und Marie von Lindemann bietet aufschlussreiche Einblicke in die komplizierte Alltagsorganisation der großen Familie und in die Fülle von Dienstleistungen, die die Künstlerin ihren Freundinnen zumutete. Schon als Mädchen führte sie ein eigenes »Rechnungsbüchelchen« (Bw, S. 544). Von ihren Haushaltsbüchern ist allerdings keines erhalten. Robert Schumann übergab seiner Frau einen fixen Betrag als Wirtschaftsgeld und bei außergewöhnlichen Anlässen Extras. Sie versuchte, damit auszukommen, legte aber auch aus ihren eigenen Ersparnissen wöchentlich bis zu zehn Taler dazu. Die Fleischpreise stiegen, die Amme äße »für Dreie« und dann noch die Miete! In Düsseldorf zogen die Schumanns mehrfach um. Es war nicht leicht, mit so einer großen Familie eine geeignete »Wohnung von 6 bis 7 Theilen zu miethen«, so die Annonce in der Düsseldorfer Zeitung (in: Kat., S. 200). Teils gefielen ihnen die Logis nicht, dann wurde das Haus verkauft, dann war es zu laut und zu feucht. Allein die vielen Umzüge verschlangen Unsummen an Zeit, Geld und Energie. Außerdem brauchte man in so einem »kleinen Neste« wie Düsseldorf mehr Mittel für Äußerlichkeiten als in einer Großstadt, weil die Leute ständig beobachteten, »wie man sich kleidet ect. ect., sie haben ja nichts weiter zu thuen« (an M. Bargiel, 13. Dezember, 1851; 15. April und 6. September 1853). Das Geld blieb knapp. Bis zu Robert Schumanns Anstellung in Düsseldorf 1850 waren die Einkünfte unregelmäßig, und ihre Höhe schwankte sehr. Als das Stammkapital, von dessen Zinsen man eigentlich leben wollte, Ende 1843 dramatisch schmolz, ließ sich die schon seit 1839 immer wieder geplante große Auslandstournee nicht länger aufschieben. Zwar konnte der Haushalt durch Unterricht und kleinere, regionale Auftritte aufgestockt werden, doch ansehnliche Summen verdienten Virtuosen nur in den internationalen Zentren, am meisten in London und in Sankt Petersburg. Am 25. Januar 1844 brachen die Schumanns nach Russland auf. Sie reisten mit der Postkutsche über Königsberg, Riga, Dorpat und Reval nach Sankt Petersburg und Moskau und kamen auf dem Seeweg am 24. Mai 1844 wieder zurück. Obwohl Clara Schumann die Verdienstmöglichkeiten dort nicht Familienleben
245
optimal nutzte, weil sie zu spät in Russland eintraf und ihre Werbung aus Unkenntnis der lokalen Gegebenheiten nicht recht griff (Lossewa 2004, S. 18ff. und 37ff), sicherten die dortigen Einnahmen für die nächste Zeit ihre Existenz. Nach der viermonatigen Reise, die er, unfähig zur Komposition, als Tourist genoss, fiel Schumann in eine schwere gesundheitliche Krise. Er gab sowohl die Leitung der Neuen Zeitschrift für Musik als auch den Unterricht am Konservatorium auf. Trotz der Nähe Friedrich Wiecks zogen die Schumanns nach Dresden, ohne dass sich die wirtschaftlichen Perspektiven wirklich besserten. M a n wollte von den Zinseinnahmen aus seinem Erbe, seinen Honoraren und dem, was Clara Schumann hinzu verdiente, leben, wie schon zu Beginn der Ehe geplant. Inzwischen waren allerdings zwei Kinder geboren und ein drittes unterwegs, das im März 1845 zur Welt kam, drei weitere folgten in Dresden kurz hintereinander nach (Emil, Ferdinand, Ludwig). Das heißt, die wirtschaftliche Situation verbesserte sich nicht, sondern spannt sich noch weiter an. Trotzdem verließen die Schumanns Leipzig und zogen Ende 1844 hoffnungsvoll um. Jetzt hatte der Komponist keine weiteren Verpflichtungen mehr. Vielmehr versuchte Clara Schumann, ihm den Rücken vollständig frei zu halten. Doch in den Dresdner Jahren setzten Robert Schumann verschiedene schwere Gesundheitsattacken zu, die sich in Nervosität, Verstimmung, Überreiztheit, »starke[m] Blutdrang nach dem Kopf mit großer Unruhe« und »Singen und Brausen im Ohr« äußerten ( L i t z m a n n 2, S. 126f). Inwieweit Clara Schumann, auf deren Betreiben der Umzug stattgefunden hatte, schon jetzt damit begann, ihren gesundheitlich angegriffenen Mann vor allzu neugierigen Blicken zu schützen und deswegen den Umzug nach Dresden forcierte, bleibt spekulativ. Auf jeder Reise überlegte man, dorthin zu übersiedeln, wo man gerade konzertierte. So hatten die Schumanns 1844 Moskau und 1846 Wien als neues Zuhause erwogen, aber nach dem Misserfolg ihrer Wiener Konzerte den Plan gleich wieder begraben. Weihnachten 1846 gab es nicht einmal eine Bescherung »Wir hatten ja noch nichts verdient« (in: Litzmann 2, S. 144). Auch Berlin stand 1847 zur Debatte, vor allem aufgrund der näheren Bekanntschaft mit Fanny Hensel und ihren musikalischen Aktivitäten. Darin erkannte Clara Schumann nun eine gleich gesinnte Gefährtin in der Kunst. Sogar deren Klavierspiel fand Gnade (die Kompositionen allerdings weniger). Mit Hensels Tod im Mai 1847 zerplatzte auch diese Seifenblase. Als die Kinder größer wurden, beschlossen die Schumanns, vorerst nicht mehr umzuziehen, weil sie die Kleinen »nicht aus der Schule reißen« wollten (in: Endenich, S. 45). 246
Paar-Konzepte
Schon vor der Hochzeit wurde auch immer wieder der Plan erwogen, wenigstens fiir einige Jahre nach Amerika zu gehen, um sich finanziell zu sanieren. Liest man Nikolaus Lenaus ernüchternde Amerikaerfahrungen und seine vernichtende Einschätzung des dortigen Liberalismus aus den 1830er Jahren, so muss man es vermutlich glücklich nennen, dass die Schumanns trotz der zeitweiligen Engpässe diesen Schritt dann doch nicht wagten. Robert Schumanns Kompositionshonorare stiegen erst nach 1849 nennenswert an. Mit seinem Düsseldorfer Dirigentengehalt von 750 Talern, Kompositionserträgen und Clara Schumanns Honoraren war das Auskommen ab 1850 dann im Prinzip gesichert (Nauhaus, in: Tb 3, S. lOf). Doch Clara Schumanns Panik vor einem sozialen Abstieg wich während der gesamten Ehe nicht. »Ich sehe Robert täglich Summen ausgeben und doch keinen Entschluß fassen Etwas zu verdienen«, vertraute sie ihrer Mutter schon 1841 an. »Je ruhiger Robert dabei bleibt, desto schrecklicher tobt die Unruhe in meinem Innern« (an M. Bargiel, 18. Oktober 1841). Schumann war großzügig. Zum Geburtstag 1851 schenkte er seiner Frau einen Sessel, über dessen Preis sie gleich am Morgen in Tränen ausbrach. Zwei Jahre später stand als Überraschung ein neuer Flügel im Geburtstagszimmer. Auf ihm lagen das Konzert-Allegro mit Introduktion op. 134, die Phantasie für Violine und Orchester op. 131 sowie die Partitur und Klavierauszüge (zu zwei und vier Händen) der Faust-Szenen (WoO 3). »Bin ich nicht das glücklichste Weib auf der Erde?« Man feierte mit Champagner und Torte (Tb 3, S. 635f. und 807f.; Litzmann 2, S. 277). Trotz der Gelassenheit, mit der Schumann auf die Zukunftsängste seiner Frau zu reagieren schien, hinterließ der permanente Stress, vom eigenen Kunstprodukt eine Familie zu ernähren, offenbar doch tiefe Spuren. Wie in den 2006 veröffentlichten Krankenakten nachzulesen ist, kämpfte der Patient wiederholt lautstark um sich schlagend mit Dämonen, die ihm seine Kompositionen streitig zu machen suchten. »Seit gestern äußerst laut, brüllend, schreiend, auch in der Nacht: geht zur Visitezeit im Zimmer umher, verschiedene seiner Werke berührend unter dem Rufe: Das ist mein. Sehr verstörtes Aussehn« (10. Oktober 1855, in: Endenich, S. 334). Allerdings kann man die zwischenzeitlich immer wieder prekären Finanzsituationen oder die teils kümmerlichen Konzerteinnahmen nicht allein Robert Schumanns Eigenheiten oder Clara Schumanns Publikumsüberforderung zurechnen. Während die Schumanns ihre Familie gründeten, gerieten die deutschen Länder in den Sog einer der größten Wirtschaftskrisen des 19. Jahrhunderts. Ausgelöst wurde sie durch eine schleichende agrarische Umweltkatastrophe (Zorn 1976, S. 29f. und 441ff.; Reichholf Familienleben
247
2007, S. 141fF). Aufgrund intensiver Übernutzung waren die Böden so ausgelaugt, dass die Erträge schwanden. Auf den zu Magerwiesen verarmten Fluren wuchsen zwar Blumen, doch kein Getreide mehr. Infolgedessen verteuerten sich die Lebensmittel drastisch. Wie ein Lauffeuer griff die landwirtschaftliche Notlage auch auf andere Bereiche über und löste weitere, allgemeine ökonomische, soziale und politische Krisen aus, die in den revolutionären Aufständen Ende der 1840er Jahre ihren Höhepunkt erreichten. Vor diesem Hintergrund rückt die Selbständigkeit der Schumanns in ein anderes Licht. Zwischen 1820 und 1849 schrumpften die Realeinkommen. Die Auswandererwelle nach Amerika schwoll auf über eine Million an. Davon profitierten die eilig gegründeten Uberseegesellschaften. Vitale Arbeitskräfte gingen verloren. Gleichzeitig verringerte sich die Bevölkerung auf knapp 32 Millionen Einwohner, weil (anders als bei den Schumanns) auch die Geburtenrate sank. Im Reichsgebiet reduzierten sich die Studentenzahlen um 25 Prozent. Dadurch war die aufstrebende Kultursparte ebenfalls bedroht. Hinzu kam der Krimkrieg, in den die europäischen Mächte verwickelt wurden. Erst der Einsatz von so genanntem Superphosphat, einem chemischen Kunstdünger, den Justus von Liebig und seine Mitarbeiter zwischen 1846 und 1849 entwickelt hatten, verbesserte in den 1850er Jahren die allgemeine Versorgung, und die Wirtschaft erholte sich wieder. Doch nun brach in das Leben der Schumanns die private Katastrophe herein. Trotz umfangreicher Dokumente über Robert Schumanns Zustände, wie die Krankenakten, das Sektionsprotokoll und zahlreiche weitere Zeitzeugnisse, finden sich »wirklich klare Äußerungen zu einer Diagnose« seiner Krankheit »an keiner Stelle« (Peters, in: Endenich, S. 461). Im Aufnahmebuch der Heilanstalt Endenich trug man zuerst »Melancholie mit Wahn« ein und ergänzte - vermutlich posthum - »Paralysie« (Appel, in: Endenich, S. 18f). Für Clara Schumann dürften die ärztlichen Expertisen vorrangig mit ganz lebensnahen Fragen verknüpft gewesen sein: Wird der Mann wieder gesund? Wann kommt er zurück? Was kann man tun? Der Hospitalisierung, die auf Robert Schumanns Wunsch am 4. März 1854 erfolgte, weil er wusste, dass er Hilfe brauchte, gingen dramatische Tage mit der ausbrechenden Krise voraus. Gehörshalluzinationen, Himmel- und Höllenfantasien quälten den Künstler nächtelang anfallsartig, »bis er in einen förmlichen Nerven-Paroxismus gerieth!«, so Clara Schumann an Emilie List (in: Wendler, S. 179). Zunächst wachte sie allein bei ihm, obwohl ihr Mann sie immer wieder fortschickte, weil er fürchtete, außer sich zu geraten und die Kontrolle zu verlieren. Dann engagierte sie Wärter und spannte auch 248
Paar-Konzepte
Freunde ein, die ihn tagsüber begleiteten, um sich »von dem fortwährenden Wachen zu befreien«, so der Düsseldorfer Konzertmeister Rupprecht Becker am 21. Februar. An diesem Tag »kam der erste heftige Verzweiflungsanfall«, schrieb Schumanns Schüler Albert Dietrich eine Woche später Joseph Joachim, »seitdem war Schumann offenbar geistig gestört [...] ich war täglich 3 Mal bei ihm; gewöhnlich befand er sich anscheinend ruhig; nur manchmal deutete er auf etwas Entsetzliches an, was die Geister ihm riethen auszufuhren« (in: Endenich, S. 50 und 56). Inzwischen hatte der Kranke einen Suizidversuch unternommen. Am Abend vorher sei er »plötzlich vom Sopha« aufgestanden, um in die Irrenanstalt zu gehen, und »legte sich alles zurecht, was er mitnehmen wolle, Uhr, Geld, Notenpapier, Federn, Zigarren«, konnte aber bewogen werden, ins Bett zu gehen, hielt Clara Schumann im Tagebuch fest. Sie hätte ihn am anderen Morgen nur kurz aus den Augen gelassen und stattdessen ihre Tochter Marie zu ihm geschickt. Jahrzehnte später beschrieb Marie Schumann die Situation aus der Sicht der damals Zwölfjährigen: »Ich sollte in der Mutter kleiner Stube sitzen und acht geben [...], da öffnete sich die Tür des Nebenzimmers, und mein Vater stand darin in seinem langen grüngeblümten Schlafrock. Sein Gesicht war ganz weiß - als er mich erblickte, schlug er beide Hände vor das Gesicht und sagte: >Ach GottVorwärts< ist das rechte Wort«. Mit ihrem durchschaubaren Satz und den die Fähigkeit von Laiensängern herausfordernden Stimmführungen sollten die Stücke vermutlich
Werke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
265
dazu beitragen, ein realisierbares (und trotzdem gediegen komponiertes) Repertoire fiir profane Chorvereine bereitzustellen. W i e viele Bildungsbürger hofften die Schumanns auf eine liberale Verfassung. »Wann wird einmal die Zeit kommen, wo die Menschen alle gleiche Rechte haben werden?«, trug Clara Schumann im M a i 1848 ins Tagebuch ein. Gleichzeitig fürchteten sie die Gewalt revolutionärer Barrikadenkämpfe und flohen aus der Stadt, anders als Richard Wagner, dessen kämpferische Aktivitäten die Schumanns aufgewühlt von fern verfolgten. Im Zuge der G e genrevolution und der Besetzung Dresdens durch preußische Soldaten drohten nun Einquartierungen. »Erst kommen sie, um unsere Bürger, die ihnen nichts getan, niederzuschießen, und dann müssen wir ihnen noch umsonst zu essen und zu trinken geben«, empörte sich Clara Schumann (in: Litzmann
2,
S. 189ff). Im Rückblick wirkt es so, als hätte die Künstlerin mit dem Abbruch des Konzertentwurfs 1847 begonnen, sich innerlich davon zu verabschieden, als Komponistin eine Partnerin auf Augenhöhe zu bleiben. Offensichtlich verlor sie die Hoffnung, die an sich selbst gestellten hohen Ansprüche auch tatsächlich erfüllen zu können. M i t scharfer analytischer Selbstkritik dürfte sie ihre Möglichkeiten, am fortschritdichen kompositionsästhetischen Diskurs mitwirken zu können, als unrealistisch eingeschätzt haben, da sie wusste, dass zur Professionalität Handwerk und Erfahrung gehörte. Doch blieb ja kaum Zeit für das notwendige Fingertraining der Virtuosin, geschweige denn der Freiraum, wie Mendelssohn Bartholdy jeden T a g einen Kontrapunkt zu schreiben, um in Ü b u n g zu bleiben. M i t ihrem klassizistisch ausgewogenen Klaviertrio hatte sie ein neues Niveau für den Start kühnerer Kompositionspläne erreicht. A m Klaviertrio ihres Mannes las sie dann aber offenbar ab, wie viel zu investieren wäre, damit das, was ihr vorschwebte, nämlich eine produktive Teilhabe am ästhetischen Fortschritt, realisiert werden könnte. Für die Differenz nutzte sie die Metapher »weibisch«. Ihre letzten Kompositionen verdanken sich einem Zufall. Nach mehr als einem halben Dutzend Umzügen in zwölf Jahren fanden die Schumanns in Düsseldorf endlich eine Wohnung, in der die Arbeitszimmer weit genug voneinander entfernt lagen, dass sie sich nicht gegenseitig störten. » Z u m ersten Male nach unserer Verheiratung treffen wir es so glücklich!« A b Januar 1853 konnte Clara Schumann ihre Musizierzeiten unabhängig vom Stundenplan ihres Mannes einteilen. »Wenn ich so recht regelmäßig studieren kann, fühle ich mich doch eigentlich erst wieder so ganz in meinem Elemente; es ist, als ob eine ganz andere Stimmung über mich käme, viel leichter und freier«,
266
Paar-Korizepte
schrieb sie ins gemeinsame Tagebuch. Ohne Musik »ist es, als wäre alle körperliche und geistige Elastizität von mir gewichen«. Nach fünfjähriger Unterbrechung begann Clara Schumann Ende Mai 1853 mit dem Entwurf der Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 20. »Es wird mir aber sehr schwer - ich habe zu lange pausiert« (in: Litzmann 2, S. 271ff). Fünf Tage später waren die Variationen fertig. »Meinem geliebten Manne zum 8ten Juni 1853 dieser schwache Wieder-Versuch von seiner Alten Clara«, lautet die Widmung auf der Geburtstagshandschrift. Als thematische Grundlage ihres Entwurfs wählte sie das 1841 komponierte, 24 Takte umfassende erste »Albumblatt« in fis-Moll aus Robert Schumanns Bunten Blättern op. 99 Nr. 4. Welche private Erinnerung sich mit ihrer Wahl verband, ist nicht zu erschließen. Ein gleichmäßiger Rhythmus, die im Quintrahmen absteigende Melodie und eine liedhaft-periodische Anlage prägen den in sich gekehrten, leisen Charakter des Stücks. Es bietet verschiedene Anknüpfungspunkte, um kompositorisch einzugreifen, wie den Wechsel von einer mehrstimmigen Linienführung zur Homophonie im Unterstimmensatz oder eine synkopische Verschiebung der Melodie in der dritten und vierten Themenzeile. Die melodischen, harmonischen und formalen Vorgaben des Themas sind in allen sieben Variationen erkennbar. Clara Schumanns Bearbeitung zielt auf das Ausleuchten einzelner Aspekte der Vorlage, die sie mit ihrer eigenen musikalischen Handschrift überschreibt. Nachdem Mendelssohn Bartholdy mit seinen Variations sérieuses op. 54 berückend vorgeführt hatte, dass auch diese Gattung anspruchsvoll gestaltet werden konnte, war ein neuer Standard gesetzt. Nicht virtuose Ausweitung, sondern eine nach innen gerichtete satztechnische Verfeinerung kennzeichnet Mendelssohns »seriösen« Entwurf. Daran knüpfte Clara Schumann an. Ihre Variationen folgen einer Ästhetik, nach der sich Anspruch und Qualität im Detail zeigen sollten. Als Gestaltungsmittel setzte sie die Auflösung des Basses in laufende Figuren (Variation 1), die Umwandlung in Akkordfiguren (Variation 2) sowie eine Verbreiterung der liedhaften Vorlage zu einem fünfbis sechsstimmigen Klavierstück in Dur (Variation 3) ein. Innerhalb der Variationen steigern sich die Ausdrucksmittel. So entwirft die Komponistin in der vierten Variation ein laufendes Figurenband aus Sechzehnteln, das das in den Alt verlegte Thema samt seiner akkordischen Begleitung wie eine Girlande umwindet, während danach der vollgriffige Akkordsatz von oktavierten Bassfiguren grundiert wird (Variation 5) und einen fast schon orchestralen Effekt erzielt. Dagegen setzt sich dann die in sich gekehrte, leise als Imitation beginnende sechste Variation, in der die latent polyphone Vorlage von Schumanns Stück thematisiert wird, wie ein Ruhepol ab. Ihr folgt eine braWerke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
267
vourös gesteigerte Finalvariation (Variation 7), an die sich übergangslos eine Coda anschließt. In ihr werden die Ereignisse zusammengefasst. Periodisch und dynamisch dem Thema entsprechend verweisen die üppige Harmonisierung in Fis-Dur auf die dritte, das Wechselspiel der Mittelstimmen auf die sechste und die abschließenden bewegten Lauffiguren auf die vierte, fünfte und siebte Variation. Als die Komponistin Brahms die Variationen am 24. Mai 1854 vorspielte, beschloss er offenbar spontan, das Thema ebenfalls zu variieren. Der inspirierende Funke war auf ihn übergesprungen. Bei Brahms klingt allerdings weniger der Stil von Mendelssohn Bartholdys Variations sérieuses an als vielmehr seine Auseinandersetzung mit der Musik der Schumanns. Eine erste Fassung schenkte er Clara Schumann zur Geburt von Felix am 11. Juni. Brahms erhielt im Juli eine Kopie von Clara Schumanns Stück, »auf freundliches Verlangen«, wie ihre Widmung lautet. Im August erweiterte Brahms seine Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 9. Unter der poetischen Uberschrift »Rose und Heliotrop haben geduftet« und der Spielanweisung dolce folgt die kontrapunktisch ehrgeizigste Variation des ganzen Stücks nach. Darin wird die Melodie zwischenzeitlich als Spiegelkanon durchgeführt. Am Ende dieser an zehnter Stelle eingereihten Variation ist zusätzlich als Zitat die kleine Romanzenzeile aus Clara Wiecks Romance variée op. 3 eingewoben, das erste Stück, das die damals Dreizehnjährige Robert Schumann gewidmet und das er als Grundlage seiner Impromptu über eine Romanze von Clara Wieck op. 5 gemacht hatte, die erste musikalische Hommage an sie. Clara Schumann bekam die erweiterte Version von Brahms am 13. September 1854 zum Geburtstag. »Brahms hat eine schöne Idee gehabt«, notierte sie für den abwesenden Ehemann ins Tagebuch. »Mein Thema aus alter Zeit hat er in Deines mit verflochten - ich sehe schon dein Lächeln« (Klassen 1990, S. 67ff.; Litzmann 2, S. 330). Diese Reminiszenz arbeitete die Komponistin dann auch für die Druckfassung ihrer Variationen in die Coda ein. Als sie die Variationen im Mai 1853 komponierte, befand sie sich in einem anhaltenden Stimmungshoch, sie war euphorisiert über das Gelingen der Komposition. Die Einstudierung der Variationen für ihr Repertoire 1856 fiel dann allerdings in die sehr kritische Lebensphase zwischen Schumanns Hospitalisierung und seinem Tod. An diesen tristen Kontext knüpften sich Clara Schumanns Erinnerungen, als sie ihre Variationen im Frühjahr 1886 fur die Londoner Saison wieder aufnahm. »Nie ist mir ein Stück so schwer geworden«, liest man im Tagebuch, »ich bin innerlich immer noch zu aufgeregt dabei«. Doch nicht aus technischen Gründen, sondern weil sie immer »eine unbeschreibliche Wehmut« überfiele, wenn sie die Variationen spielte. 268
Paar-Konzepte
»Ich lebe dann in jener Zeit, wo ich sie mit tausend Schmerzen und blutendem H e r z e n für Robert componirte, u m sie ihm nach Endenich zu schicken« {Litzmann
3, S. 477). Objektiv stimmt das nicht. Ihr M a n n bekam das Stück
schon ein Jahr vorher, nämlich am 8. Juni 1853. E s war sein letzter Geburtstag in der Familie. D a m a l s hatte Clara Schumann einen unbeschwerten, vergnügten Ausflug ins G r ü n e arrangiert. » E s macht mir großes Vergnügen das Komponieren«, liest man 1853, und sie begann unmittelbar nach den Variationen op. 20 damit, eine Reihe von Liedern zu entwerfen. »Mein letztes Lied habe ich 1846 gemacht, also vor 7 Jahren!« (in: Litzmann
2, S. 274). » M e i n Stern« entstand auf G u t Maxen bei
Dresden, wohin die Schumanns sich im Juni 1846 zur Erholung zurückgezogen hatten. M i t den Eigentümern des als kulturellem Treffpunkt beliebten Herrenhauses, M a j o r Friedrich Anton Serre und seiner Frau Friederike, war Clara Schumann schon als Mädchen befreundet. Sie komponierte dort zwei Lieder nach Texten von Friederike Serre. Während »Beim Abschied«, das 1992 erstmals publiziert wurde, als einfaches Strophenlied konzipiert ist, entwarf die Komponistin für das romantische Gedicht »Mein Stern« eine beschwingte Grundfläche im Klavier, die die variierten Strophen trägt. Vermutlich als Vorbereitung auf ihre geplante Englandtournee steuerte Clara Schumann das Lied »Mein Stern« für ein im Londoner Verlag Wessel 8c C o . gedrucktes Benefizalbum bei. D o r t erschien es 1848 in deutscher und englischer Fassung. Jetzt, im Juni 1853, wählte sie sechs Gedichte aus dem R o m a n Jucunde von H e r m a n n Rollett aus. D i e Schumanns lasen den im bukolischen A m biente spielenden R o m a n über Weihnachten 1852 ( T b 3, S. 612). D i e bei Rollett den Protagonisten Jucunde und Brunold zugeordneten Gedichte ( D r a h e i m / H ö f t 1 9 9 2 , 2 , S. 7) hebt Clara Schumann aus dem Kontext heraus und bearbeitet die Vorlagen zu Naturlyrik mit allgemeiner Aussage. Sowohl in ihrer Textwahl als auch in den Vertonungen schwingt eine optimistische Frühlingsstimmung mit. W i e in den Variationen op. 20 fokussiert sich auch in den Sechs Liedern aus Jucunde von Hermann Rollett op. 23 die Arbeit auf eine Verfeinerung im Detail. Alle sechs sind als variierte Strophenlieder angelegt. D o c h emanzipiert sich die Komponistin von den formalen Vorlagen der Lyrik. Außerdem entwirft sie eine weitgehend versunabhängige musikalische Rhythmik und Metrik. Trotz oder gerade wegen ihrer Kürze sind die Lieder musikalisch anspruchsvoll und erfordern professionelle Ausfuhrende. D a s erste L i e d (op. 23 Nr. 1) in A - D u r besticht durch einen frischen postromantischen Dialog. D e r Dichter verkehrt hier die Topoi romantischen Weltschmerzes in optimistische Aufbruchsstimmung. »Was weinst du, Blümlein, im Morgenschein? / . . . / Ich weine nicht,/ die Freudenträne durch's
Werke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
269
Aug' mir bricht«. Darauf reagiert die Komponistin mit aufhellenden Harmonien und einem sich vom Vers lösenden, eigenen belebten Rhythmus. Im zweiten Lied (op. 23 Nr. 2) entfaltet die Komponistin einen das Sonnenflimmern des Textes reflektierenden bewegten Sextolengrund. Kühn enden die Klavierfiguren auf arpeggierten Septakkorden, und sie schreiten auf kurzer Strecke vom Grundton F-Dur weit in mediantische Regionen aus. Anstelle des Unheimlichen wandelt der Dichter im dritten Lied (op. 23 Nr. 3) den Wald zur geheimnisvollen Naturkathedrale um. Die zwischen der Dreiergliederung im Gesang und der Zweiergliederung des Klaviers entstehenden Schwebungen charakterisieren die Stimmung. Langsam und sehr leise erklingt über absteigenden Dreiklangsfiguren hier tatsächlich einmal eine durch charakteristische Untersekundvorhalte an den »Schumann-Ton« erinnernde Melodie, deren Geheimnis musikalisch darin liegt, dass sie zwischen DesDur und b-Moll changiert. Ein berückendes Vor- und Nachspiel evoziert das weihevolle Ambiente. Die Lieder vier und fünf hängen inhaltlich zusammen. Dramaturgisch bildet das langsame vierte (op. 23 Nr. 4) in a-Moll einen Übergang von der erhabenen Waldatmosphäre zum fröhlichen Vogelgesang im fünften Lied (op. 23 Nr. 5). Charakteristisch für die positive Stimmung sind aufspringende Sexten in der Melodie. Darüber hinaus besticht das Lied durch seine differenzierte Faktur. Hier strukturiert die strophische Gliederung zwar das formale Gerüst. Im Vordergrund reagiert die Musik aber auf die einzelnen im Text auftretenden Vogelstimmen. So wechselt die Singstimme im Dialog mit dem Klavier zeilenweise den Sprachduktus. In Nummer sechs (op. 23 Nr. 6) ist das zugrunde liegende Gedicht formal durch die Wiederholung der Anfangsverse (»O Lust, o Lust, vom Berg ein Lied / Ins Land hinab zu singen«) am Ende der vierten Strophe geschlossen. Clara Schumann verstärkt diese Vorgabe durch das stürmisch bewegte Vor- und Nachspiel. Hermann Rollett, der 1848 ein Republicanisches Liederbuch herausgegeben hatte und in Wien an der Revolution beteiligt war, lebte als Flüchtling in der Schweiz (Geck 1989, S. 35). Dort las er in einer Zeitungsnotiz über die Lieder und bedankte sich daraufhin bei Robert Schumann. Der stellte umgehend klar, dass es sich um ein eheliches »Mißverständnis« handele. »Meine Frau hat sechs Lieder aus Ihrer Jucunde componirt, die mir, auch wenn sie nicht von meiner Frau wären, recht wohl gefallen würden« (in: Draheim/ Höft 1990,1, S. 7). Zu diesem Zeitpunkt, am 7. Februar 1854, waren die Lieder noch nicht gedruckt. Sie erschienen erst im Januar 1856. Mit Recht vermuten Draheim und Höft, dass Clara Schumann aufgrund der nachfolgenden Ereignisse erst einmal anderes im Kopf hatte, als diese lebenszugewandte 270
Paar-Konzepte
Frühlingslyrik zu veröffentlichen. Die Komponistin widmete die Lieder der Sopranistin Livia Frege. Das empfundene Glück bei der Komposition der in nur zehn Tagen entstandenen Lieder schlug auch im Tagebuch durch: »Es geht doch nichts über das Selbstproduzieren, und wäre es nur, daß man es täte, um diese Stunden des Selbstvergessens, wo man nur noch in Tonen atmet« (in: Litzmann 2, S. 274). Im euphorischen Schwung folgten noch im Juni 1853 die Komposition von Drei Romanzen für das Pianoforte op. 21 und Anfang Juli Drei Romanzen für Pianoforte und Violine op. 22. Letztere wurden offensichtlich inspiriert durch das Spiel von Joseph Joachim. Die Schumanns hatten Joachim schon im November 1845 kennen gelernt, als der damals Vierzehnjährige mit Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert e-Moll op. 64 Furore machte. Im Mai 1853 traten beide, Clara Schumann und Joachim, in einem so genannten »Künstlerkonzert« auf, sie mit dem Klavierkonzert a-Moll op. 54 ihres Mannes, er mit Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61. »Haben wir andern auch wohl Beifall gehabt«, schrieb Clara Schumann, die sogar mit einem Lorbeerkranz geehrt worden war, »so errang doch Joachim mit dem Beethovenschen Konzert den Sieg über uns alle«. Er habe »wirklich idealisch« gespielt. Gleich am nächsten Tag probte Clara Schumann mit Joachim im Salon des Klavierfabrikanten Klems Robert Schumanns Violinsonate a-Moll op. 105. Die Schumanns nahmen den 22jährigen »liebenswürdigen, echt bescheidenen Menschen« in ihren engeren Freundeskreis auf (in: Litzmann 2, S. 278). Er erhielt die Drei Romanzen für Pianoforte und Violine op. 22 mit der Widmung »Dem erhabenen Musiker und Freund Joseph Joachim«. Zwei Voraussetzungen bestimmen die Komposition von Violinromanzen, nämlich die traditionelle Erwartung einer dominierenden Violinkantilene und die immer wieder neu zu entscheidende Herausforderung nach dem Verhältnis der beiden unterschiedlichen Klangkörper. Clara Schumann bietet in ihren Violinromanzen drei verschiedene Konzepte. Dem einfachen, liedhaften Modell von Melodie und Begleitung entspricht am ehesten die dritte Romanze in B-Dur op. 22 Nr. 3. Hier spinnt die Violine tatsächlich ein gleichsam zäsurloses, kantilenenhaftes Thema aus, während der Klavierpart ein einheitliches Begleitmuster beisteuert, das seine Artikulationsweise variiert. Dem Rezensenten der Neuen Berliner Musikzeitung, der drei Salonstücke erwartet hatte, gefiel dieses am besten, da es »sich in besonders lebendigem Aufschwung des Affectes bewegt« (1856, S. 218). Dagegen besticht die stimmungsvolle erste Romanze in Des-Dur op. 22 Nr. 1 durch ein stetes Ineinandergreifen beider Klangpartner, die gemeinsam, von einer gleichen Kernformel ausgehend, unterschiedliche motivische VariWerke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
271
anten bilden. Ein aus den Mittelstimmen des Klaviers geheimnisvoll aufsteigendes, chromatisch gefärbtes Gebilde wird von der Violine weitergesponnen. Dass es metrisch zwischen den begleitenden Fundamentakkorden zu schweben scheint und im Durchgang pikante Dissonanzen erzeugt, erhöht seinen Reiz noch. Aufgrund der Offenheit des Gebildes können in der Violine jeweils neue Fortspinnungsvarianten entfaltet werden. Im Vergleich zur dritten Romanze fällt hier die Vielschichtigkeit der Satzfaktur auf. Keines der beiden Instrumente funktioniert ausschließlich als Exponent der Melodie oder der Begleitung. Vielmehr überlagern sich die Stimmen und ihre Rollen wechselseitig, so dass kaum eine Hierarchie unter ihnen auszumachen ist. Diese Selbständigkeit der Klangpartner charakterisiert auch die zweite Romanze in g-Moll op. 22 Nr. 2. Formal wie die dritte in symmetrischer Liedform organisiert, beginnt auch die zweite mit dem Vortrag des Themas in der Violine. Doch dann werden einzelne Motive heraus gelöst, variiert und selbständig von beiden Instrumenten weitergeführt. Diese Verteilung wird möglich, da das Thema selbst nicht kantilenenhaft geschlossen, sondern offen, aus sich wiederholenden Phrasen angelegt ist, die dann bruchlos auf beide Klangpartner verteilt werden. Im Verlauf des Stücks erfolgt eine zunehmende Verdichtung vom homophonen Beginn bis zu einem polyphonen Gewebe am Anfang der Reprise, das durch eine eintaktig verschobene Imitation zwischen Violine und Klaviersopran entsteht. Zum Eindruck von Verdichtung trägt außerdem der schwebende Charakter des Themas mit seiner synkopischen Uberbindung bei. Mit einer derartigen strukturellen Dichte auf so kleinem Raum hat sich die Komposition tatsächlich weit von einer üblichen, melodiebeseelten Romanzentradition entfernt. Trotz ihrer konventionell wirkenden Oberfläche zeigen die Stücke den ambitionierten Zug, in die allgemein beliebte Gattung eine anspruchsvolle musikalische Faktur einzukomponieren, die dort gewöhnlich keine Rolle spielt. Das Modell Melodie und Begleitung bedienen schon die Drei Romanzen fiir das Pianoforte op. 21 nicht, die ebenfalls im Frühsommer 1853 konzipiert wurden. In der F-Dur-Romanze op. 21 Nr. 2 wandert ein kleines melodisches Segment durch wechselnde Stimmlagen. Ein von Pausen durchbrochenes, getupftes rhythmisches Grundmodell in beiden Händen sowie die klare periodische Gliederung geben dem Stück einen scherzohaften Charakter. Neben dem graziösen Rhythmus reizt vor allem die durch Verkürzungen und Nebennoten dissonant geschärfte Harmonik. Sie spielt auch in der dritten Romanze g-Moll op. 21 Nr. 3 eine Rolle. Ein durchlaufendes rasches Sechzehntelband evoziert hier einen Perpetuum-mobile-Effekt. Das Stück cha-
272
Paar-Konzepte
rakterisiert ein Moment von innerer Unruhe, die erst am Schluss eingefangen wird. Metrische Uberlagerungen, Folgen von unaufgelösten Dissonanzen sowie tonale Ambivalenzen gehören insgesamt zu den bemerkenswerten Ausdrucksmitteln dieser Stücke. Mit dem Entwurf der ersten Romanze in a-Moll (WoO) war die Komponistin offenbar nicht ganz zufrieden. Ein erhaltenes Autograph vom 23. Juni 1853 weist zahlreiche Korrekturen auf. Sie kennzeichnen möglicherweise Stellen, die noch einmal überarbeitet werden sollten. Eine Abschrift (ohne Einarbeitung der Korrekturen) schenkte Clara Schumann ihrer Freundin Rosalie Leser im Juli 1853. Sie wurde 1987 veröffentlicht. Zuvor war 1891 schon eine Fassung als Beilage der englischen Zeitschrift The Gir/'s Own Paper erschienen, von der unklar ist, wie sie dort hinein kam (Reich 1991, S. 405). Ihr leises, inniges, terzstrukturiertes Thema wird von bordunhaften Liegestimmen getragen. Erst in dem nach Dur gewendeten Mittelteil kommt durch ein laufendes Triolenband in Tenorlage ein flüssigeres Bewegungselement hinzu. Auffällig sind die besonderen metrischen Überlagerungen und der angesichts des zarten Charakters ungewöhnliche vier- bis sechsstimmige Tonsatz, wie man ihn später von Brahms gewohnt ist. Den allerdings kannte Clara Schumann zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dagegen zeigt das knapp zwei Jahre später neu komponierte und dann als op. 21 Nr. 1 zusammen mit den beiden anderen Romanzen bei Breitkopf Sc Härtel publizierte Stück, dass sie 1855 bereits einen inneren musikalischen Dialog mit Brahms begonnen hatte. Die spätere a-Moll-Romanze op. 21 Nr. 1 entstand 1855 in Köln. Ein Geschenk für Brahms. Clara Schumann war mit ihm dort, um Beethovens Missa solemnis zu hören. Am nächsten Tag besichtigten sie die Dom-Baustelle. Beides verschmolz zu einem tiefgreifenden Erlebnis. Anschließend fuhr Brahms weiter nach Endenich. Während Clara Schumann in Köln auf ihn (und hoffnungsvolle Nachrichten über ihren Mann) wartete, arbeitete sie an dem Stück, das möglicherweise für Brahms' Geburtstag am 7. Mai gedacht war. Dann allerdings erschien ihr die Romanze »zu traurig in der Stimmung« für diesen Anlass, »ich war's so sehr, als ich sie schrieb« (in: Litzmann 2, S. 370). Das auf Schmuckpapier kopierte Widmungsexemplar trägt die Inschrift: »Meinem lieben Freunde Johannes componirt d. 2ten April 55«. Eine zweite Abschrift widmete Clara Schumann »dem geliebten Manne zum 8ten Juni«. Sie hatte Brahms möglicherweise im Gepäck, als er Schumann ein weiteres Mal im Juni, zu dessen Geburtstag, besuchen wollte. Nun ging es dem Patienten jedoch so schlecht, dass Brahms unverrichteter Dinge zurückreisen musste (Endenich, S. 296ff). Brahms wurde dann das gedruckte Werke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
273
Heft ihrer Romanzen op. 21 zugeeignet, und er führte die ihm zugedachte Romanze op. 21 Nr. 1 auch am 29. Mai 1855 in einem Konzert von Julius Stockhausen in Köln öffentlich auf (in: Schumann-Brahms 1, S. 189). Die Romanze op. 21 Nr. 1 gleicht dem ursprünglichen Stück zwar in der dreiteiligen Form, doch unterscheidet sie sich wesentlich durch den ernsteren Ton und eine andere Faktur. Anstatt nach A- moduliert der Mittelteil nach F-Dur. Beibehalten wird die Austerzung der Oberstimme, nicht aber deren ursprüngliche, auftaktige Gestalt. Im neuen Stück bleibt das Thema weitgehend statisch, wie in sich kreisend. Außerdem steigert sich die Akkordfülle noch einmal auffällig. Mit dem verbreiternden, argpeggierenden Vortrag der zu Dezimen aufgespreizten Klänge wirkt der Tonsatz orchestral. Ohne wirklich greifbar zu sein, meint man, die Erfahrung der Komponistin mit dem Klaviers atz von Brahms'fis-Moll-Sonate op. 2, die Clara Schumann gewidmet ist, und dem düsteren Ton der ersten Ballade op. 10 Nr. 1 (»Edward«) herauszuhören, die Brahms 1854 komponierte. Allerdings gehörte ein vollgriffiger Tonsatz schon vorher zu Clara Schumanns charakteristischer Tonsprache, die sie bei Brahms dann als »seelenverwandt« erlebt haben mochte. Der Klangraum ist weiter gespannt als im »Vorläufer«-Stück und auch dunkler. Die tiefen Register des Basses, der Abwärtszug der Melodie, ihr verhaltener Ton sowie die Häufung dissonanter Reibungen verstärken den melancholischen Charakter wesentlich mehr als im ursprünglichen Stück. Neu ist auch der bewegte Mittelteil, in dem über einem orgelpunktartigen Bass drei rhythmische Schichten verflochten werden. Vierer- und Fünfermetren reiben sich im Sopran und seiner Gegenstimme im Tenor, während im Alt ein gleich bleibendes Band aus Achteltriolen den Satz vorantreibt. Damit alles organisch im Fluss bleibt, komponiert Clara Schumann auch hier explizite Ubergänge zwischen den Partien. Angesichts der Ausweitung ihrer Tonsprache, wie sie sich hier andeutet, muss man umso mehr bedauern, dass Clara Schumann sich entschied, ihre schöpferischen Potentiale nach 1856 zu begraben. Als letztes Stück entwarf sie in jenem Jahr eine weitere Romanze in h-Moll (WoO). Die Reinschrift ist »Weihnachten 1856« datiert und enthält am Ende die Worte »Liebendes Gedenken! Clara«. Vermutlich handelt es sich um ein Geschenk für Brahms, der die Weihnachtstage in Düsseldorf verbracht hatte. In den erhaltenen Dokumenten finden sich aber keine genaueren Hinweise. Verglichen mit den Romanzen op. 21 entspricht der polyphone Tonsatz mit den chromatisch absteigenden Linien eher dem von Bachs Wohltemperiertem Klavier. Die verhaltene melancholische Stimmung scheint indessen wenig zum Weihnachtsfest zu passen. Es bleibt offen, was Clara Schumann tatsächlich mit diesem Stück 274
Paar-Konzepte
vorhatte. Heute befindet sich das Autograph der h-Moll-Romanze in der Osterreichischen Nationalbibliothek in Wien. Das Stück wurde 1977 publiziert. Abgesehen von einem »Hochzeitsmarsch«, den Clara Schumann als Geschenk fur das Ehepaar Hübner 1879 aufschrieb mit dem Vermerk »nicht so zu drucken, soll noch anders werden« (Reich 1991, S. 408), sind keine Komposition aus späterer Zeit bekannt. Brahms gab sich viel Mühe, die Komponistin wieder hervorzulocken und in einen musikalischen Dialog einzuspinnen. Er versuchte es mit gemeinsamen Kontrapunktstudien, in die teilweise auch Joachim und Grimm einbezogen waren, schickte ihr Fugen zum Austausch und forderte Gegenstücke. Es gelang ihm nicht. Clara Schumann blieb bei ihrem Entschluss. Als Anekdote überlieferte Eugenie Schumann Brahms' Streich von 1878, ihrer Mutter auf deren eigenem Notenpapier aus der Mädchenzeit einige Fragmente unterzujubeln und sie zu bitten, die Stücke zu rekonstruieren. Doch die bemerkte spontan: »Das ist nicht von mir, - da muß jemand mein Papier gebraucht haben, um etwas aufzuschreiben«. Immerhin war sie bereit, sich mit den Noten zu befassen und tippte auf Schumann. »Es könnte von Papa sein, stellenweise auch von Brahms« (in: E. Schumann, S. 259). Die Finte misslang. Eugenie Schumann vermutete, dass es sich um eines von Brahms' acht Klavierstücken op. 76 handelte, die ein Jahr später publiziert wurden. Aber es blieb dabei: Nachdem Clara Schumann bei der Neuorientierung ihres Lebens 1856 beschlossen hatte, alle ihre Kräfte auf das Konzertieren zu fokussieren, verstummte die Komponistin tatsächlich. Ihre eigenen Stücke setzte die Virtuosin nur wohldosiert ins Programm, darunter das Scherzo op. 14, das Klaviertrio op. 17, die Variationen op. 20, eine der Romanzen op. 21, vermutlich die erste, und verschiedene Lieder. Außerdem musizierte sie mit Joachim gelegentlich ihre ihm gewidmeten Violinromanzen op. 22. So orderte sie im Februar 1859 bei Breitkopf Sc Härtel aus ihrem eigenen Œuvre »umgehend für meine Rechnung per Post: 4 Exemplare Romanzen f. Klavier [op. 21], 2 desgl Romanzen für Ciavier und Violine [op. 22], 2 desgl Lieder (der Frege gewidmet) [op. 23] - von mir« (Steegmann 1997, S. 179). Für ihre Werke erhielt sie unterschiedliche Resonanz (Klassen 1990). Doch erkannte man gerade die in den 1840er und Anfang der 50er Jahre entworfenen Komposition allgemein als beeindruckende Zeugnisse einer umfassenden musikalischen Kompetenz an. Ihre »respektable[n] Kompositionen« zeigten, dass »sie auch im Tonsatz geschult« sei, so Hugo Riemann 1882 (S. 838).
Werke aus der Dresdner und der Düsseldorfer Zeit
275
Herr Kirchner und Johannes Beziehungsfragen Brahms begleitete Clara Schumann, als sie am Abend des 27. Juli 1856 ihren sterbenden Mann wiedersah. Später berichtete er Julius Otto Grimm darüber. »Er lag erst länger mit geschlossenen Augen, und sie kniete vor ihm, mit mehr Ruhe, als man es möglich glauben sollte [...]. Er verweigerte schon öfters den gereichten Wein, von ihrem Finger sog er ihn mehrmals begierig und lange ein und so heiß, daß man bestimmt wußte, er kannte den Finger« (in: Barth 1974, S. 45). Es gibt Bilder, die bekommen einer jungen Liebe schlecht. Die »Aufopferung von seiten der jungen Musiker« für ihre Tochter hatte Mariane Bargiel schon im März 1854 gerührt registriert (in: Endenich, S. 74). Brahms, Joachim, Grimm und Dietrich mochten sich vorgekommen sein, wie Ritter aus König Artus'Tafelrunde. »1854er«, so nannte Brahms sich und die Freunde, die Clara Schumann seitdem unterstützten. Sprachen sie vom »Hohen Paar«, von »Ihr«, der »viel schöne[n], hohe[n] Fraue«, und von »Ihm«, dem »Sir«, so nahmen ihre Briefe aus diesen Jahren einen hymnischen Tonfall an. Ihre Schwärmerei ging so weit, dass sie sogar des Verlobungstags der Schumanns gedachten (in: Barth 1974, S. 3 0 f J o a c h i m 1, S. 99). Johannes, der Lieblingsknappe, war der Primus inter Pares. Die Schumanns waren gleich vom ersten Zusammentreffen am 1. Oktober 1853 an entzückt über den schüchternen Zwanzigjährigen, der mit seiner hohen Stimme ihnen einerseits so engelhaft jung erschien, als hätte er kaum mutiert, sie andererseits aber mit seinen ungeschliffen genialen, »feurigen« Kompositionen zutiefst beeindruckte. »Er spielte uns Sonaten, Scherzos ect. von sich, alles voll überschwänglicher Phantasie, Innigkeit der Empfindung und meisterhaft in der Form«, so Clara Schumann. »Es ist wirklich rührend, wenn man diesen Menschen am Klavier sieht mit seinem interessanten jugendlichen Gesichte, das sich beim Spielen ganz verklärt, seine schöne Hand, die mit der größten Leichtigkeit die größten Schwierigkeiten besiegt (seine Sachen sind sehr schwer), und dazu nun diese merkwürdigen Kompositionen« (in: Litzmann 2, S. 281). In Hamburg 1850 hatten die Schumanns Brahms im Besucherstrom übersehen und seine Lieder ungeöffnet zurückgegeben. Jetzt beschloss man, das junge Genie mit allen Mitteln zu fördern. In Hauskonzerten, teils gemeinsam mit Joachim, musizierte Clara Schumann die neuesten Stücke ihres Mannes, Brahms spielte sein Scherzo es-Moll op. 4, stellte seine frühen Sonaten und weitere heute verlorene Entwürfe vor. Robert Schumann verwandte sich für 276
Paar-Konzepte
den Druck der Kompositionen Opus 1 bis 6, die dann unvorstellbar rasch tatsächlich zwischen Dezember 1853 und Februar 1854 erschienen, und veröffentlichte den programmatischen Artikel Neue Bahnen, mit dem er den jungen Kollegen der Fachwelt als kommenden Meteoriten ankündigte. Im Kreis jüngerer Talente wie Joseph Joachim, Woldemar Bargiel, Theodor Kirchner, Julius Schäffer oder Albert Dietrich träte er bereits »aus dunkler Stille« vollendet hervor (in: GS 2, S. 301f). »Ihr Lob hat mich froh und kräftig gemacht«, behauptete Brahms tapfer (in: Brahms, Briefivechsel 1, S. 8). Es bedeutete eine gewaltige Hypothek. Dieser »junge Held des Tages, dieser von Schumann verheißene Messias [...] Man hatte so große Lust, ihn wegen Schumanns Weissagung lächerlich zu finden«, setzte Hedwig von Salomon dagegen (Uber Brahms 1997, S. 18f). Für Brahms, der im Mai 1853 gerade erst begonnen hatte, sich auf einer Deutschlandtournee als Pianist und Komponist bekannt zu machen, sollte die Begegnung mit den Schumanns einschneidend werden. Bei den Schumanns lernte er nicht nur den Alltag eines der Kunst gewidmeten Lebens, sondern auch das Modell einer Künstlerpartnerschaft aus der Nähe kennen. Die Schumanns führten ihn in die Düsseldorfer Kunstszene ein. Sie wurde um 1850 hauptsächlich durch die Akademie und deren Professoren geprägt und galt in diesen Jahren als eine der fortschrittlichsten Deutschlands. Dort wirkten Wilhelm Schadow, Carl Ferdinand Sohn und Wilhelm Schirmer, die Lehrer Anselm Feuerbachs und Arnold Böcklins. Robert Schumann öffnete dem wissbegierigen Brahms seine musikalische und literarische Bibliothek. »Abends Brahms bei uns. Ihm Gedichte vorgelesen« {Tb 3, S. 638). Schumann schenkte ihm einen Abzug von Rietschels Doppelporträt mit der Widmung »An Johannes Brahms von einem Paar, das ihm herzlich zugethan ist. Robert und Clara«. Er spielte mit ihm Schach, und Brahms, der aus bescheideneren Verhältnissen kam als die Schumanns und als schüchtern galt, übernahm von seinem Mentor bürgerliche Rituale und begann zu rauchen. Er hätte sich eine Pfeife gekauft und sie mit Joachim eingeweiht, schrieb er Clara Schumann im Februar 1856. »Uns wurde beiden sehr schlimm!« (Schumann-Brahms 1, S. 174). Anfangs schien Brahms die ungewohnte Umgebung indessen in Verlegenheit zu setzen. Noch die Art, mit der sich Eugenie Schumann amüsiert an seine »bunten Hemden«, die »zu kurzen Beinkleider« und einen offenbar jahrein jahraus getragenen schwarzen Janker erinnerte, lässt die Peinlichkeitsfallen für den Gast ahnen, dem es nie gelungen sei, seine Serviette nach Art des Hauses zu falten (E. Schumann, S. 191 und 244). Auch Anne Vorwerk, die eine Zeitlang bei Brahms Unterricht hatte, berichtete, wie indigniert ihre
Beziehungsfragen
277
Familie über Brahms' sehr schlichtes Äußeres war. Er trug »nur eine stählerne Uhrkette«! Hier gab sich der junge Künstler allerdings souverän. Eine Kette aus Stahl, wie sie Clara Schumann Joachim geschenkt hatte, war sein ausdrücklicher Wunsch gewesen {Über Brahms 1997, S. 33). »Ich nenne ihn nur dem Robert seinen Johannes« (in: Litzmann 2, S. 282). Dass die Schumanns ihn offenbar schon ab 10. Oktober 1853 beim Vornamen nannten, erhöhte die Auszeichnung. Umgekehrt galt das selbstverständlich nicht. Damit ist zugleich das Gefälle zwischen dem »hohen Paar« und dem sohnesgleich in die Familie aufgenommenen jungen Künstler beschrieben. Ab März 1854 war Brahms, wo es ging, zur Stelle. Zunächst wohnte er am Schadowplatz, doch im Dezember 1854 richtete Clara Schumann ihm ein Zimmer ein, das er sich zeitweilig mit Joachim teilte (R. Hofmann 1984, S. 47). Auch beim Umzug in die Poststraße, im August 1855, erhielt er eine feste Bleibe bei den Schumanns. Brahms suchte und fand immer mehr Aufgaben, die ihn unentbehrlich machen sollten. So oft und so viel er konnte, musizierte er mit Clara Schumann zusammen. Anfangs störte sie allerdings, dass er »so willkürlich« spielte (in: Litzmann 2, S. 310). Er beschäftigte sich intensiv mit den Kindern, tobte mit den Knaben und vermachte ihnen eine Reihe von Zinnsoldaten, mit denen er selbst noch sehr gern spielte, machte Ausflüge und überwachte die Schularbeiten. Zur Belustigung der Kleinen turnte er übermütig auf dem Treppengeländer herum. Die dreizehnjährige Marie Schumann bedachte Brahms mit einem Poesiealbum für ihre Gedichte, und er versprach dem kleinen »Genchen« (Eugenie), es später zu heiraten. Und Ludwig, Mamas »Posaunenengel«, flüchtete schon mal in Johannes' Bett. Den Mädchen half Brahms bei der Einstudierung von Schumanns Bilder aus dem Osten op. 66 als Geburtstagsüberraschung für die Mama, und die traurige kurz vor der Niederkunft stehende Künstlerin versuchte er am 8. Juni 1854, Schumanns Geburtstag, mit einem ganzen Heft arrangierter Volksweisen aufzuheitern, darunter auch einige der später separat veröffentlichten Ungarischen Tänze. Auf den einsamen Spaziergängen, in denen Clara Schumann sich in einen inneren Dialog mit ihrem abwesenden Mann hineinbegab, besetzte Brahms mitunter die Leerstelle neben ihr, begleitete sie mit verständnisvollem Schweigen und hörte ihren Liebesklagen, Hoffnungen und Verzweiflungen zu (SchumannBrahms passim; E. Schumann, S. 238ff.; Litzmann 2, S. 310ff). Clara Schumann überließ dem einfühlsamen Gefährten weitgehend bedenkenlos eine Fülle von Aufgaben. Brahms führte von März bis Dezember 1854 Schumanns Haushaltsbuch weiter. Außerdem agierte er als Vermittler zwischen Schumann und der Welt draußen. Als einer der wenigen Vertrau278
Paar-Konzepte
ten hatte er Zugang zum Patienten, übermittelte dessen Wünsche und half, Schumanns Briefe sowie (gefilterte) Nachrichten der Arzte im Freundeskreis zu verbreiten. Brahms erlebte die psychophysische Auflösung Robert Schumanns hautnah, ohne sich bei Clara Schumann von den erlebten Schocks entlasten zu können. Nur gelegentlich schien ihr in den Sinn zu kommen, dass sie dem jugendlichen »Trostes-Engel« vielleicht viel zuviel zumutete (in: Litzmann 2, S. 353). Seine »éducation sentimentale« ging hier durch eine heftige Lebensschule. So schrieb der Mozart-Biograf Otto Jahn im April 1856 besorgt an Hermann Härtel: Es »tut mir weh, daß er [Brahms] in den Jahren, wo er sich frei und in mancherlei Berührung mit der Außenwelt entwickeln sollte, in diese traurigen und nicht natürlichen Verhältnisse dermaßen eingesponnen ist, daß er nicht herauskommt und wie ich furchte sein Lebenlang den Druck nicht verwinden wird« {Uber Brahms 1997, S. 26f). Obwohl Clara Schumann ihm im Frühjahr 1856 das »Du« angeboten hatte, traute Brahms sich zunächst nicht, davon Gebrauch zu machen. Es war eine sehr seltene Auszeichnung, die sie nicht einmal Joseph Joachim gewährte. »Ich dachte, ich wollte doch nicht Deine augenblickliche Güte und Liebe benutzen, es möchte Dir später nicht recht sein. Deshalb schreibe ich auch immer noch per Sie«. Nachdem sie diese Zweifel zerstreut hatte, wagte er gleich mehr. »Meine geliebte Clara, ich möchte, ich könnte Dir so zärtlich schreiben, wie ich Dich liebe, und so viel Liebes und Gutes tun, wie ich Dir's wünsche. Du bist mir so unendlich lieb, daß ich es gar nicht sagen kann.« Auch wenn man davon ausgehen muss, dass die überschwängliche Briefrhetorik der damaligen Zeit noch nicht auf entsprechende Umgangsformen im Alltag schließen lässt, so sprach Brahms doch ganz offen seine rührenden Fantasien aus: »Könnte ich doch mit Dir und meinen Eltern immer in einer Stadt leben! Wie oft wünsche ich mir das« (Schumann-Brahms 1, S. 187f). Brahms saß in der Zwickmühle. Als königstreuer Ritter, der die Herrin beschützen wollte, konnte er nicht wünschen, was er sich wünschte. »Der ist ein Mann geworden über Nacht / Und blieb ein Kind dabei. Wie lieb ich das! / Zu jung zum Bruder und zu alt zum Sohn.« Diese Verse des Königs über seinen Stellvertreter Golo aus Hebbels Libretto für die Oper Genoveva op. 81 hatte Schumann einst gestrichen. Nun beherbergte er so einen Getreuen am eigenen Klavier, 14 Jahre jünger als seine Frau, acht Jahre älter als ihre Tochter Marie. In Schumanns Oper führt ein innig gesungenes Duett zwischen dem zum Schutz der Königin bestellten Ritter und ihr in die Katastrophe. Schumann erinnerte seine Frau in einem Brief vom 10. Oktober 1854 daran (in: Endenich, S. 155). Auch zwischen Clara Schumann und Brahms öffnete Beziehungsfragen
279
das gemeinsame Musizieren die Herzen. Doch anders als die Bühnenfigur Golo war Brahms fest entschlossen, die Situation im Hause Schumann nicht zu missbrauchen, sondern dem Gefühlsansturm ritterlich stand zu halten. Es spricht nicht gegen ihn, wenn das misslang. Clara Schumann war vor allem entlastet durch die »1854er«, die sie nicht nur musikalisch aufmunterten, sondern auch ein gutes Stück Lebenslust und Unbekümmertheit in ihren bedrückenden Alltag brachten. Wie sehr sie selbst von Brahms' Liebe und seiner Anhänglichkeit eingenommen war, beschrieb sie während der Tourneen, die sie ab Oktober 1854 wieder antrat. »Daß die Trennung von Ihm, wenn ich auf Reisen bin, mir das Reisen sehr erschwert, überhaupt ich dann ein schweres Geschick in doppelter Wucht auf mir lasten fühle«, gestand sie etwa Emilie List. »Ich bin keine sanfte Dulderin, wie Du weißt, ach, ich klage oft denen, die mir lieb sind« (in: Wendler, S. 186). Brahms gehörte schon bald unverzichtbar zu ihrem Dasein. Solange Schumann lebte, blieb die Konstellation in einer Grauzone, in der jeder für sich die Nähe des anderen genießen konnte, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben. Wie dieses Verhältnis tatsächlich aussah, lässt sich von heute aus nicht mehr erschließen. Die erhaltenen Briefe dieser Jahre - offenbar nur eine knappe Auswahl des ursprünglichen Bestands - sind fast alle von Brahms. Seine Zuneigung artikulierte er eindeutig. Brahms dürfte Clara Schumann jene reine, unbedingte Liebe entgegen gebracht haben, wie die jungen Protagonisten aus Balzacs Romanen ihren unerreichbaren vornehmen Damen (Fargeaud, in: Balzac 2004, S. 523). Da genügte ein freundliches Wort, ein Blick oder ein herzlicher Händedruck, um das liebende Herz in Hochstimmung zu versetzen. Die sublime Scheu, das anhaltende Glück, die »hohe Fraue« lieben und ihr dienen zu dürfen, ganz so, wie das ritterliche Minneideal in der romantischen Mittelalterrezeption gefeiert und die heilige Inbrunst, mit der eine Schmerzensmadonna angebetet wurde, das alles machte die moralische Überlegenheit dieses Gefühls aus. Clara Schumann war sich ihres Privilegs bewusst, denn schon damals galt Brahms als ungeschliffen und schwierig. Nach Joachim war er der »eingefleischteste Egoist«, bei dem alles »in unmittelbarster Genialität echt unbesorgt aus seiner sanguinischen Natur herausquillt - bisweilen aber mit einer Rücksichtslosigkeit [...], die verletzt« {Über Brahms 1997, S. 23f). Eine zeitgenössische Kalotypie zeigt einen schmalen, ernsthaften Einundzwanzigjährigen in abwehrender Haltung und mit verwundbarem Blick (Abb. 13). Ein tägliches Miteinander folgt indessen eigenen Regeln. Während Clara Schumann verzweifelt auf ein Zeichen ihres Mannes wartete, war Brahms 280
Paar-Konzepte
präsent und erneuerte das Versprechen seiner Hingabe allein durch die Anwesenheit, nicht bloß am Klavier. Er wollte sie kennen lernen, jedes Detail ihrer Geschichte wissen, forschte sie aus und eignete sich alles an, was er über das Paar erfahren konnte. Als Pianist und Komponist verfugte er über die gleichen Zaubermedien wie der abwesende König, und er setzte sie hemmungslos ein. Aus dieser Perspektive bedeuteten seine Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 9 fast schon einen Tabubruch. Indem er sich des gleichen Sujets annahm wie Clara Schumann in ihren Variationen op. 20, bekundete er seinen Anspruch auf einen Austausch. Er sponn seine Verschmelzungsfantasien, das Kommunizieren in einer gemeinsamen musikalischen Sprache, aus und griff damit direkt in die Schumannsche Partnerkommunikation ein. Dass er die lange Geschichte ihrer musikalischen Beziehung inzwischen kannte, zeigt seine Einfügung des Zitats aus Clara Wiecks Romance variée op. 3 in der Harmonisierung von Schumanns Impromptus op. 5, die erste öffentliche musikalische Verbindung der beiden. »Kleine Variationen von Ihm. Ihr zugeeignet«, lautete Brahms' vieldeutige Widmung auf dem Autograph. Auf Dauer würden die unschuldigen papiernen Küsse und Umarmung nicht mehr reichen. Im Düsseldorfer Alltag und auf den gemeinsamen Konzertfahrten fanden sich viele Situationen, einander nahe zu sein. Allerdings waren die Bedingungen eindeutig: Clara Schumann konnte er nicht für sich allein haben. Sie blieb ihrem Mann und ihrer Familie zugehörig. Alles, was sie mit Brahms an Besonderem teilte, war außerhalb dieser Konstellation angesiedelt, zumindest aus ihrer Sicht. Liest man die heute zur Verfügung stehenden Tagebucheinträge Clara Schumanns aus dieser Zeit, so dominieren dort die tiefe Verbundenheit mit ihrem Mann, die Hoffnung auf seine Genesung sowie die durch seine Krankheit ausgelösten eigenen Todesgedanken. Doch auch Brahms ist präsent. »Wie wünschte ich ihn an meiner Seite«, trug die Künsderin unter dem 23. Dezember 1855 in Wien ein. Wieder einmal hatte sie die Gräber von Schubert und Beethoven besucht und sowohl für das Blumenbuch ihres Mannes als auch für Brahms Efeublätter gepflückt (Litzmann 2, S. 401; Blumenbuch fiir Robert, S. 178ff). Noch in den übrig gebliebenen zensierten Brieffragmenten zwischen der Schumann und Brahms lässt sich der Wirrwarr der Gefühle spüren. Ins Gerede kam das Verhältnis schon vor Schumanns Tod. Es wurde genau registriert, dass vier »1854er« kamen und nur drei wieder gingen. »Für den Augenblick hast Du auch recht getan, dorthin zu gehen«, schrieb Christiane Brahms ihrem Sohn. »Aber dort zu bleiben?« (in: Reich 1991, S. 247). Immerhin hatte sich Clara Schumann 1854 noch gefragt, ob es ihr, da Brahms' Mutter bereits sehr alt war, womöglich einmal beschieden wäre,
Beziehungsfragen
281
»Mutterstelle an ihm zu vertreten« (in: Litzmann 2, S. 354). Davon konnte keine Rede mehr sein. Brahms war schon einmal Clara Schumann sehnsüchtig nach Holland nachgereist. Er wagte es kein zweites Mal, obwohl er mit dem Gedanken spielte, sie im Frühsommer 1856 in London zu besuchen, »aber es ist doch zu auffallend, wenn ich, ohne was zu tun zu haben, hinkomme« (Schumann-Brahms 1, S. 186). Welche Rolle Brahms nach Schumanns Tod 1856 in Clara Schumanns künftigem Leben tatsächlich zugedacht war, lässt sich kaum rekonstruieren. Er wohnte bereits in der Schumannschen Wohnung, die er erst nach dessen Tod verließ, und seine Präsenz war eine öffentliche Angelegenheit. Es wurde daher genau beobachtet, was dort vor sich ging. Umso bemerkenswerter erscheint, wie selbstbewusst Clara Schumann zu ihrem jungen Ritter stand. Die heute lesbaren Signale ergeben allerdings ein zwiespältiges Bild. Einerseits verleugnete sie ihre Begeisterung für Brahms nicht. Diese Sympathie teilte sie mit ihrem Mann, und sie verteidigte ihr Engagement vor der Kritik von Rosalie Leser oder Jenny Lind (Litzmann 2, S. 377). Andererseits vermied sie Verbindlichkeit. Die heute erhaltenen Dokumente zeigen, dass Clara Schumann sich an den täglichen Austausch mit Brahms und die immer wieder eingeholte Bestätigung liebender Sympathie nicht bloß gewöhnt hatte, sondern sie teilte, so dass sie später Spuren allzu großer Emphase zu tilgen versuchte. Nachdem sie Brahms im Oktober 1856 auf dem Bahnhof verabschiedet hatte, fühlte sie sich, »als kehrte ich von einem Begräbnis zurück« (in: Litzmann 3, S. 15). Auch das im November 1857 bis zum August 1859 bestückte Berliner Blumentagebuch für Brahms spricht eine eindeutige Sprache. Für ihre Zukunft traf Clara Schumann allerdings lauter Entscheidungen ohne ihn, mit einer Ausnahme. Als ihr die neu gegründete Stuttgarter Musikhochschule im Januar 1858 eine Stelle offerierte und man in Aussicht stellte, auch Joachim engagieren zu wollen, kreiste ihr ein »Chaos von Gedanken« im Kopf, und sie schmiedete Pläne für sich, Brahms und Joachim. Man könnte zu dritt dorthin übersiedeln, »wo ich mit Euch leben kann, wo Ihr mit Rath und That mir beisteht«. Auch in Hannover schien man geneigt, ein Konservatorium zu gründen, an dem zumindest Joachim und die Schumann, nicht aber Brahms arbeiten sollten. Die Pläne zerschlugen sich (Litzmann 3, S. 31;Joachim 1, S. 382f). Nicht wenige dürften ihr, wie der holländische Freund und Komponist Johann Joseph Hermann Verhulst, nach Schumanns Tod gewünscht haben: »Gott erhalte in Ihnen die Mutter« (in: Litzmann 3, S. 1). Aber Clara Schumann war keine »Lotte«, die darin aufgegangen wäre, dass eine Schar glücklicher Kinder sie umspränge. Dieses prominente Werther-Bild hatte offenbar auch Brahms im Kopf, als er sie immer wieder abmahnte, doch zu Hause zu 282
Paar-Konzepte
bleiben und auf ihre Konzertreisen zu verzichten. »Die Kinder, anstatt mir Trost zu sein, regen mich nur noch immer mehr auf«, notierte die Künstlerin dagegen im Tagebuch (in: Litzmann 2, S. 306). Sie wollte ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Tatsächlich musste viel Geld verdient werden, um den bisherigen Standard halten und jedem Kind eine gute Ausbildung ermöglichen zu können. So verteilte sie die sieben zwischen fünfzehn und zwei Jahre alten Kinder jeweils in passende Unterbringungen. Obwohl diese Erziehungsform in bürgerlichen Familien nicht ungewöhnlich war, fürchteten sich die Kinder begreiflicherweise davor. Nach Marie Schumanns Erinnerungen hätte ihr Vater in Endenich das Vorgehen nicht befürwortet (in: Kat., S. 221). Die beiden ältesten Mädchen blieben nach dem Tod ihres Vaters in Pension in Leipzig, Julie bei der Großmutter Bargiel in Berlin, Ludwig und Ferdinand, erst acht und sieben Jahre alt, lcamen in ein Internat. Bei den Söhnen wog nach Clara Schumanns Sicht der Vaterverlust schwerer als bei den Töchtern. Sie müssten »unter männliche Zucht kommen«, sonst würden »gar keine Jungen aus ihnen« (in: Litzmann 3, S. l l f ) . Die beiden Jüngsten standen weiterhin unter Obhut der Haushälterin in Düsseldorf. Nach ihrem Umzug nach Berlin im September 1857 zogen auch Marie, Elise, Eugenie und Felix ein, Ferdinand wechselte ans Joachimsthaler Gymnasium, Ludwig, der erste Lernschwierigkeiten zeigte, kam in die Obhut eines Pfarrhauses, Julie übernahm nun zeitweise Großvater Wieck in Dresden (Kirchner, S. 16f). Clara Schumann wollte als Alleinerziehende allen Vorwürfen eines Scheiterns ihrer Familiengründung zuvorkommen. An öffentlichen Karikaturen von Verse machenden, malenden oder musizierenden Frauen fehlte es nicht. Sie setzte sich selber stark unter Erfolgsdruck und verpflichtete ihre Kinder daher mit besonderer Strenge zur Disziplin. Selbst die am 30. Juli 1856 verfasste Todesnachricht an ihre beiden ältesten Töchter, damals fünfzehn und dreizehn Jahre alt, funktionierte sie zu einem Mahnschreiben um. »Möchtet Ihr, die er so innig liebte, solches Vaters würdig werden; möchtest namentlich Du, Elise, Dein Wesen ändern [...], bescheiden, freundlich, edel, wie er es in so hohem Grade war« (in: Endenich, S. 396). Dass Brahms als Ersatz für den derart idealisierten Vater infrage kommen könnte, wurde - soweit heute erkennbar - von Clara Schumann an keiner Stelle erwogen. Gegeneinander aufrechnen lassen sich die erkennbaren Alternativen, entweder zu Hause zu bleiben und die Familie im warmen Nest notdürftig zusammenzuhalten oder jedem Kind eine gute Ausbildung und Erziehung zukommen zu lassen und dementsprechend Geld zu verdienen, nicht. Neben den Kosten spielten hier offenbar noch andere, nicht abrechnungsfähige Faktoren eine Rolle. Zu den idealisierten Motiven dürfte das Berufsethos
Beziehungsfragen
283
und das Sendungsbewusstsein der Künstlerin gehört haben, zu den nur indirekt geäußerten der Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstermächtigung. Letzteres zählte offenbar zu Clara Schumanns Uberlebensstrategien. Schon vor der Hospitalisierung und dem Tod ihres Vaters waren die Kinder im Übrigen großzügig umverteilt worden, nicht nur während der Reisen der Eltern. Marie und Ludwig würden wohl am meisten darunter leiden, Elise und Julie am wenigsten, vermutete die Mutter 1850 (in: Brunner, S. 103). Clara Schumann erwies sich in ihren Privatangelegenheiten als weitgehend beratungsresistent. Zwar besprach sie sich immer wieder gerade in fachlichen Fragen mit kompetenten Partnern, doch in ihre Entscheidungen ließ sie sich nicht gern hineinreden und wies Tipps wie Hilfen zurück. Ihre Argumente blieben über die Jahre fast immer gleich. Benefiz-Konzerte für sich und ihre Familie lehnte sie ebenso ab wie Spenden. »Sie wissen, dass Gott mir ein Talent geschenkt, mit dem ich hoffen dürfte, meine Kinder durch die Welt zu bringen«, antwortete sie am 23. März 1854 auf ein entsprechendes Angebot von Hermann Härtel. Soll »ich nun unthätig zusehen, wenn Andere für mich und meine Kinder Concerte geben? wäre das meiner würdig? würde das im Sinne meines theuren Roberts sein? dieser Gedanke hat für mich etwas demüthigendes, und ich denke es würde dieß ein Verkennen des reichen Segens, den mir der Himmel in meiner Kunst verlieh, sein, eine Verletzung meiner Pflicht« (in: Steegmann 1997, S. 116f). Einen Ernährer suchte die Künstlerin nicht. Diesen Part wollte sie immer schon selbst ausfüllen. Mit Brahms hoffte sie offenbar auf eine als seelenverwandt empfundene Freundschaft - Liebe nicht ausgeschlossen. Doch hatte sie scheinbar nicht vor, erneut eine Ehe einzugehen und weitere Kinder zu haben. Dieses mit Schumann gelebte Ideal sollte einmalig bleiben und war unwiederholbar. Das heißt nicht, dass sie die Macht über das Herz ihres Ritters bereitwillig und widerstandslos abgegeben hätte. Schließlich gab es ein paar Augen, von denen man einfach angestrahlt werden wollte. Als Brahms im Sommer 1858 in Göttingen mit Agathe von Siebold liebäugelte, während die noch grünen »1854er« ausgerechnet Clara Schumann und ihre Kinder dazu einluden, endeten die Ferien im Patt. Danach verschwand zwar die Rede von der »Hohen Fraue« zwischen Grimm und Brahms. Doch ausgestanden war die Sache noch nicht. Clara Schumanns Briefe aus dieser Zeit wirken manchmal so, als hielte sie den Freund bei aller Liebe auf Abstand. Offenbar wollte sie die ihr so wertvolle Beziehung retten, ohne sich an ihn binden zu müssen. Brahms wünschte sich immer wieder, dass sie, die ihn als Künstler auf allen Gebieten so enthusias284
Paar-Konzepte
tisch forderte, doch wenigstens bei den Uraufführungen dabei wäre. Ob sie ihre Präsenz absichtlich zu vermeiden wusste, oder ob ihre Terminpläne tatsächlich so unglücklich lagen, dass sie die Ereignisse in Hamburg, Hannover, Detmold oder Leipzig versäumte, lässt sich nicht entscheiden. »Ich hatte in Leipzig bis zum Concerttag geglaubt, Du müsstest kommen. Ich war sehr enttäuscht« (Jb, 2. Februar 1859). Ich »werde selbst kommen und Dir mich aufdrängen« (Jb, 29. März 1859). »Es hat mir im tieffsten Herzen weh gethan, dass ich nicht dabei sein konnte« (CS, 31. März 1859). »Mir liegt vor allem Dein Kommen nach Detmold im Kopf [...] In der Zeit darfst Du nicht so beschränkt sein. Wir können ja nicht den ganzen Tag Musik machen« (Jb, 3. Juli 1859). »Du darffst [...] nicht fehlen« (17. Januar 1860). »Liebste, das darffst Du nicht versäumen [...] Ich bezahle die Reisekosten« (Jb, 9. Februar 1860). »Nun bitte ich Dich aber allen Ernstes und so herzlich, dringend wie möglich, komme den Sommer hierher«, nach Hamburg. »Telegraphire und ich komme Dir etwas entgegen. Gieb mir diesen Beweis Deiner Liebe und ich will Dir tausend dafür wieder geben« (Jb, 26. April 1860). Sie kam, und es war trotzdem nicht recht. Beziehungsstress zeichnet sich zwischen den Zeilen ab. Clara Schumann entschied, sich über die »schlimme Laune [von] Johannes wegzusetzen, und es gelang zuweilen« (Mai 1860, in: Litzmann 3, S. 77). Brahms schaffte es nur mit Ruppigkeit, sich aus der für ihn ausweglosen Verstrickung zu befreien. Dazu musste er sich nicht nur von der »Hohen Fraue«, sondern auch von der Förderin seiner Musik lösen. Nach anfänglicher Euphorie war er in eine lähmende Krise geraten, aus der er nur herauskommen konnte, wenn er sich räumlich wie musikalisch aus der Schumannschen Sphäre entfernte. So verbat er sich bald ihre Begeisterung für seine Musik und verletzte Clara Schumann damit tief. Anfangs hatte die Angebetete bloß erstaunt registriert, wie barsch und arrogant der lichte Engelsbote sein konnte. Inzwischen kränkte Clara Schumann die unwirsche Behandlung, und sie wehrte sich. »Wenn Du gar glaubst, ich wollte den meinen anderen aufdrängen, da verkennst Du mich sehr«, so verteidigte sie ihren Enthusiasmus. »Ich wollte, Du legtest meine Empfindungen edler aus, als Du es oft tust« (SchumannBrahms 1, S. 223). An dieser Stelle betrat Theodor Kirchner die Szene. Kirchner kannte sie schon lange. Als Schüler ihres Mannes besuchte er die Schumanns immer wieder einmal in Leipzig, Dresden und Düsseldorf. Als Schumann starb, befand sich Kirchner in Winterthur, wo er eine Organistenstelle ausfüllte. Nach den Recherchen von Renate Hofmann bot er Clara Schumann offenbar Hilfe an und lud sie in die Schweiz ein (in: Kirchner, S. 16ff). In Kirchner hatte Brahms tatsächlich einen ernst zu nehmenden Konkurrenten.
Beziehungsfragen
285
Kirchner liebte beide Schumanns. Er besaß den Segen des »Meisters« und kannte dessen Werke, so dass Clara Schumann mit ihm darin »schwärmen« konnte. Kirchner, zehn Jahre älter als Brahms, charmant und lebenserfahren, nahm sie offensichtlich für sich ein. Allerdings hatte schon Robert Schumann ihn fiir reichlich bequem gehalten. Clara Schumann setzte jetzt viel daran, den neu aufgefrischten Kontakt zur Förderung des Komponisten Kirchner zu nutzen. »Er ist ein Träumer«, notierte sie sich am 7. Dezember 1857 hellsichtig, und fände »in seiner ganzen Persönlichkeit« keinen Halt (in: Litzmann 3, S. 29). Wie schon Brahms, so nervte sie auch Kirchner damit, sich kompositorisch weiter zu entwickeln, Quartette, Konzerte und Sinfonien zu schreiben. Beide Freunde Clara Schumanns mussten sich dabei unausgesprochen auch darin einem Vergleich mit dem »Meister« ausgesetzt sehen. Jahre später beichtete Brahms ihr, sie hätte ihn manchmal angesehen »wie die Polizei einen, der dreimal abgestraft« (in: Schumann-Brahms 2, S. 13). Diese Mentorenposition beherrschte über weite Strecken die erhaltene Korrespondenz zwischen Kirchner und Clara Schumann. Immer wieder fragte sie nach seinen Plänen, Fortschritten, spornte ihn an. Als Clara Schumann sich dann wirtschaftlich so weit hochgearbeitet hatte, dass sie 1862 in Baden-Baden ein Haus fiir sich und die Ihren kaufen konnte, hoffe sie auf Kirchner als ersten Gast. Verfolgt man die Briefe, so steigert sich der emotionale Tonfall deutlich. Während sie noch die letzten Pflänzchen ins Brahmssche Blumentagebuch einsteckte, schrieb sie Kirchner aus ihrem Feriendomizil in Wildbad: »Schön wäre es, überraschten Sie mich einmal mit recht viel Musik unterm Arm und recht viel 4 Händigem! doch Zureden möchten ich Ihnen nicht« (27. Juli 1859). Offensichtlich kam er, allerdings mit leeren Taschen, da er in BadenBaden sein Geld verspielt hatte, ein Warnzeichen, das Clara Schumann zwar registrierte, dessen Tragweite sie allerdings übersah. Je mehr sie sich an ihn gewöhnte, desto mehr machte ihr zunächst Kirchners Trägheit zu schaffen. Bei aller privat geäußerten Sehnsucht nach ihm wünschte sie trotzdem nicht, dass Kirchner sie auf ihren Tourneen begleitete oder ihr nachreiste. Diese Beziehung sollte diskret bleiben, auch dem eigenen Freundeskreis gegenüber. »Bis zum Sommer müssen wir nun aushalten, bis dahin lassen Sie uns fleißig einander schreiben« (30. Jan. 1863). Die inzwischen 43jährige Künstlerin dürfte Kirchners Werbung mitsamt der erotischen Komponente genossen haben. Als Witwe, die sozusagen ihren Beitrag für die Gesellschaft erbracht hatte, konnte sie sich einen Liebhaber leisten. Sie war in ein neues Lebensstadium getreten. Ein entsprechendes Selbstbewusstsein bildet auch ein Porträt im Visitenkartenformat aus dieser Zeit ab (Abb. 16). Die Halbprofilaufnahme zeigt die Künstlerin lässig 286
Paar-Konzepte
hingegossen in einem Sessel, den Arm auf eine Lehne gestützt, von der ein üppig drapiertes kunstvoll gewebtes Plaid herabfällt. Ihr dunkles, tailliertes Samtkleid besticht durch Stofffülle. Der weite Ausschnitt und die spitzenverbrämten kurzen Ärmel sind verschwenderisch von einem luftigen, fast transparentem, leinengebundenem Baumwollgewebe überzogen, das, verglichen mit sonstigen Clara Schumann-Porträts, ungewöhnlich viel Haut durchscheinen lässt. An die Witwe erinnert hier nur der ins Haar geflochtene schwarze Schleier. Zu welchem Zweck oder für wen diese Aufnahme entstand, ist nicht bekannt. Die Widmung: »Zur Erinnerung an / Clara Schumann / Rigi-Kaltbad d. 24. Aug. 62«, könnte Kirchner gegolten haben, der sie dort besuchte (Litzmann 3, S. 126). »Lieber Freund / Warum höre ich nichts von Ihnen? [...] Ich weiß gar nicht, was ich davon denken soll« (7. Februar 1863). »Ich hatte so sicher gehofft, daß Sie der Erste in meinem Fremdenzimmer« in Baden-Baden sein würden (21. Juni 1863). »Lassen Sie mich dem Drange meines Herzens folgen, und Ihnen, mein Lieber, einen recht innigen Gruß senden« (2. Juli 1863). Noch im Dezember 1862 hatte sie seine Avancen als bloße »Schwärmerei« abgetan und ihn gebeten: »aber bitte, lassen Sie das >Dufriedvollen FestivalsSandwiches< heißen. Joachim schämte sich regelmäßig, wenn sein eigener Name in colossalen Lettern ihm auf der Straße entgegengewackelt kam« {Concertwesen 2, S. 510). Ungewohnt war außerdem die Praxis, mit den kompletten Programmen anschließend auf Tournee zu gehen und die Konzerte nach Manchester, Liverpool, Bath, Dublin und Edinburgh sowie an weitere Städte zu verkaufen. Uberall konnte sie zusätzlich noch eigene Soireen veranstalten, was sie bei ihrer ersten Reise nur in Manchester nutzte. Außerdem bot sich an allen Orten die Möglichkeit, Stunden zu geben. Allerdings blieben die Fahrten sehr aufwändig. Um nach Dublin zu kommen, müsse sie »5-6 Stunden über die See, außerdem noch 6-7 Stunden Eisenbahn [fahren], und Alles Allein!«, beschrieb sie ihrer Mutter die »strapatiöse Reise« (14. Juni 1856). Nach zö312
Handlungsreisende
gerlichem Beginn in den ersten Jahren verdiente sie schließlich nirgends so viel Geld wie auf dem freien englischen Markt. Die Englandreisen trugen wesentlich dazu bei, dass sich Clara Schumanns wirtschaftliche Situation in den 1860er Jahren rapide konsolidierte. Dadurch konnte sie sich ein Haus im mondänen Baden-Baden leisten. »London ist eine riesige Stadt, aber sehr reinlich, wie man's in Deutschland nicht kennt« (an M . Bargiel, 14. Juni 1856). Sehr bald schon überzeugte sie auch die ungezwungenere englische Lebensart, das britische Understatement und das persönliche Engagement der Menschen, mit denen sie zu tun hatte. Daraus festigte sich die Uberzeugung, »der Engländer ist erst kalt, schwer zugänglich [...] aber einmal warm, ist er es für immer«, und sie bekannte, »ich liebe den englischen Charakter sehr« (in: Litzmann
2, S. 411). Vermutlich
fühlte sie sich damit verwandt. Jedenfalls fand sie sich so gut in den englischen Lebensstil ein, dass sie mit ihrer Tochter Marie sogar ein »Fußballwettspielen« in Rugby besuchte. Toasts zum Frühstück, die nachmittägliche Teestunde sowie Krocketspielen übernahm Clara Schumann als englischen Import dann auch in ihren deutschen Alltag. Bei ihrer ersten Tournee 1856 konnte sie die Insel zwar noch nicht vollständig erobern. Doch schon als sie im Juli Abschied nahm, hatte sie in England Freunde fürs Leben gewonnen (Chissell 1983, S. 168; E. Schumann, S. 65). Ihre durchschlagendsten Erfolge erzielte Clara Schumann in den 1860er Jahren mit den Auftritten bei den großen, populären Massenveranstaltungen, den Samstagskonzerten im Chrystal Palace und bei den »Populär C o n certs« in der St. James Hall. In Zusammenarbeit mit George Grove hatte der Dirigent August Manns ab 1855 für die Aufführungen im Chrystal Palace ein gut funktionierendes Orchester aufgestellt, das mit einem festen Musikerstamm, darunter Mitglieder der Military Brassband, regelmäßig probte. Damit konnten jahrzehntelang in großem Maßstab qualitativ hervorragende Konzerte mit anspruchsvollem Repertoire veranstaltet werden, deren Attraktivität noch dadurch gesteigert wurde, dass der Spielort selbst ein so populäres Ausflugsziel war und die Eintrittspreise niedrig blieben. Clara Schumanns jährliche Gastspiele dort wurden schon bald ein »Must« für das Londoner Publikum. Genauso spektakulär gerieten ihre Auftritte in den »Populär Concerts«. Über 100 M a l trat Clara Schumann im Laufe ihrer Englandreisen dort auf (Kat., S. 251). Der N a m e »erschreckt Sie hoffentlich nicht«, hatte Joachim ihr anfangs noch vorsichtig geschrieben. Er »kommt daher, daß auch Plätze zu einem Shilling verkauft werden, um auch den Unbemittelten die Möglich-
Kunstimperialismus und Industrialisierung
313
keit zu verschaffen, zuzuhören« {Joachim 2, S. 189). Die im Dezember 1858 begonnene Konzertreihe sollte zunächst die St. James Hall als Veranstaltungsort bekannt machen. Der neu gebaute Komplex mit zwei Konzertsälen (der größere fasste über 2.000 Besucher), Restaurants und einem öffentlichen Speisesaal war ein Unternehmen der Musikverlage Beale and Chappell und Chappell & Co. Der Ort wurde als Forum eines neuen Typs von Musikveranstaltung bekannt. Von Beginn an setzte man auf Attraktionen und bot ein ganzes Spektrum unterschiedlicher musikalischer Genres, um neue Hörerschichten anzulocken. Die Programme richtet man danach aus, mit der musikalischen Unterhaltung auch ästhetische Lerneffekte bewirken zu können. Anspruchsvolle Stücke, aufgeführt von internationalen Stars, bestimmten die Auswahl. Wie im Crystal Palace gehörten niedrige Eintrittspreise sowie informative Programmhefte für einen Sixpence zum durchschlagenden Erfolgskonzept. Dieser für die Londoner Musikszene der 1850er und 60er Jahre charakteristische konzertpädagogische Ansatz kam Clara Schumanns eigenen Interessen und Überzeugungen sehr entgegen. »Es wird nur die allerbeste Kammermusik da aufgeführt, vom späten Beethoven bis zum jungen Haydn«, versicherte Joachim. Tatsächlich gab es unter der Leitung von Arthur Chappell Musik von Beethoven, Haydn, Mozart, Mendelssohn und Weber, dazu Bach und Händel (Goodwin/Raynor 1980, S. 195ff). Wie schon die Réunion des Arts 1856 wagte auch Chappell 1865 mit Clara Schumann einen »Schumann-evening [...], in dem nur Compositionen Roberts zur Auffuhrung kamen«, liest man im Tagebuch. Jetzt spielte sie allerdings vor mehr als 2.000 Zuhörern. Man empfing die Künstlerin enthusiastisch. »Es dauerte lange, bis ich mich ans Ciavier setzen konnte. Ach, hätte Robert das erlebt« (in: Litzmann 3, S. 180). Das Konzept ging auf. Die »Pops« mauserten sich zu den wichtigsten Londoner Konzerten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ausgerechnet dort, bei den populären Veranstaltungen in der St. James Hall und im Crystal Palace, konnte man die beste artifizielle Musik hören, neben exquisiter Kammermusik und Liedern auch Sinfonien und Solokonzerte von Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Sullivan und Grieg. In ihrem letzten Auftrittsjahrzehnt konzertierte Clara Schumann nur noch dort, und sie feierte in den der Volksbildung dienenden populären Reihen zwischen 1865 und 1887 ihre größten Triumphe. Nach einem Vortrag von Beethovens Klaviersonate EsDur op. 81a (»Les Adieux«) überschüttete sie »ein förmlicher Blumenregen von den Shillingsplätzen und der Gallerie«, liest man im Tagebuch 1884. »Das Publicum stand und schrie fort und fort; ich ging auf Blumen noch einmal ans Ciavier und gab die F-dur-Novellette zu«. Die Anhänglichkeit 314
Handlungsreisende
ihrer englischen Fans rührte sie sehr, zumal »die meisten Beweise [...] von den Unbemittelten« kamen (in: Litzmann 3, S. 452). Eugenie Schumann bestätigt in ihren Erinnerungen, wie ihre Mutter »unter lautem Jubel sich durch das dichtgedrängte Shillingspublikum hindurch den Weg zum Flügel bahnte [...], sich dankend verneigte, wobei sie die hinter ihr auf dem Podium sitzenden Enthusiasten, die sich ihre Plätze durch stundenlanges Warten hatten erkämpfen müssen, nie vergaß« {E. Schumann, S. 223f). Ellas Konzertgesellschaft The Musical Union und die »Popular-Concerte von Chappell« hätten »das gebildeste Publicum«, fand Clara Schumann schon 1865. In England konnte die Künstlerin erleben, was mit Engagement und kluger Programmpolitik alles zu erreichen war, wenn man auf ein offenes, aufnahmebereites Bürgertum stieß und den künstlerischen Dialog mit ihm aufnahm, obwohl sie zunächst nur zum »Arbeiten«, das heißt um Geld zu verdienen, hergekommen war. Sie lernte zwei wesentliche Dinge. Zum einen fasste man in England »populär« nicht automatisch als minderwertig auf, im Unterschied zum deutschen Gebrauch, wo Verbreitung mit Verflachung korrelierte ( P o p u l a r i s i e r u n g , S. 50). Dementsprechend waren die Veranstaltungsorte mit ihrem jeweiligen Publikum offenbar auch nicht so strikt von bestimmten sozialen Schichten vereinnahmt, wie bei der Entwicklung der verschiedenen Musikszenen in Deutschland. Zum zweiten schien es die Kunsthaftigkeit nicht wirklich zu beschädigen, wenn Musik »wie Seide oder Tee oder Zucker«, so Clara Schumann {Litzmann 2, S. 407), gehandelt wurde, eine Form von »business«, die die Künstlerin gleichwohl empfindlich störte. Vielmehr hing auch hier die Würde der Kunst davon ab, mit welcher Ernsthaftigkeit und Verantwortung man sich ihr widmete. Hier bot Clara Schumann in England wie in Deutschland ein bewundertes Vorbild. Die Anziehungskraft zwischen der Virtuosin und der englischen Musikszene wirkte gegenseitig. Chappell hätte »dem Publicum immer das Beste geboten« und sich um »die ganze musikalische Bildung« verdient gemacht, urteilte Clara Schumann. Im Rückblick von 1887 zog sie die zufriedene Bilanz, dass das »Populär-Publicum wenigstens fortgeschritten ist, es ist allerdings auch die Elite der musikalischen Welt, bestehend aus Lehrern und wirklichen Musikfreunden und einem Theil Publicum, welches allerdings hingeht, weil es Mode ist« (in: Kat., S. 250). Solche »Mode«-Besucher gehörten notwendigerweise dazu. Halfen sie doch, die Veranstaltungen zu finanzieren. Ein Stück dieses Erziehungserfolgs gebührte schließlich Clara Schumann und ihrer klugen Repertoirepolitik.
Kunstimperialismus und Industrialisierung
315
Schumann und etwas von Beethoven
Repertoire und künstlerisches Profil »Ich bitte Sie aber inständig, nun endlich bei der mir so lieben Wahl stehen zu bleiben und mir umgehend mitzutheilen, ob es Ihnen genehm ist, statt der Haydn'schen Sonate, die Sie vorschlagen, die mir aber in ein Orchester Concert nicht zu passen scheint, die Kreutzer-Sonate (von Noten) zu spielen?« fragte Joseph Joachim an. »Das Programm würde dann im Ganzen folgendermaßen beschaffen werden: Sinfonie v. Mozart: sehr kurz (ohne Menuett). Gesang. Concert von Robert Sch. - Die Kreutzer Sonate von Beeth. Gesang. Ouverture von Schumann oder eine der Leonoren«. Da der Hof trauerte, mussten die beiden Virtuosen Clara Schumann und Joseph Joachim ihren Auftritt modifizieren. Noch stand kein Telefon zur Verfügung, vielmehr flogen im Januar 1857 eilige Briefe zwischen Hannover und Düsseldorf hin und her. Der Virtuose Ernst Pauer habe vom Palais ins Theater ausweichen müssen und Beethovens fünftes Klavierkonzert Es-Dur op. 73 aufgeführt, ließ Joachim wissen. »Das darf für Sie kein Grund sein, das G dur Conzert v. B. nicht zu spielen. Wenn Sie mir nur umgehend schreiben wollen, ob Sie Mozart oder Beethoven lieber auf's Programm gestellt wissen wollen«. Joachim stand unter Druck. »Was kann ich denn dafür, daß die alte Großmutter in Württemberg gen Himmel gefahren ist!« (Joachim 1, S. 382ff). Konzertveranstaltungen waren vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt. Außere Einflüsse, wie Sterbe- oder Unfälle, Krankheit, Kriege und Katastrophen musste man hinnehmen. Hier passten sich die Künstler bereitwillig an. Man machte alternative Vorschläge. Allerdings wäre es ihm in diesem Fall nicht möglich gewesen, »den König wegen des Mozarts-Concertes selber zu fragen«, so Joachim. Daher sollte Clara Schumann allein entscheiden. Die glückliche Zusammenstellung des Programms gestaltete sich als hoch sensibler, auch heikler Akt. Selbst bei festen Rahmenvorgaben der Veranstalter oder Auftraggeber, die etwa eine Sinfonie, Ouvertüre, Solo-Konzerte oder verschiedene Gesangsnummern wünschten, bedurfte es noch einer sorgfältigen Abwägung, was in welcher Reihenfolge erklingen sollte. Mitunter kam es vor, dass »der König unterwegs eine Italienerin gehört« hatte, die dann im nächsten Konzert singen sollte (Joachim 1, S. 496). Am Hof von Hannover erwartete man von Joachim die Erledigung der Organisation. Außerdem dirigierte er das Orchester und er sollte darüber hinaus die Herrschaften auch als stupender Violinist glänzend unterhalten. Von Clara Schumann, die schon in den 1830er Jahren dort aufgetreten war, wollte 316
Handlungsreisende
man verzaubert und erhoben werden. »Der König ist noch immer in enthusiastischer Erinnerung Ihres Hierseins«, so Joachim. »Ihre Romanzen [op. 22] müssten wiederholt werden« (Joachim 1, S. 382). Sie sollte sich als Künstlerin mit einem passenden Repertoire in Szene setzen. Gleichzeitig entzückte den Hof, beide zusammen zu hören. Dementsprechend arrangierten sie die Nummern. Die so genannte »Kreutzer«-Sonate, Beethovens Violinsonate A-Dur op. 47, war eines ihrer »Paradestücke«, ein sicherer Treffer. Sich für ein bestimmtes Klavierkonzerts zu entscheiden, fiel Clara Schumann in diesem speziellen Fall schwerer. Mozarts »edle und gleichmässige Schönheit« verlangte vom Publikum »mehr Sinn und Gefühl« als »die reichen Gegensätze und die großen Züge Beethovens« (Joachim 1, S. 396). Beethoven kam bei einem allgemeinen Publikum besser an als Mozart. Doch weil Pauer, ein aufstrebender Konkurrent aus der Wiener Klavierdynastie Streicher, gerade mit Beethoven aufgetreten war, wollte Clara Schumann etwas anderes dagegen setzen, denn es widerstrebte ihr zutiefst, die »zweite« zu sein. Also änderte sie ihre Pläne noch einmal und wich auf Schumanns Klavierkonzert op. 54 aus. Repertoires schleifen sich mit der Zeit ein. Dieses Phänomen zeigen auch Clara Schumanns Programme. Altes wurde ausgesiebt und durch Neues ersetzt. Dabei kristallisierte sich über einen längeren Zeitraum hinweg ein konstanter Kern heraus. Schumann und etwas von Beethoven gehörten schon früh und bis zu ihren letzten öffentlichen Auftritten als tragende Säulen dazu (Klassen 2006, S. 65). Nicht alle Stücke ihres Repertoires lassen sich exakt identifizieren, da es im 19. Jahrhundert unüblich war, in den Programmen nähere philologische Angaben wie Tonarten oder Opuszahlen zu verzeichnen. So tauchen öfters »Nocturne«, »Etüde« oder »Scherzo« von Chopin oder einzelne »Lied ohne Worte« Mendelssohn Bartholdys ohne weitere Hinweise auf. Ebenso unspezifisch bleiben Angaben wie »Fuge von S. Bach« oder »Sonate von Scarlatti«. Nur manchmal lassen sich solche Titel durch einen Vergleich mit anderen Quellen wie Werk- und Verlagsverzeichnisse oder zeitgenössische Ausgaben präzisieren. Mendelssohn Bartholdy widmete Clara Schumann im Januar 1844 das fünfte Heft seiner Lieder ohne Worte op. 62. Sie nahm daraus das Venetianische Gondellied und das Frühlingslied als Manuskript mit auf die Russlandreise (Tb 2, S. 316 und 537). Nach Julia M. Nauhaus führte Clara Schumann in Braunschweig Scarlattis D-Dur Sonate K 430 auf, und die von ihr immer wieder gespielte Bachsche »Gavotte« stammt vermutlich aus dessen Englischer Suite d-Moll BWV 811. Im ungarischen Pest brachte der Veranstalter das Stück offenbar als Einzelblatt heraus mit dem Zusatz, »von Clara Schumann in ihren Konzerten gespielt« (Schumann-Brahms 1, S. 237).
Repertoire und künstlerisches Profil
317
Die Programmauswahl steuerten zunächst allgemeine Vorgaben, wie Größe und Art der Veranstaltung, ob mit Orchester, rein solistisch oder kammermusikalisch. Neben nationalen und politischen spielten geographische, demographische und interkulturelle Fragen eine Rolle. Metropolen mit reicher musikalischer Tradition verlangten andere Aufführungen als kleinere Einzelveranstaltungen in der Provinz. Dazu kam der institutionelle Rahmen. Ein Auftritt im Leipziger Gewandhaus unterschied sich von einem am St. Petersburger Hof oder im Wiener Burgtheater. Man musste sich nicht nur den akustischen Raumverhältnissen und strukturellen Vorgaben wie der Anzahl der zur Verfügung stehenden Mitwirkenden anpassen, sondern auch dem soziale Prestige der Spielstätte. Im Pariser Conservatoire, das seine Erlaubnis, dort auftreten zu dürfen, bereits als Auszeichnung verstand, sollten nur »gediegene« Nummern erklingen. »Ich hätte so gern Roberts Concert gespielt«, doch man riet ihr dringend ab (in: Kat., S. 157). Selbst eine Clara Schumann, 1862 als »célébrité« in Paris gefeiert, musste sich nach den dortigen Konventionen richten. Sie wählte statt Schumann das fünfte Klavierkonzert op. 73 von Beethoven. »Extra-Konzerte« und etablierte Konzertreihen boten meist mehr musikalische Möglichkeiten als semi-private Auftritte bei feudalen oder industriellen Mäzenen. Neue Musik erwartete man in Deutschland hauptsächlich in Expertenzirkeln, in England mischte man sie in die Programme populärer Reihen. Darüber hinaus spielte aber auch das spezifische Image der Virtuosen eine Rolle. Von einem internationalen Star erhoffte man sich etwas Spektakuläreres als von lokalen Größen, von bereits bekannten Persönlichkeiten erwartete man mehr vertraute »Hits« als von unbekannten, von Frauen mehr Emotionales als von Männern. Damit konnten die Virtuosen dann spielerisch umgehen und entscheiden, ob sie derartige Erwartungen bedienen oder konterkarieren wollten. Clara Schumann hat bestimmte Stücke bevorzugt und immer wieder vorgetragen. Entscheidungen, was ins Repertoire übernommen wurde, erfolgten in einem komplexen Geflecht verschiedener explizit und implizit wertender Handlungen. Kriterien für die Bewertung formierten sich durch lebensgeschichtliche Einflüsse, biografische Ereignisse, emotional Erlebtes sowie durch allgemeine Komponenten wie kollektive Wertkategorien, zeitgenössische Kunst- und Wissensdiskurse, einschließlich der Kritik und ästhetischen Reflexion, und das allgemeine Musikangebot der Zeit (Klassen 2006). Ein zentrales Motiv lieferte die Konkurrenz. »Warum soll ich in meinen Concerten Sachen von Schumann spielen?« fragte Leopold von Mayer pikiert. »Seine Frau spielt auch nichts von meinen Compositionen« (in: Kat., S. 131). Auch Hans von Bülow grenzte sich ab und wählte nur die Nocturnes von 318
Handlungsreisende
Chopin, die Clara Schumann nicht im Repertoire hatte (Hinrichsen 1999, S. 95). Gleichzeitig wetteiferten fast alle zeitgenössischen Virtuosinnen und Virtuosen um die beste Darbietung von Beethovens fünftem Klavierkonzert op. 73. Es gehörte offenbar zum Prestige, das Stück im Repertoire zu haben. Uber alle politischen Grenzen, Bündnisachsen und Kriegsgegner hinweg konnten die Pianisten dieses Konzert in allen Musikmetropolen der Welt als Visitenkarte nutzen. Zur Publikumsorientierung auf der einen traten aufführungspraktische Motive auf der anderen Seite hinzu. So durften reisende Virtuosen bei viel gespielten »Hits« eher als bei wenig bekannter oder neuer Musik damit rechnen, dass die Orchester vor Ort ihren Part schon kannten und eine Aufführung selbst mit nur einer Durchspielprobe klappen würde. Auch situative Abwägungen wie ein Zusammentreffen bestimmter Musiker vor Ort wirkten sich auf das Repertoire aus. Oft stellte sich erst kurz vorher heraus, welche weiteren Künstler zu gewinnen waren, was sie anzubieten hatten oder was nicht. So kam in Wien im Februar 1866 die von der Schumann geplante Vorstellung von Brahms' gerade erschienenem Klavierquintett f-Moll op. 34 nicht zustande, weil das beteiligte Hellmesberger-Quartett zu schlecht vorbereitet war. »Meine Herren, ich muß Sie bitten, mir zu sagen, wann Sie Zeit haben, dieses Stück mit mir zu studieren.« Man hatte keine Zeit. Clara Schumanns Unmutspegel stieg. Auch der von ihr vorgeschlagene Ersatz, Brahms' Klavierquartett op. 26, passte den Herren nicht. Daraufhin sagte sie ihrerseits die schon eingefädelte Uraufführung von Brahms' Trio für Horn, Violine und Klavier op. 40 wieder ab. Ihr fehlte jetzt wirklich der Mut, sich »noch 'mal solcher Unfreundlichkeit auszusetzen«, berichtete sie dem Komponisten verärgert (Schumann-Brahms 1, S. 529ff). Es gab aber umgekehrt auch die Erfahrung, dass Aufführungen durch überraschend anwesende Mitspieler gewannen. Trafen Clara Schumann und Joachim in London den von beiden sehr geschätzten Cellisten Alfredo Piatti, so nahmen sie Klaviertrios in ihre Konzertprogramme auf. Mit den Jahren festigten sich die drei so sehr zu einem »Team«, dass sie sich bei einem Auftritt mit Haydns Klaviertrio G-Dur (vermutlich Hob. 25, mit dem populären »all'ongarese«-Satz) an »Übermuth« gegenseitig überboten. »Ich wollte, Sie hätten es gehört«, schrieb die Schumann an Rosalie Leser. »Das Publicum war electrisirt«. In dieser Besetzung führte sie im Frühjahr 1873 ihr eigenes Klaviertrio op. 17 in London auf. »Joachim und Piatti spielten es mit großer Hingebung, so schön, wie ich es nur wünschen konnte«. Das Scherzo musste wiederholt werden (in: Litzmann 3, S. 227 und 287; Chissell 1983, S. 168). Joseph Joachim war mit Abstand Clara Schumanns liebster Bühnenpartner. Als Künstlertypen ähnelten sie sich. Beide musizierten auf Spitzenni-
Repertoire und künstlerisches Profil
319
veau, beide waren international gefragte Stars. Da er so rastlos herumreiste wie sie, konnte sie sich mit ihm leichter über Konzertfragen und deren Begleitumstände (wie physischer und psychischer Auftrittsstress) verständigen als mit Brahms, der viel zauderlicher war und große Reisen scheute. Clara Schumann hielt sich mit parteilichen Kommentaren zurück, als die Ehe von Joseph und Amalie Joachim zerbrach. Nach der Trennung der Joachims konzertierte sie fortan mit jedem einzeln. Immerhin gelang es, ihre künstlerische Partnerschaft über 47 Jahre, bis zum Rückzug der Schumann vom Podium, und ihre private Freundschaft bis ans Lebensende zu erhalten. Von 980 zwischen 1854 und 1891 absolvierten und durch Programmzettel belegten Auftritten bestritt Clara Schumann ein Viertel gemeinsam mit Joachim (Bär 1999, S. 49). Bei der Programmauswahl spielten neben künstlerischen schließlich auch pragmatische Entscheidungen eine Rolle wie die Frage, was man in die Vorbereitung an Aufwand investieren müsse. Manche Stücke forderten eine hohe mentale Konzentration. Dazu zählten für Clara Schumann etwa Werke von Bach, teilweise auch Schumanns große Klavierzyklen sowie seit den späten 1850er Jahren die Musik von Brahms. Bei Zeitmangel oder auch um Reserven zu sparen, wählte sie leichter zu spielende Stücke oder solche, die sie noch gut in den Fingern und schon oft musiziert hatte, und ließ alles aus, was aufwändig einzustudieren war oder viel Kraft kostete. Clara Schumann hatte im Frühjahr 1871 Brahms' Variationen und Fuge über ein Thema von Händel op. 24 schon ins Programm gesetzt. Doch »dann spielten mir die übermüdeten Muskeln einen Streich«. Sie überanstrengte sich beim Üben und nahm das Stück heraus. »Ich kann nicht sagen, wie leid es mir ist«, schrieb sie Brahms, »daß diese Variationen, für die ich so begeistert bin, über meine Kräfte gehen« (Schumann-Brahms 1, S. 639). Wie bitter die Erfahrung gewesen sein mochte, lässt sich ahnen, wenn man die Geschichte des Stücks anschaut. Er hätte Variationen zu ihrem Geburtstag gemacht, »die Du noch immer nicht gehört hast, und die Du schon längst hättest einüben sollen für Deine Konzerte«, mahnte Brahms im Oktober 1861. Clara Schumann kam daraufhin nach Hamburg und spielte die Variationen in ihrer Soirée am 7. Dezember 1861 als öffentliche Uraufführung. »Voller Genialität« seien sie, »mit einer Fuge am Schluß, die Kunst und Begeisterung in einer Weise vereint, wie ich Weniges kenne. Sie sind furchtbar schwer«, schrieb sie ihrer Tochter. »Ich spielte sie unter Todesangst«, hieß es dann rückblickend, »aber dennoch glücklich und mit viel Beifall. Johannes aber kränkte mich tief«, indem er ihre Leistung (die er ja sozusagen »bestellt« hatte) mit keiner Silbe würdigte, sondern bloß ranzig kommentierte, es sei »schrecklich, etwas von 320
Handlungsreisende
sich hören zu müssen« (in: Litzmann 3, S. llOff). Clara Schumann setzte sich über diesen Missklang hinweg und spielte trotzdem das große mental wie technisch höchst anspruchsvolle Werk in den nächsten zehn Jahren immer wieder, bevor sie es aus dem Repertoire kippte. In den 1860er und 70er Jahren gingen viele Virtuosen an ihre physischen und psychischen Grenzen. Sie waren pausenlos unterwegs und hetzten wie getrieben von Ort zu Ort. Hier zeigte sich eine Kehrseite der verkehrstechnischen Beschleunigung. Die Auftrittsfrequenzen von der Schumann, Joachim oder von Bülow verdichteten sich in jener Zeit erheblich. »Jetzt habe ich enorm gearbeitet, hatte in 10 Tagen 6 Konzerte in 5 verschiedenen Städten«, berichtete die Schumann ihrer Mutter (4. Dezember 1863). Liszt hatte schon Anfang der 1840er Jahre, noch mit eigener Kutsche, das Wunder vollbracht, innerhalb von sieben Wochen in 18 Städten zu konzertieren. Mehr als einmal scheint er direkt vom Wagen auf die Bühne gesprungen zu sein (Burger 1986, S. 132ff). Neben umfangreichen Deutschlandreisen tourte auch Clara Schumann in den 1860er Jahren durch England, Irland und Schottland, Frankreich, Holland, Belgien, Russland, Böhmen, Ungarn, Osterreich und die Schweiz (Reich 1991, S. 368). Sie verabredete sich an verschiedenen Orten mit Joachim. Man plante gemeinsame Auftritte, etwa in Ungarn, wo seine Eltern wohnten, was nicht immer gelang, weil ihre dicht gedrängten Tourneerouten oft in gegensätzliche Richtungen führten, und Joachim darüber hinaus auch noch den Wünschen seines königlichen Dienstherren verpflichtet war. Immerhin schätzte der König von Hannover Joachim so sehr, dass er sich als Pate des ältesten Sohnes einsetzte, ein Angebot, das die Joachims schlecht ablehnen konnten. »Nun muß wohl der Junge Georg heißen?«, unkte Clara Schumann. »Mir ein schrecklicher Gedanke«. Das Kind bekam den Namen Johannes (Schumann-Brahms 1, S. 469). Trotz der vollen Terminpläne spielten Schumann und Joachim mit dem Gedanken, ihren Wirkungskreis noch weiter auszudehnen. Einen »Antrag aus Amerika« hätte sie allerdings abgelehnt, teilte die Künstlerin Brahms 1861 mit, der Zeitaufwand von gut einem Jahr würde sich finanziell nicht lohnen, und ihre Familie hätte sie nicht mitnehmen können. Zudem herrschte dort Bürgerkrieg. In New York war 1848 Robert Schumanns Paradies und Peri op. 50,1851 das Klavierquintett op. 44, ein Jahr später die erste Sinfonie op. 38 und 1855 der Carnavalop. 9 aufgeführt worden (Reich 2002, S. 569ff). Statt nach Amerika fuhr Clara Schumann zur Kur ins belgische Spa. Kurz zuvor hatte sie noch mit Joachim auf dem Musikfest in Aachen konzertiert. »Wir wurden beide sehr belorbeert, er noch außerdem von den Damen mit Buketts förmlich bombardiert« {Schumann-Brahms 1, S. 364fF). Repertoire und künstlerisches Profil
321
Doch war sie jetzt ausgepumpt. Nicht nur Schumann und Joachim litten an erheblichen, instrumentenspezifischen Überlastungsbeschwerden in Armen und Fingern, auch von Bülow nannte diese Reisejahre eine »unaufhörliche Tortur« und listete eine ganze Reihe diverser Qualen auf. Liszt soll sogar einmal ohnmächtig vom Podium getragen worden sein (in: Geck 1989, S. 294; Burger 1986, S. 80). Erst durch Schaden lernten die Virtuosen, mit ihren Kräften besser zu haushalten. Schon bei ihren Konzerten in Wien und Pest im Winter 1858 und 1859 beeinträchtigten Erschöpfungssyndrome Clara Schumann so sehr, dass sie beim Pester Konzert »in zwei Stücken gänzlich stecken« blieb, »meine Gedanken verwirrten sich so, daß ich wirklich die letzten Funken Kraft zusammennehmen mußte, um nicht aufzuhören«, beichtete sie Joachim. Diese Erfahrung hatte sie zwar schon früher gemacht. Auch in Hamburg war sie in einer Situation allgemeiner Erschöpfung im Februar 1840 gleich dreimal ausgestiegen, doch damals »hat's Niemand gemerkt«. Hier nun war ihre schlechte Verfassung kaum zu übersehen, da sie nach dem ersten Stück »einen solchen Weinkrampf« bekam, dass »es lange Zeit brauchte«, bis sie sich wieder fasste. Hanslick, der sie vier Tage vorher in W i e n gehört hatte, mutmaßte dort bereits, sie sei »vielleicht nicht ganz disponirt«, denn ihr Spiel kam ihm gar »zu frostig« und »zu schneidig« vor (Joachim 2, S. 39; Bw, S. 915; Hanslick, Sämtliche Schriften, 1,4, S. 376f). Man darf vermuten, dass auch der gesundheitliche Einbruch Clara Schumanns in der ersten Hälfte der 1870er Jahre nicht allein berufsbedingt war, sondern mit privatem Stress zusammenhing. Gerade weil sie so viel unterwegs war, belasteten die Gedanken an ihre Familie. Den Berliner Haushalt versorgte ihre Freundin Elisabeth Werner, eine Lösung, die sich offenbar für alle Beteiligten als großes Glück erwies. Die drei Ältesten waren inzwischen flügge. Ferdinand Schumann schloss das Gymnasium ab und trat eine Banklehre an, Eugenie und Felix Schumann befanden sich noch in der Schule. Doch Ende der 1860er Jahre begann eine private Unglücksserie für Clara Schumann, ausgelöst durch ihren Sohn Ludwig. Sein geistiger Zustand erschien ab 1870 so hoffnungslos, dass er zunächst nach Pirna und später für den Rest seines Lebens in die Irrenanstalt Colditz verbracht wurde. »Seit dem Unglück mit Robert habe ich solchen Schmerz nicht empfunden als jetzt«, trug sie ins Tagebuch ein. Tagsüber ging es. »Die Nächte war es aber oft sehr schlimm, da sah ich dann stundenlang den armen Jungen vor mir mit den guten treuen Augen, denen ich immer gar nicht widerstehen konnte«. »Die tausend Gedanken, die Vorwürfe die mein Innerstes förmlich überfluten! Jedes harte Worte, das ich dem armen Jungen in der Meinung er sey 322
Handlungsreisende
nur eigensinnig und hochmüthig gab, möchte ich jetzt zurücknehmen können! und daß Niemand von uns jetzt bei ihm war, wie schrecklich ist mir das!«, schrieb sie ihrerTochter Elise 1870 (Litzmann 3, S. 238; Kat., S. 173f). Dann verlor sie 1872 zuerst ihre Mutter und im Herbst ihre Tochter Julie, die kurz vor der Niederkunft ihres dritten Kindes auf dem Weg in den Süden in Paris an Schwindsucht dahinsiechte. Ein Jahr darauf, 1873, starb Friedrich Wieck. Als älteste unter den Geschwistern und Halbgeschwistern mochte sich Clara Schumann nun allein für den Rest auch ihrer Herkunftsfamilien verantwortlich gefühlt haben. Sonst habe ihr immer die Kunst geholfen, über »die schwersten Schicksale« hinweg zu kommen, schrieb sie Brahms, doch jetzt, mit Rheumatismus in den Armen, »hilft mir nichts« (Schumann-Brahms 2, S. 38f). Da Clara Schumann nicht auftrat, brachen ihre Verdienste ein. Zudem erfolgte 1873 ein Börsensturz, der so genannte »Gründerkrach« (Nipperdey 1998, 1, S. 284), durch den auch Clara Schumanns Rücklagen empfindlich abgewertet worden sein dürften. Zur Uberbrückung bildeten Freunde einen Fonds, aus dem die Künstlerin Zuwendungen bezog. Diesmal nahm sie an: »damit ich mich nicht mehr so anzustrengen brauche« (in: Wendler, S. 307). Uberlastungsbeschwerden und rheumatische Attacken begleiteten sie kontinuierlich. Der Mediziner Friedrich von Esmarch, der sie in Kiel monatelang behandelte, verordnete ihr Bäder und Massagen. Trotz Schmerzen sollte sie täglich eine Stunde spielen. Sie habe »den Muth dazu gewonnen - es war wie eine moralische Kur« (in: Litzmann 3, S. 318f). Danach modifizierte Clara Schumann ihr Repertoire noch einmal, und sie verzichtete fortan auf besonders kraftaufwändige Literatur, wie Brahms' erstes Klavierkonzert d-Moll op. 15, von dem sie so viele Zuhörer hatte überzeugen können. Sein zweites Klavierkonzert B-Dur op. 83, das zwischen 1878 und 1881 entstand, spielte Clara Schumann nur privat. Persönliche Vorlieben, etwa affektive und hedonistische Komponenten, emotionale Ansprache und ästhetisches Vergnügen am Stück zählten zu den impliziten Auswahlkriterien für das Repertoire. Darüber hinaus dürften vor allem in den ersten Jahren auch Stücke aufgenommen worden sein, die die Virtuosin gleichsam sportiv herausforderten, durch ihre technischen Schwierigkeiten, weil sie den persönlichen Stärken im Spiel entgegen kamen oder weil sie der Virtuosin etwas zu »knacken« aufgaben, wie die meiste neue Musik. Avantgardistische Stücke waren oft so ungewohnt und komplex organisiert, dass die Künstlerin sich erst deren Konzepte erarbeiten musste, um sie überhaupt auffuhren zu können. In den 1830er und 40er Jahren zählRepertoire und künstlerisches Profil
323
ten die Musik von Chopin, Schumann und Mendelssohn Bartholdy dazu, während Liszt und Thalberg mehr ihren sportiven Ehrgeiz und Henselt das Gemüt ansprachen. Nach Hanslick erregte erst Clara Wiecks Begeisterung ein öffentliches Interesse fiir die Klaviermusik von Henselt. Sie »lieh seinem Ruhm doppelte Flügel, und Robert Schumann, der begeisterte Herold und Schirmherr aller jungen Genies, stellte ihn sofort unter die >Ersten«< (Hanslick, Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre 1870-1885, S. 228). Chopin blieb einer ihrer Favoriten. In den 1830er Jahren führte die Virtuosin alles, was sie von diesem Komponisten in die Finger bekam, sofort auf, teilweise noch aus dem Manuskript. Von den Stücken der 1840er Jahre schätzte sie die Nocturnes op. 48 und op. 62, die Barcarole op. 60, die Fantaisie-Polonaise op. 61 und vor allem die Polonaise fis-Moll op. 44. Dieses Stück hielte die Großmutter für »das Genialste von Chopin« überlieferte ihr Enkel (in: NZfM 1917, S. 101). Sie behielt es auch später noch im Programm. Wenn Chopin dennoch nicht mehr der erste unter ihren Lieblingskomponisten war, so mochte neben einer allgemein gewandelten Chopin-Rezeption in den 1840er Jahren vor allem die Konzentration auf die Werke von Robert Schumann eine Rolle gespielt haben. Der Schumann-Schwerpunkt ihres Repertoires stand sehr früh fest. Schon in den 1830er Jahren arbeitete die Virtuosin nämlich daran, Robert Schumanns Werke in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Dieser Wunsch beruhte auf idealisierten Motiven, wie die Förderung der jungen Kunst, vertreten durch den imaginären »Davidsbund«, dem sie selbst angehörte, und er entsprang gleichzeitig individuellen Bedürfnissen. Galt es doch, einen Komponisten bekannt zu machen und zu würdigen, an dessen Lebensziele die Künstlerin seit 1837 auch ihre eigenen geknüpft hatte, weil sie ihn liebte und von seiner Kunst überzeugt war. Sie profilierte sich in der Öffentlichkeit als Expertin für Schumanns Werke und verteidigte dieses Privileg gegenüber der Konkurrenz. Umgekehrt machte sie wiederholt die Erfahrung, dass man genau dieses von ihr erwartete, wie in London 1865. Nachdem sie »großen Enthusiasmus im philharmonischen Konzert mit Roberts Konzert [op. 54] gefunden«, wiederholte sie es am nächsten Tag im Chrystal Palace. »Uberall muß ich Schumann spielen, und ist das von Seiten des großen Publikums auch nur Modesache, so geht es doch aus von einer nicht kleinen Anzahl wirklich warmer Verehrer Roberts, und die machen mir Freude« (Schumann-Brahms 1, S. 511). Ein Stück weit konnte Clara Schumann die Bekanntheit bestimmter Komponisten tatsächlich steuern, etwa durch Aufführungen in besonders herausragenden Veranstaltungen, wie in ihren Wiener Konzerten im Frühjahr 1838, der gezielten Platzierung im Programmablauf und nicht zuletzt durch 324
Handlungsreisende
eine hohe Auffiihrungsfrequenz. Allerdings musste sie auch immer wieder erfahren, dass eine einseitige brachiale Durchsetzung von Repertoires Grenzen hatte. Zwar ließ sich die Akzeptanz beim Publikum vorbereiten und durch geschickte Dramaturgie (einschließlich guter Werbung) unterstützen, auch durch die Prominenz der Vermittlerin bekräftigen, nicht aber garantieren. Das Publikum nahm nicht alles sofort hin. Als sie 1846 in Wien mit geballter Kraft die Werke ihres Mannes ins Programm setzte, war der Erfolg nur lau, trotz der Prominenz, die die Künstlerin dort immer noch genoss. Erst ein Auftritt Jenny Linds füllte dann die von den Schumanns veranstalteten Konzerte {Litzmann 2, S. 143ff). Aus Nancy Reichs Aufstellung geht hervor, dass die Virtuosin im Laufe ihrer Karriere - bis auf wenige Ausnahmen - das gesamte Klavierwerk Robert Schumanns, seine Klavierkammermusik, das Klavierkonzert und die Konzertstücke tatsächlich öffentlich zu Gehör brachte. Auch ausgewählte Klavierlieder trug sie mit wechselnden Bühnenpartnerinnen und -partnern vor. Im Klavierrepertoire fehlen lediglich Belege für Aufführungen der AbeggVariationen op. 1, der Intermezzi op. 4, der Märsche op. 76 und der Gesänge der Frühe op. 133. Die für ihre Kinder komponierten Zyklen und Sonaten eigneten sich nicht für das Konzertpodium, einige wurden aber privat gespielt. Auch von der dritten Klaviersonate f-Moll op. 14, die Brahms offenbar 1862 zum ersten Mal in Wien hören ließ, ist keine öffentliche Auffuhrung durch Clara Schumann nachgewiesen (Reich 1991, S. 358ff). Da sie aber ihr eigenes Thema aus dem dritten Satz der Sonate (Quasi Variazioni. Andantino de Clara Wieck) 1866 in Wien als Widmung auf einem Foto nutzte, kann davon ausgegangen werden, dass sie dieses Stück auch verbreitet hat (Abb. 14). Obwohl sich schon Clara Wieck auf die Fahnen geschrieben hatte, den Komponisten Schumann tatkräftig zu propagieren, setzte sie ihr Vorhaben in der Regel doch nicht unkritisch um. Aufgrund ihrer Bühnenerfahrung kalkulierte sie vielmehr sorgfältig, wie und in welchem Umfang die Werke am wirkungsvollsten zu präsentieren seien. Besonders die Briefe aus den späten 1830er Jahren gewähren einen Einblick in die Verhandlungen mit Schumann darüber. Gleichzeitig stach sie, dass ausgerechnet Liszt 1840 Schumann im Leipziger Gewandhaus spielen wollte. »Was für Carnavalstücke hast Du Liszt zum Spielen geschrieben? Laß mich's wissen« (Bw, S. 852). Schumanns Antwort ist nicht erhalten. Man darf aber vermuten, dass Liszts Auswahl der Empfehlung des Komponisten entsprach. Er spielte »Préambule« (Nr. 1), »Eusebius«, »Florestan«, »Coquette«, »Répliqué« (Nr. 5 bis 8), »Chopin« (Nr. 12), »Pantalon et Colombine« (Nr. 15), »Reconnaissance« (Nr. 14), »Promenade« (Nr. 19) und »Finale« (Seibold 2005,1, S. 139). Robert Schumann
Repertoire und künstlerisches Profil
325
war hin- und hergerissen. Einerseits hielt er seine Klaviermusik für ungeeignet, um sie einem allgemeinen Publikum zu präsentieren, andererseits gefiel ihm natürlich, seine Musik von so prominenten Virtuosen gespielt zu wissen. Wie Clara Wieck machte aber auch Liszt einschlägige Erfahrungen. »Dem Publikum schmeckten sie nicht, und die meisten Klavierspieler verstanden sie nicht«, beschrieb er rückblickend die Situation von 1840. »Das mehrmahlige Mißlingen meiner Vorträge Schumann'scher Compositionen, sowohl in kleineren Zirkeln, als auch öffentlich, entmuthigten mich« (in: Wasielewski 1880, S. 318). Schumann resümierte in seinem Bericht über Liszts Auftritt selbstkritisch in der NZfM: »Mag manches darin den und jenen reizen, so wechseln doch auch die musikalischen Stimmungen zu rasch, als daß ein ganzes Publikum folgten könnte, das nicht alle Minuten aufgescheucht sein will. Dies hatte mein liebenswürdiger Freund«, nämlich Liszt, »nicht berücksichtigt, und mit so großem Anteil, so genialisch er spielte, der einzelne war vielleicht damit zu treffen, die ganze Maße aber nicht zu heben«. Mit anderen Worten: die Stücke kamen selbst in Liszts Darbietung nicht gut an (in: Kat, S. 286; GS 1, S. 484; GS 2, S. 436). Zwar spielten in den 1830er Jahren auch andere Pianisten und Pianistinnen Schumann, jedoch nur privat. Es gibt keinen Hinweis, dass Chopin die ihm gewidmeten Kreisleriana op. 16 überhaupt aufgeführt hätte. Thalberg spielte sie »vom Blatt mit bedeutender Fertigkeit und Auffassungsgabe« {Tb 2, S. 78), als Schumann ihm im Oktober 1838 seine Aufwartung machte, aber weder er noch Henselt integrierten Schumann-Stücke in ihre Repertoires. Wilhelm Taubert, Theodor Döhler oder Alexander Dreyschock nahmen den Komponisten Schumann (noch) nicht zur Kenntnis. Auch Robena Laidlaw, der die Fantasiestücke op. 12 zugeeignet sind, und Camilla Pleyel führten nach derzeitiger Kennntnis nichts vom jungen Schumann öffentlich auf. Dagegen arbeitete Clara Wieck als einzige auch nach Rückschlägen wie der unterkühlten Uraufführung von Schumanns zweiter Klaviersonate g-Moll op. 22 in Berlin im Februar 1840 beharrlich weiter an ihrer Mission. Schon ab 1833 hatte sie seine Klavierstücke gemeinsam mit denen von Chopin konsequent in der Öffentlichkeit präsentiert. Allerdings portionierte sie die umfangreichen Werke oft in kleinere Sätze beziehungsweise Gruppen und hämmerte sie dem Publikum immer wieder ein. Brahms' Lehrer Eduard Marxen erinnerte sich, von Clara Wieck Schumanns fis-Moll Sonate op. 11 gehört zu haben, vermutlich 1837. Man könnte nicht verlangen, dass die Zuhörer seine Musik sofort begriffen. Mit »der Zeit werden auch Deine Compositionen immer mehr Eingang finden und der Anfang ist ja schon gemacht«, erläuterte sie Schumann 1840 ihre Taktik (Schumann-Brahms 1, 326
Handlungsreisende
S. 24; Bw, S. 939). Reichs Untersuchung der Programmsammlung bestätigt diese Praxis. Schumanns große Klavierzyklen, wie die Papillons op. 2, die Davidsbündlertänze op. 6, den Carnaval op. 9, die Sinfonischen Etüden op. 13 sowie die Novelletten op. 21 mutete sie einem allgemeinen Publikum erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungekürzt, die Kreisleriana op. 16 ohne die Nummern drei und sechs zu. Zum besseren Verständnis des Carnavals hatte Clara Wieck in Paris versucht, ihrem Publikum einige Erläuterungen zu geben. »Lächerlich nehme ich mich aus, wenn ich zu Deinem Carnaval eine Erklärung herausstolpere, nun kann ich immer die rechten Worte nicht finden und lache am Ende selbst über mich« (Bw, S. 537). Auf ihre wiederholte Bitte hat Schumann offenbar unter der Initiale »L.« im Leipziger Tageblatt am 29. März 1840 aus Anlass von Liszts Teilaufführung des Carnaval einige Anmerkungen dazu publiziert. Sie bildeten vermutlich die Grundlage fiir erklärende Programmnotizen, die Clara Schumann in den 1850er Jahren auf die Rückseite eines Programmzettels drucken ließ, wo es unter anderem hieß: »Schattenspielartig treten einzelne Gestalten auf, theils allgemeine, wie Pierrot und Arlequin, Pantalon und Colombine, theils ganz besondere, wie Chopin, Paganini; aber nur für wenige Momente wird das Einzelne sichtbar, um rasch von einem Neuen verdrängt, oder von dem umflutenden Strome verschlungen zu werden«. Dann folgte noch ein Absatz, in dem die historische Situation der Entstehungszeit sowie die ästhetischen Ziele von Schumanns »Davidsbündlern« erklärt wurden. »In Wort, Schrift und That bekämpften sie jene Pedanterie und Heuchelei«, die sich etwa in dem »chablonenartigen Nachahmen von Formen« der »Classicität« äußere (GS 1,S. 484; GS 2 S. 436; Kat, S. 286). Als Clara Schumann im Januar 1859 die Kreisleriana op. 16 in Wien spielte, registrierte Hanslick dagegen die »athemlose Aufmerksamkeit, mit welcher das Publicum den fremdartigen und doch so unwiderstehlich fesselnden Klängen lauschte«. Sie habe die »Besorgnisse über die Unmöglichkeit solcher Vorträge im Concert« zerstreut (Hanslick, Sämtliche Schriften I, 5, S. 14). Mittlerweile waren allerdings nicht nur Liszts biografische Artikel über Clara und Robert Schumann in den einschlägigen Zeitungen verbreitet worden, sondern 1858 auch die erste umfangreiche Schumann-Biografie von Wilhelm von Wasielewski erschienen. Parallel zu den Konzerten konnte man nun also die private Geschichte zur gehörten Musik lesen, einschließlich der von Clara Schumann sorgfältig tabuisierten Ehe-Prozess-Periode und anderen intimen Informationen, die sie gern zensiert hätte. Hanslick widmete der Biografie im Dezember 1858 eine ausführliche Besprechung in der
Repertoire und künstlerisches Profil
327
Wiener Presse, so dass auch das Kaffeehaus-Publikum auf seine Kosten kam (in: Hanslick, Sämtliche Schriften 1,4, S. 378ff). Im Wiener Konzert vom 11. Januar 1859 kombinierte sie die öffentliche Erstaufführung der Kreisleriana op. 16 mit dem Andante und Variationen für zwei Klaviere op. 46, einem »der freundlichsten und faltenlosesten Stücke Schumanns«, so Hanslick (Sämtliche Schriften I, 5, S. 14). Obwohl die Variationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Schumanns beliebtesten Klavierstücken zählten, blieben Misserfolge selbst bei diesem Stück nicht aus. Als die Schumann das Stück mit Brahms in der originalen Quintettbesetzung für zwei Klaviere, zwei Celli und Horn 1869 in Wien spielte, reagierten die Zuhörer verhalten. Man »darf vom Publicum nicht zu viel Verständniß für so Neues und Eigenthümliches verlangen«, so Virtuosin beschwichtigend. »Wenn wir es nächstes Jahr mal wieder vorführen, wird es gewiß schon anders sein« (in: Litzmann 3, S. 226). Ermutigend schrieb dagegen der Hamburger Freischütz nach einem Auftritt der Virtuosin 1850: »Die Ausführungen der Compositionen ihres Mannes war so überaus herrlich, daß ich nur allen Ciavierspielerinnen zurufen kann: Gehet hin und thuet desgleichen« (21. März). Das geschah tatsächlich. Inzwischen führten viele Virtuosinnen und Virtuosen Schumanns Klaviermusik auf. So reiste Wilhelmine Clauß-Szärvädy erfolgreich mit dem Klavierkonzert op. 54 im Gepäck, auch Julie von Asten, eine Schülerin von Clara Schumann, führte Schumann auf. Brahms verbreitete in seiner Virtuosenphase Mitte der 1850er bis Mitte der 60er Jahre verschiedene Werke Schumanns, darunter die Fantasie op. 17 und die dritte Klaviersonate f-Moll op. 14, die auch von Bülow als Solist zu dieser Zeit im Repertoire hatte, der außerdem die Sinfonischen Etüden op. 13, einzelne Stücke aus den Novelletten op. 21 und die Romanzen op. 28 spielte. In den 1870er Jahren kamen die Kreisleriana op. 16 und der Faschingsschwang op. 26 hinzu (Hinrichsen 1999, S. 474f). Den Carnaval op. 9 habe man »unter den Händen Tausig's bluten gesehen«, so Hanslick. Er beäugte 1862 bereits skeptisch, dass SchumannAufführungen unter den Virtuosen »theils Bedürfniß, theils Mode, also jedenfalls unausweichlich geworden« seien. Wer, wie Alexander Dreyschock, Schumann »etwa zwanzig Jahre lang vollständig ignorirt, obwohl schon die technische Aufgabe ihn hätte reizen und ihm zu dem Ruhm hätte verhelfen können, sie zuerst in die Welt einzuführen«, brauchte nun nicht mehr damit anzufangen, giftete der Kritiker (Concertwesen 2, S. 264). Clara Schumann blieb allerdings die unangefochtene »Prima donna« unter den Schumann-Interpreten, nicht allein aufgrund ihres Witwenstatus und dem damit verbundenen Nimbus von Authentizität, sondern auch, weil sie als »Savante« (Berlioz), als eine »Wissende«, unter den Ausführenden besonders herausragte. 328
Handlungsreisende
Ein entsprechendes Image bildet das bekannte Foto ab, das Franz Hanfstaengl anlässlich eines Auftritts der Schumann im Münchener Odeon im Spätherbst 1857 anfertigte. Die Künstlerin präsentiert sich als Witwe in der damals vorgeschriebenen Aufmachung: einem hoch geschlossenen schwarzen Seidenkleid, mit einem in das Haar geflochtenen schwarzen Schleierband, das künftig auf keinem Bild mehr fehlen wird. Ein Arm liegt locker auf einer drapierten Halbsäule, einem traditionellen Emblem fiir Macht, in der Hand hält sie ein noch halb geöffnetes Buch, so als hätte sie gerade darin gelesen. Der Blick verliert sich sinnend in die Ferne (Busch-Salmen 1996, S. 818; Abb. 15). Die Pose zeigt eher eine ernste, in ihre Aufgabe vertiefte gelehrte Frau als eine vitale Virtuosin, der es auch in München gelungen war, durch ihre »Feuerseele« den Saal bis zum Enthusiasmus aufzuheizen. Kaum hatte Clara Schumann das Publikum an Robert Schumanns Klavierwerke herangeführt, so setzte sie seit Ende der 1850er Jahre weitere Brocken ins Programm, nämlich die Musik von Brahms, etwa einzelne Ungarische Tänze, einzelne Sätze aus der f-Moll-Sonate op. 5 und die Balladen op. 10. Die Balladen »fielen [...] ganz durch«, so Clara Schumann, obwohl sie ihr sehr gut gelungen seien, während die Tanze besser ankamen. Hanslick fand dagegen, sie habe deren Vortrag durch ihr »bizarre[s]« Tempo »leider zu einem fast ungenießbaren Raffinement« zugespitzt. »Brahms und Walzer«, so Hanslick später über die ihm gewidmeten Liebeslieder-Walzer op. 52a, »die beiden Worte sehen einander auf dem zierlichen Titelblatte förmlich erstaunt an«. Inzwischen wusste Clara Schumann aber auch, dass man sich bei der Etablierung neuer Musik nicht beirren lassen, sondern bloß durchhalten musste. Manche Stücke traute sie dem Publikum allerdings wirklich nicht zu, etwa Brahms' Studien fiir Pianoforte, Variationen über ein Thema von Paganini op. 35. Je »mehr ich aber daran studire, desto schwerer finde ich sie«, so ihre Erfahrung. »Für den Concertvortrag scheinen sie mir aber nicht geeignet, denn nicht mal der Musiker kann all den originellen Verzweigungen und piquanten Wendungen folgen, und wie viel mehr steht dann das Publicum davor wie vor Hieroglyphen« (Hanslick, Sämtliche Schriften I, 4, S. 376f.; 5, S. 393; Concertwesen 2, S. 392f. und 405; Litzmann 3, S. 72 und 157). Wie überlebenswichtig indessen die inhaltlichen Modifikationen der Repertoires für die Publikumsakzeptanz waren zeigen zwei prominente Beispiele. Als Moscheies 1844 in Wien immer noch unverändert mit seinen schon Ende der 1820er Jahre konzipierten Programmen auftrat, beschrieb ihn Hanslick als versteinerte Antiquität: mehr »eine werthvolle pompejanische Ausgrabung«, denn ein »lebendiger« Virtuose. Und Thalberg, dessen unübertrefflich kulti-
Repertoire und künstlerisches Profil
329
viertes Spiel in den 1830er Jahren als Musterbeispiel für hohe pianistische Qualität gerühmt worden war, spielte danach in der europäischen Musikszene keine Rolle mehr, weil er ausnahmslos seine eigenen Stücke darbot, die inzwischen niemanden mehr interessierten. »Er heuchelte nämlich weder Bach noch Beethoven. Thalberg spielte unbeirrt seine alten Opernparaphrasen [...] Bei der Leetüre seiner Concertzettel glaubte ich unter die Mumien gerathen zu sein«, so Hanslick maliziös (Concertwesen 2, S. 510). Spätestens seit Ende der 1860er Jahre gelang es, die Programmnummern beim Publikum durchzusetzen, die Clara Schumann für wertvoll hielt. Inzwischen vertraute man ihren Entscheidungen. Nach einem Konzert in Braunschweig 1876 zog der Rezensent folgende Bilanz: »Ihr Repertoire umfasste [...] das ganze Gebiet der Ciaviermusik, die Werke der altclassischen Meister und die aller späteren, welche sich bis in die neuere Zeit aus jenen entwickelt, bewährt und behauptet haben [...] Dabei darf die Künstlerin das Verdienst in Anspruch nehmen, die so Epoche machende Musik von Chopin und später auch von Schumann dem Verständnisse erschlossen und größeren Kreisen zugänglich gemacht zu haben. Bach, Beethoven, Mendelssohn, Chopin und Schumann sind auch jetzt noch die Bevorzugten ihres Repertoires« (Braunschweigische Anzeigen, 21. Januar 1876, in: J. M. Nauhaus). In einer explorativen Studie über Clara Schumanns Repertoire haben Reinhard Kopiez und Andreas C. Lehmann bestätigt, was der Künstlerin am Herzen lag: Robert Schumanns Kompositionen nahmen in der Gesamtsumme der von ihr gespielten Stücke den ersten Rang ein, gefolgt von Chopin, Mendelssohn Bartholdy, Beethoven, Bach und Schubert. Die Daten basieren auf einer Sammlung mit 1312 Programmzetteln aus 62 Jahren (1829 bis 1891), die heute im Archiv des Robert Schumann-Museums in Zwickau liegt. Diese Dokumentation künstlerischer Aktivität über fast das gesamte 19. Jahrhundert ist ein seltener Glücksfall, einmalig aufgrund des langen Zeitraums und der darin enthaltenen Datenfülle. Selbst wenn davon auszugehen ist, dass nicht alle Auftritte vollständig dokumentiert sind und das dort verzeichnete Repertoire in Einzelfällen vom tatsächlich gespielten abweicht, wie Vergleiche mit anderen Quellen belegen, so lassen sich daraus doch repräsentative Daten für Clara Schumanns Programmgestaltung herleiten. Spezifiziert man das gesamte Repertoire nach Ländern, so verschieben sich zwar einzelne Ränge, doch hielt Schumann die Spitze, gefolgt von Chopin. Eine Abweichung ergab sich für England (einschließlich Irland und Schottland). Dort rückte Mendelssohn Bartholdy an die zweite, Chopin hinter Beethoven an die vierte Position. Dabei dürfte die große Prominenz von Mendelssohn Bartholdy in England eine Rolle gespielt haben. Sie veran330
Handlungsreisende
lasste Clara Schumann offenbar dazu, seine dem Publikum bereits vertrauten Werke öfter aufzuführen als die von Chopin. In der von Ute Bär errechneten Auffuhrungsstatistik für das gemeinsame Repertoire von Clara Schumann und Joachim verlagert sich der Schwerpunkt. Hier rangiert Beethoven mit 108 Auffuhrungen uneinholbar an der Spitze, gefolgt von Schumann mit 45, Mozart mit 19, dann Haydn, Brahms und Bach (Bär 1999, S. 52). Dabei spielt die anders sortierte Auswahl der Literatur für Violine und Klavier beziehungsweise Klavierkammermusik eine Rolle. Doch bildet die Statistik indirekt auch noch einen weiteren Faktor ab, nämlich das Selbstverständnis der beiden Künstler. Clara Schumann und Joseph Joachim verfochten ein hohes Künstlerethos mit ausgeprägtem Sendungsbewusstsein. Öffentlich wollte er sich nur als »Priester des Allerschönsten u. Höchsten zeigen«, monierte Amalie Joachim, obwohl er damit sein Können, seine stupende Virtuosität gar nicht richtig demonstrieren könne (in: Borchard 2005, S. 502). Beethoven gehörte sicher zu den persönlichen Favoriten der beiden Künstler. Darüber hinaus zog seine Musik aber auch länderübergreifend in ganz Europa, und sie dürfte im nationalen Selbstverständnis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der prestigereichste musikalische Exportartikel gewesen sein, den Deutschland bot. Die Künstlerin blieb zwar als die Stimme von Robert Schumann im Gedächtnis, eine Rolle, die sie sich wünschte. Gleichwohl dürfte ihre musikhistorische Bedeutung zunächst in der Beethoven-Interpretin gelegen haben. Ihr Ruhm gründete vor allem auf dem durchschlagenden Erfolg der öffentlichen Aufführung von Beethovens Klaviersonaten in den späten 1830er Jahren. Die Künstlerin war schon als Kind mit Beethovens Musik aufgewachsen. Ihr Vater, der den »Meister« 1826 in W i e n gesehen hatte, hielt unverbrüchlich an dessen Musik fest. Im Leipziger Gewandhaus, einem zentralen Standort deutscher Beethoven-Rezeption in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hörte Clara neben ausgewählten Sinfonien 1829 ihre Mitschülerin und Auftrittspartnerin Emilie Reichhold mit dem fünften Klavierkonzert Es-dur op. 73. In Paris lernten die Wiecks 1832 nicht nur den französischen Beethoven-»Boom« kennen, sondern auch die außergewöhnlich hohe Qualität der dortigen Auffuhrungen. »Alles ist und schreiet jetzt hier - nur Beethoven«, so Friedrich Wieck (18. März 1832). Anfang der 1830er Jahre spielte Clara Wieck bei ihren eigenen Auftritten zunächst einzelne Sätze aus Beethovens Klaviertrio c-Moll op. 1 Nr. 3 oder das Rondo aus dem dritten Klavierkonzert c-Moll op. 37. Ab 1833 trat sie in semi-privaten Veranstaltungen und für »Kenner« organisierten Matineen oder Soireen dann mit vollständigen Stücken auf wie dem Klaviertrio B-Dur
Repertoire und künstlerisches Profil
331
op. 97 sowie den Violinsonaten A-Dur op. 47 (»Kreutzer«) und A-Dur op. 96. Von 1835 an nahm sie dann Klaviersonaten Beethovens in ihr Repertoire auf, um sie stückweise nicht nur in Expertenzirkeln, sondern jetzt auch in öffentlichen Konzerten einem allgemeinen Publikum vorzustellen. So entfachte sie bereits im Februar 1837 in Berlin einen Beifallssturm mit dem Andante und Finale aus der Klaviersonate f-Moll op. 57, deren komplette Darbietung in Wien im Januar 1838 Furore machte. Dazu gehörte auch ihre private Schwärmerei für Beethoven. Man besuchte in weihevoller Andacht das Grab, und Clara Wieck sandte Schumann bedeutungsträchtig eine Stahlfeder, die sie dort gefunden hatte (Bw, S. 157). Die aus heutiger Sicht nicht leicht nachvollziehbare Bedeutung der Begeisterung für Clara Schumanns Beethoven-Auffuhrungen rückt in ein anderes Licht, wenn man sich die zeitgenössische Situation vergegenwärtigt. Zwar löste der Name Beethoven in den 1830er Jahren ein ehrfurchtsvolles Raunen aus, doch wurden seine Werke tatsächlich nur sehr selektiv rezipiert. Im Leipziger Gewandhaus hörte man vor allem Sinfonien und Ouvertüren, seltener eines der Instrumentalkonzerte, wenn, dann das dritte und fünfte Klavierkonzert (Dörffel 1980, 1, S. 52). Charakteristisch für die frühe Rezeption Beethovens scheint gewesen zu sein, dass über ganz Europa verstreut in Einzelinitiativen Experten und Liebhaber seine Musik in privaten und semi-privaten Zirkeln pflegten. Dazu zählten etwa die Wiener Concerts spirituels, eine stabile »Association von Dilettanten«, die bis Ende der 1840er Jahre viermal jährlich in jedem Konzert wenigstens ein Werk von Beethoven brachten und dabei möglichst umfangreich das Gesamtwerk bekannt zu machen suchten. Allerdings litten die Aufführungen unter den geringen musikalischen Möglichkeiten der Mitglieder (Concertwesen 1, S. 307f). Professioneller waren die öffendichen Darbietungen im Leipziger Gewandhaus und vor allem in Habenecks Konzerten im Pariser Conservatoire, die die Wiecks 1832 hörten, sowie die kammermusikalischen Aufführungen vom Wiener Schuppanzigh-Quartett oder von Pierre Baillot und den Rombergs in Paris. Doch in der populärsten und innovativsten Sparte der Zeit, in der Klaviermusik, spielte Beethoven Anfang der 1830er Jahre nur eine untergeordnete Rolle. Während Beethovens drittes, viertes und fünftes sowie das d-Moll Klavierkonzert von Mozart (KV 466) dann seit Mitte der 1830er Jahre allmählich für das allgemeine Repertoire entdeckt wurden (Koiwa 2003, S. 39ff), trat keiner der damals gefeierten Virtuosen mit Beethoven-Sonaten aufs Podium. Die Gattung erschien nicht nur inzwischen obsolet, sondern auch ungeeignet für einen öffentlichen Vortrag. Beethovens frühe Sonaten galten als 332
Handlungsreisende
zu leicht, die mittleren als zu komplex, die späten als unverständlich. Nur auf Beethovenfesten erklang bisweilen die »Mondschein«- Sonate cis-Moll, op. 27 Nr. 2. Wilhelm Taubert ging damit unverdrossen auf Tournee und führte sie 1833 auch in Leipzig auf. Er lockte damit allerdings - laut Friedrich Wieck - niemanden hinter dem Ofen hervor (Jb, November 1833). Aufschlussreich im Blick auf Clara Wiecks späteren Erfolg sind hier Wiecks Argumente. Abgesehen davon, dass Tauberts Spiel ihm besonders fad erschien, hielt Wieck zu diesem Zeitpunkt Beethovens Opus 27 noch für zu leicht, um als Virtuose damit glänzen zu können. So etwas spielte man im Klavierunterricht. Fünf Jahre später, 1838, holte Clara Wieck mit ihren stürmischen Auffuhrungen der f-Moll Sonate op. 57 vor großem Publikum dagegen Beethovens Klaviersonaten aus der Spezialistenecke heraus. Nach der Aufführung des zweiten und dritten Satzes dieser Sonate hatten schon im April 1837 einige Stimmen gefordert: »Warum denn aber nicht die ganze Sonate?« (Freischütz, 8. April 1837). Sie wagte es. Vermutlich kam der Verleger August Heinrich Cranz aufgrund von Clara Wiecks aufregender Vorführung auf die Idee, Beethovens f-Moll Sonate op. 57 den bis heute gebräuchlichen Beinamen »Appassionata« aufzustempeln, als er 1838 eine vierhändige Version auf den Markt brachte. Clara Wieck hatte ab 1838 auch Beethovens »Mondschein«- und die »5/wrw«-Sonate (op. 27 Nr. 2; op. 31 Nr. 2) im Programm. Danach erweiterte sie ihr Konzert-Repertoire um die Sonata quasi unafantasia op. 27 Nr. 1, die A-dur Sonate op. 101, die »Pathétique« (op. 13), die frühe Es-Dur Sonate op. 7 und die »Waldstein«-Sonate op. 53. Das Londoner Publikum favorisierte Beethovens »Les Adieux«-Sonate op. 81a, und seit den 1850er Jahren führte sie auch die späten Sonaten (op. 106, op. 109, op. 110) nach und nach auf. Wie schwierig die Durchsetzung war, belegt eine Kritik in den Signalen von 1847, wo gemutmaßt wurde, dass das Publikum nur deshalb applaudierte, »weil dies ihm endlos erscheinende Stück«, die Appassionata, »nun endlich zu Ende wäre« (1847, S. 116). Als Clara Schumann im Neujahrskonzert 1857 in Leipzig erstmals Beethovens Eroica-Variationen op. 35 anbot, fieberte sie vor Aufregung. Doch dann erregte das Stück »einen Beifallsturm, wie ich ihn selten erlebt« (in: Litzmann 3, S. 17). Anfangs stiftete sie unter den Kolleginnen und Kollegen nur Liszt mit ihrem Beispiel an. Der hatte in Paris 1836 die Große Sonatefiir das HammerKlavier op. 106 vorgetragen und dann vor allem damit begonnen, Beethovens Sinfonien für Klavier zu bearbeiten. Liszt nahm in Wien die »Mondschein«und die As-Dur Sonate op. 26 in sein Repertoire auf (Dömling 1985, S. 49; Burger 1986, S. 104). Beide, Liszt wie Wieck, seien allerdings damals »ungleich sparsamer« mit Beethoven-Sonaten umgegangen als zehn Jahre später, Repertoire und künstlerisches Profil
333
so Hanslick. »Indeß von solchen Notabilitäten wirkt selbst das vereinzelte Beispiel mächtig« (Concertwesen 1, S. 333). Diesen Satz hat Brahms in seinem Exemplar von Hanslicks Schrift ausdrücklich markiert (in: GottliebBillroth 1935, S. 27). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich Beethovens Klaviermusik flächendeckend auf den internationalen Bühnen ebenso wie in Konservatorien und in der Hausmusik zu etablieren begann, setzte Clara Schumann neue Akzente. Ihre Aufführungen sollten etwas Besonderes bleiben. Daher spielte sie das dritte Klavierkonzert c-Moll op. 37 erst 1868 wieder vor großem Publikum. Sie hatte es seit 1838 mehrfach aufgeführt, dann aber ausgelassen, weil das mittlerweile populäre Stück »sehr abgedroschen« sei. Nun bot Clara Schumann mit ihren satzübergreifenden Kadenzen eine neue Interpretation. Bei Auslandsreisen nutzte Clara Schumann ihre Rolle als Beethoven-Spezialistin, um sich mit Beethovens fünftem und - ihrem zweiten Favoriten dem vierten Klavierkonzert in G-Dur op. 58 auf internationalem Parkett zu präsentieren. Europareisende wie der amerikanische Beethoven-Spezialist Alexander W. Thayer verbreiteten ihren Ruhm auch in Nordamerika (in: Reich 1999, S. 201). Inzwischen hatte sich das öffentliche Ansehen Beethovens entschieden verändert. Prägte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eher der »Sonderling« das Bild, das nicht zuletzt aus diversen Künstlernovellen dem belesenen Publikum vertraut war, so wurde Beethoven in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Galionsfigur und allgemeines Gütesiegel deutscher Musik auf den Sockel gehoben und zum Mythos verklärt (Geck, 2007, S. 32). Biografien wie die 1857 in französischer Sprache erschienene von Alexander D. Oulibicheff {Beethoven, ses critiques et ses glossateurs), die Hanslick ausführlich in der Wiener Presse besprach, von Adolf B. Marx (Ludwig van Beethoven, heben und Schaffen, 1859) oder Alexander Wheelock Thayer ( L u d w i g van Beethovens Leben, 1866), trugen zu einer verschärften Diskussion auch unter den Musikexperten bei. Von »der Größe Beethovens, von der glühenden Gottergebenheit [...], die aus ihm einen der rührendsten Märtyrer macht, die die Vorsehung zur Läuterung des Menschengeschlechts gesandt hat«, habe Oulibicheff »keine Idee«, so Joachim nach der Lektüre (Joachim 1, S. 419). Dem dürfte Clara Schumann zugestimmt haben. Jetzt wirkte sie daran, in ihren Programmen eine geistige Verwandtschaft zwischen Beethoven und Schumann zu behaupten. Dass er mal ein »2ter Beethoven« würde, hatte Clara Wieck schon 1839 gewünscht. Dafür »könnte ich Dich eine Secunde lang wirklich haßen«, lautete Schumanns prompte Zurückweisung damals (Bw, S. 343 und 368).
334
Handlungsreisende
Nach Liszts Abbruch der Virtuosenkarriere verfolgte Clara Schumann als eine der wenigen seit dem Vormärz bekannten Solisten ihre Mission unbeirrt weiter. Nicht nur in Paris, wo man Schumanns Musik »antipathique« fand, so Fetis (1972fF., S. 531), sondern auch in London, Wien und Berlin bedeutete ihr Vorgehen lange Zeit noch ein Wagnis. Eine Aufführung von Schumanns Liederkreis nach Joseph Freiherr von Eichendorff op. 39 mit Julius Stockhausen in Berlin im Januar 1869 verurteilte die Vossische Zeitung strikt: Schöpfungen, »welche die höchste Vertiefung und Abstraktion« verlangten, passten nicht in den öffentlichen Konzertsaal. Gerade diese Kulturmission prägte jedoch ihr unverwechselbares Image. »Man kommt hier nicht ein zweites Mal [her], um etwas Mittelmäßiges zu hören«, hatte die AmZ schon 1846 erläutert (Sp. 785). Clara Schumann habe sich nun »mehr der Musik im allgemeinen zugewandt« und suche sich »schon wieder neue Bahnen«, so Reilstab 1847. Es werden »allerdings nur würdige Werke, nur solche, die ein höheres Streben, einen Widerwillen gegen alles Flache und Leichtfertige ausdrücken, dargeboten« lautete seine zufriedene Bilanz sieben Jahre später. Im Jahr 1870 zog die Neue Berliner Musikzeitung dann das Resümee: »Vor der Hand ist uns Frau Schumann als Beethovenspielerin doch mehr werth, und wird's auch wohl bleiben, da wir in ihrem Spiel allen denjenigen Vorzügen begegnen, die allein aus dem Vorhandensein einer wirklich tief angelegten Künstlernatur resultiren« (Vossische Zeitung, 27'. Februar 1837,10. März 1847,12. Dezember 1854; Neue Berliner Musikzeitung 1870, in: Kat., S. 317).
Tempo! Geschwindigkeit und Interpretation An Fräulein »Clara Wieck, sehr schnell zu spielen«, adressierte Felix Mendelssohn Bartholdy am 2. Januar 1835 sein frisch komponiertes Lied ohne Worte E-Dur, das spätere op. 38 Nr. 3. Presto e molto vivace lautete das Tempo in der Druckausgabe von 1837. Im Februar sandte er noch das Es-Dur Stück op. 53 Nr. 3 hinterher. Nachdem sie zusammen auf Clara Wiecks 16. Geburtstag im September 1835 ein Capriccio am Klavier heruntergerissen hatten, schenkte er der Virtuosenkollegin nachträglich eine Abschrift seines Capriccio fis-Moll op. 5. Auch die Aufführung des furiosen Capriccio brillant h-Moll für Klavier und Orchester op. 22, das Clara Wieck unter seiner Leitung am 9. November 1835 im Gewandhaus vortrug, begeisterte ihn. »Denk Dir Fanny«, so Mendelssohn Bartholdy an seine Schwester, »bei Wiecks
Geschwindigkeit und Interpretation
335
Concert hörte ich meinem H-Moll-Capriccio zum ersten Male zu (Clara spielte es wie ein Teufelchen) und es hat mir sehr gut gefallen« (in: Litzmann 1, S. 90). Zum Jahresende 1835 sandte Mendelssohn Bartholdy ihr als Gruß und Erinnerung außerdem eine Abschrift seiner rasanten f-Moll Fuge op. 35 Nr. S,Allegro confuoco (Todd 2002, S. 769ff). Clara Wieck glänzte mit eigenen Stücken wie dem Impromptu. Le Sabbat (Allegro furioso) und der Caprice ä la Bolero (Presto) op. 5 Nr. 1 und Nr. 2. Hier trafen sich zwei Geschwindigkeitsspezialisten. Beide waren als Virtuosen in den 1830er Jahren berühmt für ihr stürmisches Temperament und den mitreißenden Temporausch, den sie zur Begeisterung des Publikums auf dem Klavier zu entfachen vermochten. Geschwindigkeit spielte im kollektiven Bewusstsein bereits eine Rolle, bevor die ersten Eisenbahnen in den 1830er Jahren durch Europa rollten und den Verkehr beschleunigten. Vor allem die Okonomisierung von Zeit in der beginnenden Industriegesellschaft hatte das Leben verändert. Sie bestimmte den Alltag. Zeit wandelte sich im Sprachgebrauch metaphorisch zu einer Art abstrakter Substanz, die man als Arbeitszeit quantifizierte und entsprechend belohnte. In diesem Sinne bedeutete Zeit eine verbrauchbare Ressource, und sie wurde wertvoll. Deswegen musste man damit sorgsam haushalten. Zeit zu sparen, »sinnvoll« mit ihr umzugehen, galt als zentrale Tugend, mit der sich das Bürgertum vom nutz- und tatenlosen »Ennui« der Aristokratie abgrenzte (Lakoff/Johnson, S. 79ff.; Borst, S. 131f). Begünstigt durch die Entwicklung immer kleinerer feinmechanischer Laufwerke baute man seit Anfang des 19. Jahrhunderts exklusive Uhren für den Privatgebrauch, die man in handlichen Formaten bei sich trug. Sie ermöglichten es, die Zeit individuell, unabhängig vom Angelusläuten oder der Turmuhr, genau zu kontrollieren. Die Kalkulation von Zeit bestimmte zunehmend das bürgerliche Leben. Dem setzten frühromantische Künsder zwar literarisch die Kategorie des Träumens entgegen. In ihrem bürgerlichen Alltag, als Juristen, Verwaltungsbeamte oder Lehrer, entgingen sie jedoch dem Rechtfertigungszwang über die verbrachte Zeit nicht. Von der »Davidsbündler«Runde der Leipziger Gaststätte Zum Coffe Baum, nämlich Schumann, Mendelssohn Bartholdy, Wilhelm Ulex, Moritz Reuter, Ernst Ferdinand Wenzel und Louis Rakemann, hatte bekam Clara Wieck zum 16. Geburtstag 1835 eine goldene Taschenuhr geschenkt bekommen, die sie offenbar lebenslang an einer Kette bei sich trug, wie auf mehreren Fotos zu sehen ist. Das Messen von Zeit entfaltete eigene Bedeutungsmuster und Werte. Im Nützlichkeitsdenken der bürgerlichen Schicht erstreckte sich die Kontrolle über die Zeit auf den gesamten Tagesablauf, einschließlich der neu entstandenen Kategorie »Freizeit«. Im Sport begann man ab etwa 1825, zielgerich336
Handlungsreisende
tete Geschwindigkeitsleistungen mit Stoppuhren exakt zu messen, kompetitiv zu bewerten und die Steigerungen zu prämieren (Borst 2004, S. 130). Das aktuelle Zeitgefühl, die neuen Technologien und die damit verbundene Ideologie der Beschleunigung imitierten und persiflierten die Musiker schnell. Stücke wie Wettrennen-Galopp op. 29a (1829), Eisenbahn-Lmt-Waher op. 89 (1836), Ball-Racketen op. 96 (1837), Musikalischer Telegraph op. 106 (1839) von Johann Strauß oder Chopins so genannter »Minuten-Walzer« op. 64 Nr. 1 (1847) entstanden parallel zu den im Presto dahin jagenden Charakterstücken von Schumann oder Mendelssohn Bartholdy. Geschwindigkeit verknüpfte man im Vormärz mit der Vorstellung von Aktivität und Produktivität, aber auch mit Jugend- und Geniekult. Geschwind zu sein, schnell zu reagieren, etwas rasch zu erledigen, war daher überwiegend positiv besetzt. Nach dem Tod von Goethe und Hegel, von Beethoven und Schubert begriffen sich die Zwanzigjährigen als diejenigen, die neues Leben in die Kunst brachten, und zwar schwungvoll. Allein die vom Rezensenten Schumann formulierten Texte wimmeln von einschlägiger Flug-, Aufbruchs- und Angriffsmetaphorik. Das Empfinden von Beschleunigung erfasste über die verkehrstechnischen Aspekte hinaus das soziale und das politische Leben in der Zeitspanne zwischen den europäischen Revolutionsjahren 1830 und 1848/49. Das alles stärkte die Uberzeugung, in einer sich schnell ändernden Welt zu leben, und es beeinflusste das gefühlte, individuelle Lebenstempo der jüngeren Künstler, nämlich den Fortschritt voranzutreiben. Dafür standen selbst gewählte künstlerische Positionsbestimmungen wie das erst durch das Verbot verschiedener Schriften 1835 zur Gruppe zusammengefasste Junge Deutschland und parallele Strömungen wie die Jeune France, Giovine Italia oder dasjunge Europa der Schweiz. Musikalisch eroberte man die Zukunft im stürmischen Zugriff. Die Klavierschulen von Logier, Hummel oder Czerny lehrten die dafür notwendigen technischen Voraussetzungen, nämlich schnell und gleichmäßig zu spielen, mit der mechanischen Präzision einer Maschine. Das seit 1813 eingesetzte Metronom von Johann Nepomuk Mälzel sollte das gleichmäßige Spiel unterstützen. Die damit bestimmbare exakte Ausführungszeit formte auch die mechanischen Bewegungselemente und Ablaufmuster im instrumentalen Kompetenzerwerb. Nach und nach durchdrangen standardisierte Zähleinheiten in Schlägen pro Minute die alte Vortragsrhetorik. Das beabsichtigte Tempo eines Allegro oder Andante ließ sich nun mit Hilfe der Skala des Metronoms präzisieren. Flinke Finger zu haben, galt allgemein als Kompliment. Nur sie ermöglichten ein brillantes Spiel. »Zum Virtuosenthum gehört Jugend«, so zitierte Hanslick den 63jährigen Liszt, als der sich 1874 mit einer
Geschwindigkeit und Interpretation
337
Soutane bekleidet in Wien wieder auf den Klavierhocker schwang (Hanslick, Concerte, Componistert und Virtuosen der letzten ßinfzehn Jahre 1870-1885, S. 121). Dass er immer noch sein Publikum zum Jubeln hinriss, war nicht nur ein begnadetes Privileg, sondern auch ein beeindruckendes Zeugnis von konstanter Leistungsfähigkeit bei entsprechendem Training. Nicht zuletzt aus diesem Grund legte auch Clara Schumann lebenslang Wert darauf, ihre Schnelligkeit am Klavier zu erhalten. Ein Stück weit dürfte sie gerade damit den Eindruck von »Frische« und »Jugendlichkeit« verbreitet haben, den Rezensenten auch noch am Spiel der betagten großen Dame bestätigten. In die Klavierkompositionen floss Geschwindigkeit aber nicht allein als virtuoses Element ein, sondern auch als Ausdrucksqualität wie das rasante Tempokonzept in Schumanns zweiter Klaviersonate op. 22 beispielhaft zeigt. Der Kopfsatz beginnt so rasch wie möglich. Es folgt ein getragenes Andantino als Atempause vor einem sehr rasch und markiert (rnolto presto e marcato) zu spielenden Scherzo und dem Rondofinale im presto. Dessen strettahafter Schluss enthält die berühmt-berüchtigte und realiter undurchführbare Spielanweisung prestissimo, gefolgt von der Aufforderung, immer schneller und schneller zu werden. Im Sonaten- oder Zykluskonzept funktionierte die ästhetische Kategorie »Geschwindigkeit« besonders durch das Gegengewicht langsamer, liedhafter Sätze, die dem Ausdruck von Innigkeit und Gefühl gewidmet waren. Dafür bot nicht nur Schumanns Klaviermusik, sondern auch die von Chopin, Mendelssohn Bartholdy oder Clara Wieck reiches Anschauungsmaterial. Die Künstlerin war in den 1830er Jahren felsenfest davon überzeugt, dass die Uhren jetzt schneller tickten als zur Zeit Beethovens. Als die Wiecks am 3. Dezember 1837 im Wiener Großen Redoutensaal die siebte Sinfonie A-Dur op. 92, »ausgeführt in den Tempi's wie sie Beethoven genommen«, hörten, fragten sie: »Würde er sie jetzt, lebte er noch, nicht auch anders nehmen?« Den Wiecks verlief das alles zu gemächlich. »Hier sollte Mendelssohn herkommen«, wünschten sie sich (Jb, 3. Dezember, 1837). Dessen zügige Beethoven-Dirigate im Leipziger Gewandhaus fanden nicht bloß die Wiecks genial, sondern sie prägten insgesamt Mendelssohns KünstlerImage. Auch Clara Wiecks hart am Limit gewählten Tempi bei der Vorführung von Beethovens und Schumanns Klaviermusik beruhten auf dem aktuellen Zeit- und Lebensgefühl dieser Jahre, bei dem Geschwindigkeit mit Fortschrittsutopien verbunden war. Als sich die Zeitauffassung in den 1840er und 50er Jahren allmählich zu ändern und das Tempo auch der schnellen Sätze offensichtlich nachzugeben begann, häuften sich die Kritiken an Clara Schumanns »Tastenstürmerei«. 338
Handlungsreisende
Mit ihrer »Feuerseele« habe sie sich »zu einem überstürzten Tempo hinreißen« lassen und dadurch den »Charakter einzelner Tonstücke« beeinträchtigt, fand ein Wiener Kritiker 1859. Selbst Mendelssohn Bartholdys Variations sérieuses op. 54 gerieten dem Rezensenten der Signale 1863 zu schnell. In »Hast und Eile« raste auch Schumanns Klavierquintett op. 44 »wie im Fluge« am Ohr vorbei (in: de Vries 1996, S. 216ff). Allerdings hörten manche es ganz anders: »Mit welcher Weihe und Innigkeit ihrer edlen Auffassung Frau Schumann diese Sachen [Schumanns Quintett op. 44, Mendelssohn Bartholdys Variations sérieuses op. 54 und Beethovens Sonate op. 101] verdolmetscht, kann mit der Sprache todter Zeichen kaum gesagt werden; nennen wir's Verkörperung des Gefühlslebens« (Blätter für Musik, Theater und Kunst, Januar 1856 in: Kat., S. 130). Schon ihr Mann hatte hin und wieder ihr zu schnelles Spiel missbilligt und damit handfeste Krisen ausgelöst. So überliefert Sabinina eine Szene, in der der Komponist nach einer Probe in Düsseldorf am 3. November 1850 »wegen zu schneller Tempi« seinen ganzen »Zorn [...] über sie« ergoss. »Sie war verzweifelt und weinte bitterlich«. Dann schickte sie alle aus dem Saal und probte noch einmal allein, um sich zu korrigieren. »Ich bin so eine Pedantin, die sonst nicht spielen kann«, erklärte sie ihrer Schülerin (in: Lossewa 1997, S. 208ff). Ende der 1850er Jahre empfand Hanslick, der Clara Schumann 1846 zum ersten Mal gehört hatte, »ihre Neigung zur Beschleunigung der Tempi allzusehr vorgeschritten«. Er argumentierte, dass zwar alles »deutlich hörbar« bleibe, aber die »Aufnahmefähigkeit« selbst »musikalisch gebildeter Hörer« in ihrem »sturmwindähnlichen Vortrag« von Schumanns D-Dur Novellette op. 21,2 überschritten werde. Dadurch verhindere sie ein Verstehen. »Der Hörer fühlt sich doch durch die Anstrengung, nachzufolgen, ermüdet, und behält vielleicht ein Vorurtheil gegen die Composition« (Hanslick, Sämtliche Schriften 1,4, S. 377). Ein ernst zu nehmender Einwand. Folgt man Hanslicks Ansicht, dann hätte Clara Schumann mit ihrem Tempo genau das Gegenteil dessen erreicht, was sie eigentlich wollte. War es ihr doch darum gegangen, Verständnis für die Werke zu wecken. M i t dieser Meinung stand Hanslick nicht allein. Noch gravierender erschien der Vorwurf, sie missachte mit ihren rasanten Auftritten die »Intention des Componisten«, den ein Kritiker in der Niederrheinischen Musikzeitung 1863 erhob (in: de Vries 1996, S. 218). Hatte denn der Komponist Schumann nicht den Superlativ äußerst rasch über seine D-Dur-Novellette geschrieben? Wenn die Virtuosin nun so schnell spielte, wie ihre Finger zuließen, erfüllte sie die Vortragsangabe und sollte doch gegen die Autorenintention verstoßen? Viele Klavierstücke enthielten derartige Bezeichnungen. Auch das Finale der Ap-
Geschwindigkeit und Interpretation
339
passionata sah eine Steigerung vom Allegro ma non troppo über semprepiü allegro bis zum Presto vor. Und Carl Czerny gab 1842 in seiner Schrift Uber den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven'schen Klavierwerke sogar preis: »In der Geschwindigkeit der Scalen Doppeltriller, Sprünge, etc. kam ihm keiner gleich /: auch Hummel nicht:/« (Czerny 1963, S. 22). Da Beethoven nur einen kleinen Teil seiner Werke metronomisiert hat, bleibt das Tempo seiner Sätze bis heute eine immer wieder neu zu diskutierende Frage der Auffiihrungspraxis. Im Chor kritischer Stimmen am überhöhten Tempo vermischten sich unterschiedliche Argumente. Wie die Freunde um Anton Schindler 1838, so missbilligte auch noch Adolf Bernhard Marx in seiner Beethoven-Biografie von 1859 grundsätzlich öffentliche Aufführungen der Klaviersonaten und verurteilte sie mit moralischer Strenge. Seiner Auffassung nach sei für die krasse Verzerrung vor allem der Egoismus der Virtuosen verantwortlich, weil sie die »Beethoven'schen Sonaten in den zerstreuungsvollen Concertsaal« verpflanzt und, als wäre das nicht schon unangemessen genug, sie aus Gründen virtuoser Schau das rasende Tempo populär gemacht hätten. »Die meisten sind zu innerlichen Inhalts, zu sehr auf Sammlung des Gemüths und stille Versenkung in ihr ideales Leben hingewiesen, als daß sich im Ausfuhrenden und in den Zuhörern stets die rechte Stimmung voraussehn ließe« (in: de Vries 1996, S. 217). Hier wurden die Pioniere Clara Wieck Schumann und Liszt angegriffen, ohne sie beim Namen zu nennen. Nach Claudia de Vries lösten die beiden offenbar einen Trend zu überrissener Geschwindigkeit aus. Hanslick sorgte sich vor allem um das Werkverständnis und die Aufnahmefähigkeit der Zuhörer. Jede einzelne Sechzehntelfigur sollte hörend nachvollzogen werden können. Es reiche nicht, wenn die Virtuosin generell die Idee »äußerst rasch« vorführe. Seine Argumentation zielte auf ein verändertes Aufführungskonzept. Inzwischen hatte sich der Fokus von der allgemeinen Kunstpräsentation auf das einzelne, ausgewählte Stück als eigenständigem Kunstwerk verlagert. Daran arbeitete die Virtuosin hart. Nur gelegentlich erhält man einen Einblick, wie gründlich Clara Schumann zu dieser Zeit ihre eigene Position hinterfragte. Immerhin bat sie Joachim 1857 eindringlich, seine Bedenken gegen ihre Auffassung von Beethovens D-Dur Sonate op. 28 (»Pastorale«) direkt auszusprechen und nicht aus Angst, »weil ich es doch übel nehmen würde« oder in »Thränen« ausbräche, zurück zu halten. Erst im Expertengespräch könne überprüft werden, was sie »mit aller Hingebung der Seele« allein einstudiert und womöglich »doch nicht recht erfaßt« hätte. Jetzt habe sie Beethovens Sonaten op. 109 und op. 110 erarbeitet, »mit höchstem Genüsse«, denn die Stücke seien ihr »ganz wunderbar 340
Handlungsreisende
klar« erschienen. Tatsächlich hatte sie sie schon ein Jahr zuvor ins Repertoire übernommen. »Geben Sie mir die Hand darauf, daß Sie mir künftig Alles offen sagen, und flösse ich gleich in Strömen dahin« (Joachim 1, S. 464f). Die hier zitierten Einwände gegen das Tempo der Virtuosin zielen auf die auffuhrungspraktische Seite der Verschiebung einer neuen Werkästhetik, die in kunsttheoretischen Diskursen zwar längst als vollzogen galt, sich aber in der Konzertpraxis noch keineswegs durchgesetzt hatte. Dass das Kunstwerk nicht zur Erbauung des Publikums da sei, sondern umgekehrt das Publikum sich versammle, um das Kunstwerk zu bestaunen, hatte Karl Philipp Moritz schon 1788 behauptet (in: Dahlhaus 1988, S. 32). Auch Robert Schumann formulierte gelegentlich, man ginge »viel zu delicat« mit dem Publikum um, das von ferne zuhören und froh sein dürfte, überhaupt »etwas aufzuschnappen vom Künstler« (GS 1, S. 127). Nun, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, drang diese exklusive kunsttheoretische Vorstellung ins allgemeine Bewusstsein vor. Daraus erwuchs an die Virtuosen die Forderung, ihre staunenswerte Artistik radikal in den Dienst des Kunstwerks zu stellen und nicht länger als Eigenwert zu vermarkten, wie ein schon seit dem 18. Jahrhundert immer wieder erhobener Standardvorwurf lautete. Als ob sich das so einfach trennen ließe. Vielmehr rückten neue Performanzkriterien in den Vordergrund, nämlich Nachvollzug der Autorenintention und Deutlichkeit der Darstellung. Dazu zählten indessen neben der Artikulation auch eine unterstützende Mimik und Gestik. Die Musik wurde auf der Bühne zwar von den Aufführenden verkörpert. Was dort erklang, galt als einmalig und authentisch. Dennoch war es die originelle musikalisch-poetische Sprache der Komponierenden, die sie artikulierten. Wie in der Literatur musste diese Stimme nicht unbedingt mit der des Autoren-Ichs identisch sein. Idealerweise hätte der darstellende Körper auf der Bühne nichts Persönliches mehr, sondern er wäre bloß Medium, um das Zeichensystem der Partitur zu verdolmetschen (Dahlhaus 1987, S. 60fF.; Fischer-Lichte 2004, S. 129ff). Im Sinne der Auffiihrungstheorie hatte Musik allerdings keine andere Stimme als die der Ausfuhrenden, die man auf der Bühne sah. Dass es schwierig war, den visuellen Eindruck zu ignorieren, besang Goethe in seinem Widmungsgedicht Aussöhnung. Er schrieb es der Virtuosin Maria Szymanowska ins Stammbuch. Ihm war es nämlich 1823 bei ihrem Auftritt in Karlsbad nicht gelungen, die musikalische Wirkung der Stücke (gespielt wurde Beethoven, Klengel und Szymanowska) von den erotischen Wallungen zu trennen, die die Spielerin in ihm auslöste: »Da fühlte sich - o daß es ewig bliebe! - / Das Doppelglück der Tone wie der Liebe« (Werke 1, S. 209). Geschwindigkeit und Interpretation
341
Moderne Testserien untermauern das Phänomen. Ein von Klaus-Ernst Behne 1987 durchfuhrtes Experiment hat ergeben, dass die visuellen Informationen während einer Performance fiir Experten wie Laien sogar stärker wirkten als die akustischen. Im Versuch unterlegte man Videos von je zwei musizierenden Paaren (zwei Frauen bzw. zwei Männer) mit demselben Soundtrack. Die Probanden waren erstens mehrheitlich davon überzeugt, verschiedene Interpretationen gehört zu haben, und sie fanden zweitens mehrheitlich die der Spielerinnen »dramatischer«, die der Spieler »präziser«. Weitere Studien haben derartige Befunde über den visuellen Einfluss bestätigt (Behne 1994, S. 9ff.; Kopiez 2004, S. 217). Das Resultat stimmt nachdenklich in Bezug auf die Evaluierung der Urteile über Clara Schumanns Spiel. Von heute aus lassen sich die Relationen zwischen den rhetorischen Vortragsangaben wie presto und den literarischen Bewertungen von Clara Schumanns Tempi nicht mehr überprüfen. Stattdessen können nur Hypothesen diskutiert werden. So vermutet Claudia de Vries, die sich eingehend mit den Tempokonzepten Clara Schumanns befasst hat, dass die in den 1850er und 60er Jahren gespielten leichtgängigen Flügel der Düsseldorfer Firma Klems beziehungsweise die Wiener Flügel von Streicher einen Einfluss auf das Spieltempo ausgeübt hätten (de Vries 1996, S. 218ff). Dieser Zusammenhang wird durch Zeitzeugnisse immer wieder bestätigt. Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man die Ergebnisse systematischer Experimente zum Tempoverhalten aus dem 20. Jahrhundert heranzieht. Danach zeigten die während verschiedener Konzerttourneen gemessenen Interpretationen ausgewählter Musikerinnen und Musiker insgesamt eine hohe Tempokonstanz, trotz unterschiedlicher Auffuhrungsbedingungen. Nach Wolfgang Auhagen bestätigen sie die Vermutung, dass Interpreten über einen »internen Zeitgeber« verfügen. Er werde mit der Automatisierung von Bewegungsabläufen beim Einstudieren der Stücke erworben und funktioniert offenbar unabhängig von der spezifischen Aufführungssituation (in: de la Motte / Rötter 2005, S. 246ff). Obwohl Metronom und Stoppuhr den Komponierenden ermöglichten, ihre Tempovorstellungen exakt festzulegen, verlaufen weder die zeitliche Reproduktion der Musik noch die dabei erlebte Zeit »objektiv«. Komponenten wie die Satztechnik, die rhythmische Komplexität der Einzelstimmen oder harmonische und melodische Bildungen beeinflussen die gewählte Geschwindigkeit der Interpreten wie auch die Zeitwahrnehmung der Hörer. Auch eine spezifische Kontextualisierung des gespielten Satzes oder Stücks wirkt auf das Tempoempfinden. Außerdem entwickeln sowohl die Interpreten als auch die Hörer über einen allgemeinen Konsens hinaus eigene, 342
Handlungsreisende
subjektiv beeinflusste Tempokonzepte. Sie beruhen auf physiologischen, biochemischen, psychischen und psychomotorischen Faktoren. Dabei spielt auch das Lebensalter eine Rolle. Uberträgt man diese allgemeinen Ergebnisse heutiger Forschung auf Clara Schumann, dann muss davon ausgegangen werden, dass das Spieltempo der Virtuosin zwischen 1835 und 1859, ihrem 16. und ihrem 40. Lebensjahr, objektiv keinesfalls schneller, sondern eher etwas langsamer geworden sein dürfte. Neben altersbedingten Faktoren wirkten sich vermutlich die deutlich reduzierten Ubezeiten während der Familienbildungsphase aus, in der die Möglichkeiten für ein Fingertraining sicher erheblich knapper ausfielen als in der Teenagerzeit. Aufschlussreich erscheint eine Relation zwischen Tempowahrnehmung und gespieltem Repertoire. So ergaben Studien von Helga de la Motte-Haber und Günther Rötter, dass die Impulsdichte eines Rhythmus und dessen interessante Gestaltung das Geschwindigkeitsempfinden steigerten. Hohes Tempo wurde von Probanden des späten 20. Jahrhunderts darüber hinaus mit »männlich« und »intelligent« gleichgesetzt (in: Rötter 1998, S. 465ff). Ob diese semantischen Zuordnungen auch für das historische Publikum galten, bleibt zwar fraglich. Im Fall des Spieltempos ergeben sich zumindest auffällige Ubereinstimmungen zwischen den Ergebnissen neuerer empirischer Studien und dem Pressespiegel von Clara Schumanns Auftritten. Sie lassen sich hypothetisch nutzen. Dass Beethoven-Sonaten oder Robert Schumanns Novellette op. 21 Nr. 2 extrem schnell wirkten, könnte ein Stück weit von deren rhythmischer Komplexität beeinflusst worden sein. Die im zeitgenössischen Pressespiegel mehrfach genannten Charakterisierungen der Virtuosin als »männlich« und »intellectual player«, die sich ja auf ihr Spiel, nicht auf ihre Person beziehen, dürften nach Kriterien heutiger Experimente mit einem hohen Tempo zusammenhängen, während die Differenz zwischen der äußeren Erscheinung und dem Gehörten den Eindruck eines »unpassenden«, mit »männlich« konnotierten Tempos verstärkt haben könnte. Außerdem spielte noch ein weiterer Faktor eine Rolle, nämlich die Art der Artikulation. Nach de Vries und Auhagen beeinflusst sie ebenfalls die Tempowahrnehmung, ein Phänomen, das de Vries in ihren Interpretationsanalysen von Clara Schumann-Schülerinnen und Schülern anschaulich beschreibt (de Vries 1996, S. 256ff.; Auhagen 2005, S. 232ff). In diesem Punkt zeichnete sich die Virtuosin offenbar durch eine strikte Haltung aus. So trieb sie Moscheies permanent zur Eile an, als sie mit ihm 1850 Schumanns Bilder aus dem Osten op. 66 aufführte, was ihren Mann »sehr erzürnte«. Clara Schumann fand dagegen Moscheies »unausstehlich«, »da er alle Augenblicke ein fürchterliches Ritardando« mache Geschwindigkeit und Interpretation
343
(in: Litzmann 2, S. 203). »Dem noch immer herrschenden Missbrauch des tempo rubato stellt sie eine fast ausnahmslose Strenge des Taktes entgegen«, so Hanslicks Analyse von Clara Schumanns Chopin-Interpretationen. »Der metronomgleiche, sogar im Basse scharf markirte Vortrag [...] wird manchen überrascht haben«. Ihre »streng einheitliche, männliche Auffassung, die das Ganze nicht durch schmachtendes Verweilen auf den kleinlichsten Einzelheiten unterbricht«, setzte er lobend »gegen jedwede falsche Sentimentalität«, rühmte auch ihr Spiel als »klar, scharf, wie eine Bleistiftzeichnung« und wünschte sich dennoch etwas mehr Nachsicht (Hanslick, Sämtliche Schriften 1,4, S. 377). Denkbar wäre, dass die Virtuosin als junge Witwe darum bemüht war, möglichst unsentimental aufzutreten und deshalb eine sehr strikte Auslegung des Tempo rubato wählte. In dieser Phase stand ihre »schicksalhafte« Biografie besonders im Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Vielleicht sollte das mitfühlende bis voyeuristische Interesse daran nicht noch durch sentimentale Darbietungen verstärkt werden. Manchmal wirken jedenfalls die Zeitzeugnisse so, als hätte sich Clara Schumann einen Panzer umgelegt, um sich vor allzu viel Anteilnahme zu schützen. Daher erschien sie mitunter sehr »kühl«. Clara Schumann selbst war von ihren raschen Tempi überzeugt. Sie gehörten nach ihrer Auffassung offenbar ästhetisch wie emotional zum Charakter beziehungsweise zum Ausdruck der Kompositionen dazu. Dabei dürften neben analytischen auch lebensweltliche und biografische Komponenten eine Rolle gespielt haben. So verband sie das »sturmwindähnliche« Tempo (Hanslick) sicher mit ihrem Beethoven-Bild insgesamt. Gleichzeitig evozierte sie damit womöglich die kreative Atmosphäre ihrer eigenen Jugend. Die öffentliche Auffuhrung der Appassionata in Wien erfolgte 1837/38 vor dem Hintergrund der euphorischen Aufbruchsstimmung an der Schwelle einer neuen, »poetischen« Zeit. Deren Musik komponierte Robert Schumann in seinen frühen Klavierwerken. Und der Virtuosin lag offenbar daran, diese den Stücken inhärente poetisch-politische Dynamik auf dem Podium immer wieder neu zum Leben zu erwecken. Außerdem wählte die Virtuosin auch als Vierzigjährige keineswegs einen rationalistisch-analytischen Zugang, wie ihre kühle Strenge vermuten ließe, sondern sie legte es durchaus darauf an, mit einem Temporausch Enthusiasmus zu entfachen und das Publikum aus der kontrollierten Reserve zu locken. So antwortete sie auf eine Kritik Selmar Bagges 1856, sie fände den Tadel an ihrer Tempowahl »zuweilen« zwar berechtigt. Doch spiele sie eben »selten ohne Inspiration«, und »wie leicht läßt man sich dadurch fortreißen«. Allerdings, so schob sie selbst zerknirscht nach, »der Künsder soll immer Meister 344
Handlungsreisende
seiner Gefühle sein, wie der schön-ruhige Mensch im gewöhnlichen Leben!« (in: Reich 1991, S. 373). Ein braver Vorsatz. Ende der 1850er Jahre konnte Clara Schumann bereits auf ihre eigene, persönliche AufRihrungstradition zurück blicken. Sie hatte sie sozusagen in den Fingern und im Gedächtnis gespeichert. Allerdings musste die Künstlerin erleben, dass ihre Auffassung mit der Anderer in Konflikt geriet, zumindest in den deutschen Ländern. Der Kontext hatte sich insgesamt verändert. Je rosiger sich in der kollektiven Erinnerung die politisch brodelnde, unstete Zeit des Vormärz zur »altdeutschen« Gemütlichkeit verklärte, desto unpassender erschienen die reißerischen Tempi. In Paris spielte man 1862 dagegen Beethoven nach wie vor sehr rasch, wie Clara Schumann nach einer Aufführung der vierten Sinfonie op. 60 im Conservatoire begeistert festhielt. »Den letzten Satz habe ich nie in einem solchen Presto gehört, und in welcher Vollendung!« Trotzdem empfand sie die Darbietung als »kalt«. »Denke mal«, schrieb sie Brahms, »was ließe sich wohl mit diesem Orchester machen, wenn da Feuer hinein käme! Da müssten die Wände erzittern und die Menschen umfallen«. Ein wenig davon schien ihr bei ihrem eigenen Auftritt mit Beethovens fünftem Klavierkonzert op. 73 dann gelungen zu sein. »Es gab einen Beifallssturm [...] Außer in Wien habe ich solche Aufnahme nirgends gefunden - daß mir das wieder eine frische Anregung ist, glaubst Du gewiß«. Der Rezensent der France Musicale bestätigte diesen positiven Eindruck allerdings nicht, da ihm weder die Pianistin noch Beethovens Konzert gefielen (Schumann-Brahms 1, S. 394ff.; Wittkowski, in: Kat., S. 157ff). Wenn Hanslick den Virtuosen, »die überall das Hervorkehren ihrer Subjectivität und die Geltung ihrer Bravour im Auge« hätten, als Vorbild die wahrhafte »Tonkünstlerin« Clara Schumann entgegenhielt, dann, weil er trotz kritischer Einwände ihr hohes Künstlerethos über alles schätzte (Hanslick, Sämtliche Schriften 1,4, S. 376). Es äußerte sich nach seiner Ansicht nicht bloß in ihrem bescheidenen Auftrittsverhalten, sondern vor allem in ihrem Verhältnis zum Werk, in »Objectivität« und Textreue. Die Schumann vertrat damit ein Ideal des neuen Interpretentyps im künstlerischen Realismus der Gründerzeit. Zwar ist historisch kein Bezeichnungswechsel vom »Virtuosen« zum »Interpreten« verbürgt (Hinrichsen 1999, S. 9ff). Doch lässt er sich nutzen, um den Umwertungsprozess von Musik als autonomer Kunst auf dem Konzertpodium zu beschreiben. Interpretation bezeichnet die dolmetschende Vermittlung eines Zeichensystems. Ephemere Künste, wie Tanz oder Musik, die im Moment ihrer Aufführung erst sinnlich erfahrbar entstehen, erschaffen jede Aufführung als individuelles einzigartiges Erlebnis. In der quasireligiösen WerkauffasGeschwindigkeit und Interpretation
345
sung klassisch-romantischer Musik bedeutet Interpretieren das Verstehen und Auslegen eines verborgenen Sinns (Gatzemeier 2004, S. 273ff.; Danuser 1992, S. lff). Allerdings existiert das erst im Erklingen in Raum und Zeit entstehende und in der Erinnerung zusammengefügte musikalische »Meisterwerk« nur metaphorisch als ein zu interpretierendes Objekt. Sein physikalisches Material bilden bekanntlich Schallwellen, die aufgrund einer instrumentalen Umsetzung von Notenzeichen ausgelöst werden. Es bedurfte noch vieler Schritte, bevor dessen Existenz auch im wirklichen musikalischen Berufsleben als Wert besiegelt und im juristischen Sinne als Gut definiert werden konnte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Materialisierung der emphatischen Werkidee hauptsächlich aus zwei Richtungen unterstützt. Einmal wertete man die Partitur als Text auf, und zum zweiten erkannte man juristisch einen musikalischen Entwurf als schützenswerte geistige Leistung an. Lange Zeit war durchaus umstritten, ob die Noten bloß eine Spielanleitung wiedergäben oder nicht doch schon die Idee des Kunstwerks enthielten. Traf das erste zu, dann stellte die Partitur nur ein Zwischenträgermedium dar, das zur Erzeugung des immateriellen Kunstwerks benutzt wurde. Der zurückbleibende materielle Güterwert lag in den Kupferplatten, auf die die Noten gestochen wurden, und den zum Stückpreis verkauften gedruckten Exemplaren, während Entwurf und Präsentation von Musik wie Dienstleistungen zählten. Dementsprechend wurde Musik nach konkretem Vollzug bezahlt, der Entwurf nur einmal, an die Komponierenden, die musikalische Realisierung nach jeder öffentlichen Darbietung an die ausfuhrenden Musiker. Der Wunsch nach einer höheren Bewertung der Komposition als autonome Kunstleistung und schützenswertes geistiges Eigentum richtete sich nicht allein auf das künstlerische Prestige, sondern enthielt auch merkantile Interessen. Komponierende wollten von den Erfolgen ihrer Werke selber profitieren, statt sie durch Raubdrucke oder Plagiate zu verlieren und den Gewinn den Virtuosen zu überlassen. Im juristischen Disput um die Anerkennung eines musikalischen Urheberschutzes, den Friedemann Kawohl aufgerollt hat, spielte die verbindliche Definition von Noten als Buchstaben adäquaten Zeichen eine wichtige Rolle. Noch 1844 entschied das sächsische Landesrecht dagegen. »Musicalische Compositionen gehören zu litterarischen Erzeugnissen nicht; die hier zur Versinnlichung der geistigen Erstrebung dienenden Mittel, die Noten, sind Zeichen, keine Schrift« (in: Kawohl 2002, S. 113). Doch erst die Gleichsetzung sicherte den Kunststatus der Partitur über eine Spielanweisung hinaus. Von Büchern galt Anfang des 19. Jahrhunderts bereits, dass ihre Schriftzei-
346
Handlungsreisende
chen Ideen enthielten. Dem entsprachen ihr Ansehen und ihr hoher Marktwert, den der mächtige Börsenverein des deutschen Buchhandels auch zäh verteidigte. Ein weiteres Argument, um den schriftadäquaten Status von Notation zu stützen, lieferte die Behauptung, dass Musik durch Töne spreche und Ideen ausdrücke, die auch ohne die klingende Realisierung bereits in der Notenschrift enthalten seien. Hier lag ein Konzept von Musik als einem kommunikativen, sprachanalogen Medium zugrunde, dessen Semantik über eine wortsprachliche Codierung hinausreichte. Die seit dem frühen 18. Jahrhundert immer wieder verwendeten Metaphern »Klangrede« beziehungsweise »Musik«- oder »Tonsprache« begriffen sowohl die klanglichen als auch die strukturellen Komponenten von Musik ein. Die Sprachmetaphern galten daher für die empfindsame Vorstellung eines unmittelbaren Gefuhlsausdrucks ebenso wie für den frühromantischen Unsagbarkeitstopos von Musik als metaphysischer Kunst und für das Autonomiekonzept, nachdem ein musikalischer Gedanke nichts anderes als sich selbst ausdrückt (Dahlhaus 1988, S. 310ff). Adolf Bernhard Marx lieferte wichtige Argumente in diesem Diskurs. Seit den 1820er Jahren verfolgte er die Idee eines abstrakten Begriffs von Form als geistigem Eigentum. Diesen Formbegriff, von dem er annahm, dass er allgemein und unabhängig vom erklingenden Einzelwerk als musikalische Idee existiere und sich als geistiges Produkt in der Partitur niederschlage, hatte er in einem induktiven Verfahren aus dem Vergleich Beethovenscher Werke gewonnen (Kawohl 2002, S. 150ff). Die Bedeutung von Marx' Vorgehen wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auf kein abstraktes Sprachmodell zurückgegriffen werden konnte. Sprache war konkret an den Vollzug gebunden. Das war Musik zwar auch, doch ihre nonverbalen Codes funktionierten nur durch die »Einbildungskraft« der Rezipienten und durch die im Gedächtnis geleistete Synthese der verschiedenen in der Zeit ablaufenden akustischen Informationen. Erhielten Noten die gleiche Bedeutung wie Buchstaben, so wurden Partituren als musikschriftliche Quellen zu Dokumenten mit eigener künstlerischer Dignität aufgewertet. Dieser Statuswandel vollzog sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Partituren genossen infolgedessen immer mehr philologische Aufmerksamkeit. Man begann, jedes einzelne Zeichen zu beachten und zu bewerten. Daraus wuchs das Darstellungsideal, alle verschriftlichten Anweisungen der Komponierenden strikt zu befolgen. Werktreue im Sinne von Detailgenauigkeit kam als neue Leitlinie in die Aufführungspraxis, und sie wurde entsprechend funktionalisiert und ideologisiert.
Geschwindigkeit und Interpretation
347
Hier konnte schon Clara Wieck punkten. »Es ist wahrhaft nichts Leichtes, in den Sinn aller Compositionen so einzugehen, daß dasjenige, was die Tondichter damit ausdrücken wollten, unverfälscht wiedergegeben werde«, schrieb die Allgemeine Theaterzeitung 1837 anerkennend über Clara Wieck (in: Steegmann 2001, S. 150). Sie stelle ihr Talent in den Dienst der »reinen göttlichen Kunst«, teilte der Kritiker der Signale 1844 seinen Lesern mit (S. 393f). Aus der »Entsagung [...] der eigenen Individualität« resultierte die »ergreifende Wahrheit ihres Vortrags«, so Zellner 1856. Damit war ein positivistisches Verhältnis zum Text gemeint. In französischen Rezensionen bewertete man diese Haltung Clara Schumanns als »réalisme en musique« (France Musicale, 30. März 1862, in: Kat., S. 161). Kategorien wie Werktreue oder Authentizität, das heißt die garantierte Erfüllung der Autorenintention, bereiteten jedoch erhebliche Probleme. Nach Czerny profilierte sich Beethoven als genialer Vom-Blatt-Spieler und improvisierte hinreißend. Doch hatte er offenbar weder Geduld noch Lust, seine eigenen Klavierkompositionen genau einzustudieren. »So hing das Gelingen meistens vom Zufall und Laune ab« (Czerny 1963, S. 22). Er taugte also kaum als Vorbild. Selbstverständlich passten Clara Wieck und Franz Liszt in den 1830er und 40er Jahren ihre Lesarten von Bachs, Mozarts oder Beethovens Musik dem Klangvermögen moderner Klaviere beziehungsweise den Auffiihrungsbedingungen in den großen Sälen an und verdoppelten etwa Bässe und Diskantstimmen oder verbreiterten Akkorde durch Arpeggieren, um ihre Interpretation zu verdeutlichen. Liszt ging dabei sehr frei mit allen Notentexten um. Seine improvisierten Ausschmückungen waren Legende. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts forderte man indessen ein gründliches Studium des Notentextes und die Disziplin, sich genau daran zu halten. Allerdings stieß man auch dabei schnell auf Hindernisse. Viele Komponierende hatten ihre Werke in mehreren Ausgaben veröffentlicht, die nicht immer identisch waren. Welche Variante sollte gelten? Diese Frage beschäftigt Interpreten bis heute. Nicht nur die Notendrucke, sondern auch Entwürfe und Skizzen erhielten mit dem Statuswandel musikalischer Zeichen eine neue Autorität zugesprochen. Die Autographe bekamen fast kultischen Wert. Sie wurden wie »sakrale Objekte« (Gumbrecht, S. 18ff) verehrt, gesammelt und mit gewinnbringendem Profit gehandelt. Selbst persönliche Hinterlassenschaften von Künstlern wie Beethovens Hörrohre und Schuberts Brille begann man wie Reliquien zu inventarisieren. Und sogar die Lebens- und Wirkungsstätten der Komponierenden umgab inzwischen die Magie von heiligen Orten. Sie 348
Handlungsreisende
logiere an der Stelle, wo »früher Mozarts Wohnhaus stand«, schrieb Clara Schumann 1858 aus Wien. Obwohl das Gebäude selbst gar nicht mehr existierte, überrieselte sie »immer ein heiliger Schauer«, sobald sie heimkehrte, versicherte sie (Schumann-Brahms 1, S. 233). Die derart aufgewertete artifizielle Musik verlangte eine veränderte Rezeptionshaltung. Sie erforderte neben der Ehrfurcht vor dem Sakralen gleichzeitig einen neuen, verstehensorientierten Zugang zur Kunst. Aufmerksames Zuhören und die Konzentration auf das Stück sollten einen Erkenntnisgewinn bringen. Die gesteigerte Kunstwahrnehmung vollzog sich als subjektiver, körperlicher Akt der Aneignung mit kognitiven und emotionalen Anteilen. Zwischen Interpreten und Publikum herrschte das Einverständnis, an einem herausragenden Kunstereignis teilzunehmen. Dementsprechend wurde das Repertoire auf nur »gute« Musik ausgerichtet. Bekannte Namen wie Beethoven bürgten für Qualität. »Seriöse« Veranstalter, Interpretinnen und Interpreten garantierten, dass im Konzertsaal tatsächlich Kunst geboten wurde. Dort konnten Rezipienten sich als Teil einer Gemeinde fühlen und die kollektive Erfahrung machen, dass sie nicht nur allein in ihrem persönlichen Erleben und behaftet mit privaten Erinnerungen von der gespielten Musik gebannt wurden, sondern die als Auditorium versammelte Konzertsaal-Gemeinschaft insgesamt so reagierte. Die erlebte Intensität sollte man indessen der Qualität der Kunstwerke und nicht der Interpretenleistung zuschlagen. Manchmal gelang das. Eugène Delacroix, der jahrelang einen Kunstdialog mit Chopin geführt hatte, beschrieb die Erfahrung, wie ein Kunstwerk in der Erinnerung an Gefühle des ErgrifFenseins dem eigenen Leben anverwandelt wurde. Gepaart mit der Gewissheit, dass die Werke auch ohne seine Anwesenheit und unabhängig von seiner Biografié diese Wirkung auslösen und vorher wie nachher Kunst seien, schloss er: »Die großen Werke können niemals veralten, wenn sie nur von einem wahren Gefühl beseelt sind« (26. März 1854). In diesem Sinne bedeutete das subjektive Kunsterlebnis ein Stück weit auch die Teilhabe am Absoluten. Als Künstler tröstete ihn darüber hinaus der Gedanke an die Uberzeidichkeit der Kunst, weil sie seine »Unsterblichkeit« garantierte (in: Belting 1998, S. 143) und zumindest einen Moment lang über die Furcht vor der Vergänglichkeit hinweg trug. Die Bedeutung der Virtuosen als Interpreten wuchs in dem Maße, wie der kulthafte Status der Partitur und der komponierenden »Meister« stieg. Jetzt bedurften die geheimnisvollen Notenzeichen kundiger Exegeten, die ihren Code entschlüsselten, den darin verborgenen Sinn verstünden und vermitteln
Geschwindigkeit und Interpretation
349
könnten. So sollten die Virtuosen die Musik zum Klingen bringen und dabei zusätzlich wie Schriftkundige den Sinntransfer besorgen. Daraus bezogen sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihr hohes Ansehen als priestergleiche »Kunstgelehrte«. Der Unterschied zwischen der vestalischen »KunstPriesterin«, als die man Clara Wieck gesehen hatte, und der von Liszt auf den Sockel gehobenen Interpretin strenger Observanz der 1850er Jahre lag in einer Verschiebung der Ansicht des Kunstkultes begründet. Im früheren Bild rückte die magische Handlung in den Vordergrund, im späteren das Kunstwerk selber, in dessen Dienst die Interpretin agierte. Daran glaubte auch Clara Schumann fest. »Das Höchste in der Kunst wirkt mit unwiderstehlicher Macht und Zauber«, schrieb sie an Joachim. Das hier diskutierte Interpretationskonzept basierte auf der Annahme, dass die »Sprache der Kunst« universell und daher Zeit, Kontext und Länder übergreifend verstehbar sei, eine Auffassung, die bis dahin allein der Bibel vorbehalten geblieben war (Gumbrecht 2003, S. 55). Mit entsprechend religiöser Emphase stilisierten Schumann und Joachim die Auffuhrung zum mimetischen Akt, durch den die tote Materie, die Zeichen auf Papier, zu leben begann (Joachim 2, S. 16 und S. 190). So geriet eine Aufführung zur Schöpfung: »Das Spiel dieser Künstlerin [...] erscheint im ersten Augenblicke nichts weniger als bestechend. Doch schon nach wenigen Accorden beginnen die Gluthen heiliger Begeisterung zu erwachen« und »auf uns überzuströmen«, übermittelt Zellner 1856 das im Konzertsaal durch Clara Schumann ausgelöste Wunder seiner Leserschaft. »Ihre Pulsschläge sind die unseren, jede Seelenbewegung, jede Empfindungsnuance theilt sich uns im Moment des Entstehens mit. Sie fordert uns nicht auf, ihr zu folgen, denn wir sind für sie eigentlich gar nicht vorhanden. Sobald sie die ersten Töne berührt, lebt sie nur dem Cultus ihrer Kunst« (in: Kat., S. 130). Welchen Rang die Interpreten gegenüber den Komponierenden einnahmen, blieb indessen strittig. Robert Schumann hatte im Gerangel um das von Rietschel entworfene Künstler-Doppelporträt darauf bestanden, dass er vor seiner Frau zu stehen habe. Auch Brahms verfocht den Vorrang des Komponisten vor dem Interpreten. Es sei »gegen sein Gefühl, einen Mann, der nichts hinterlassen, der keine neue Epoche in der Musik hervorgerufen, ein solches Monument zu setzen«, so Brahms' Kommentar zur Absicht der Hamburger Bürgerschaft, ein Denkmal für Hans von Bülow zu errichten. Mit »Legislative« und »Exekutive« hatte von Bülow das bekannte Doppelporträt Braschs von Brahms und sich unterzeichnet (Kalbeck 1904ff., 4, S. 371f. und 425). Liszt sah die Sache anders. In seinem Artikel über Clara Schumann von 1855 entwickelte er ein aufschlussreiches paritätisches Kunstmodell. Aus350
Handlungsreisende
gehend von dem Humboldtschen Ideal einer komplementär begriffenen männlich-weiblichen Natur, deren Synthese, wie bei den Schumanns, die Liebe bildete, postulierte Liszt eine Gleichrangigkeit von produzierender und reproduzierender Kunst. Die von den Komponierenden als geistige Idee entworfene Musik bedürfe der Virtuosen, um zum Leben erweckt zu werden (Ramann 1880f., 4, S. 203). Ausgerechnet Liszt sprach Clara Schumann derart prometheische Fähigkeiten zu.
Lisztophobia Stationen eines komplexen Verhältnisses »Liebster Joachim, [...] was soll ich thuen? Da erhalte ich vom Wiener Beethv. Comité (Herbeck unterschrieben) eine Einladung«, an der Zentenarfeier 1870 mitzuwirken. »Es geht mir wie Ihnen eine Beethovenfeyer mit Liszt und Wagner, da schnürt sich mir das Herz zu, aber wie wickele ich mich da heraus? ich als Frau kann nicht handeln wie Sie, indem ich meine Gesinnung offen ausspräche, es würde als große Arroganz erscheinen, ich, die Frau den Männern gegenüber, ich müßte also eine Lüge machen! aber welche?« Clara Schumann rang mit sich. Sie dürfte »keinesfalls in einem Concerte mitwirken«, das Wagner dirigierte, so Joachims prompte Antwort. »Die geringschätzige Art, mit der er über Ihnen Heiliges spricht, können Sie nicht ignoriren. Daß Sie Dame sind, finde ich, hat damit gar nichts zu schaffen [...] Übrigens sind Sie in der Kunst jedenfalls >Mann's< genug« (Joachim 3, S. 42f). Die Sache löste sich anders auf: Liszt und Wagner sagten ab, angeblich weil Hanslick die Einladung mit unterzeichnet hatte, so Martin Gregor-Dellin (1980, S. 631). Zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 1870, war die deutsche Musiklandschaft längst in zwei feindliche Lager zementiert. Auf der einen Seite sammelten sich die selbst ernannten »Fortschrittlichen«, gruppiert um Liszt und Wagner, auf der anderen die von den Fortschrittlichen als »Konservative« deklarierten, repräsentiert durch Brahms, Joachim, Clara Schumann und deren Sympathisanten. Folgt man der zeitgenössischen Publizistik, so schien es dazwischen nichts Weiteres zu geben als ein Heer von »Uberläufern« in beide Richtungen wie die Dirigenten Hermann Levi, der ins Wagnerlager stürmte, oder Hans von Bülow, der daraus floh. Im Jahr der Uraufführung der Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner unter Bülows Dirigat, 1868, brachte Brahms sein Deutsches Requiem Stationen eines komplexen Verhältnisses
351
op. 45 heraus, mit dem er sich endgültig als Komponist etablierte. Nach 1876, dem Jahr, in dem Wagners Ring des Nibelungen im neu eröffneten Bayreuther Festspielhaus und Brahms' erste Sinfonie op. 68 uraufgeführt wurden, polarisierte und personalisierte sich der Dissens der musikalischen Parteien zumindest in den Pressestimmen noch weiter. Von Bülow hatte heftig Ol ins Feuer gegossen, als er Brahms' neue Sinfonie mit dem Etikette »Beethovens Zehnte« adelte. Die Breslauer Universität verlieh Brahms 1879 einen Ehrendoktortitel. Er nahm an und brachte als Morgengabe die Akademische Festouvertüre op. 80 mit. Der honorige Zusatztitel der Urkunde, »artis musicae severioris in Germania nunc princeps«, von Wagner zum »ersten MusikPrinzen unserer Zeit« verballhornt, brachte für die Bayreuther das Fass zum Überlaufen (C. M. Schmidt 1983, S. 27ff). Die Frage nach der Vorherrschaft im musikalischen Deutschland schien auf Seiten der Anti-Wagnerianer vorerst zugunsten von Brahms entschieden. Wagnerianer und Brahtninen, das klingt, als hätten zwei kunstreligiöse Sekten in einem fernen Universum um unendliche und endliche Melodien gefochten. Doch dahinter steckten durchaus diesseitige Interessen. Der Streit drehte sich um die Deutungshoheit darüber, wer und was die Deutschland vereinende kulturelle Vergangenheit vertrat und wer musikalisch in die Zukunft führte. Damit verbanden sich neben ästhetischen Postulaten die handfesten Möglichkeiten, bei der Institutionalisierung musikalischer Einrichtungen sozusagen die Nase vorn zu haben und auch kulturpolitisch Prestige und Einfluss zu gewinnen. Man kann im gründerzeitlichen Deutschland eine sich verschärfende Kompromisslosigkeit in den Lagern verfolgen. Sie hing mit der symbolischen Aufladung von Kunst im Zuge der Bildung eines deutschen Nationalstaats zusammen. Insofern war auch Musik nicht einfach eine Sparte innerhalb der schönen Künste. Vielmehr wurde sie immer eindeutiger ideologisch vereinnahmt im Dienst eines nationalen Selbstbewusstseins, und zwar nicht von den Staatsorganen, sondern von der Gesellschaft. Jede »Partei« bestand darauf, die »wahre« Kunst erkannt zu haben und verteidigte diesen Anspruch hartnäckig. Wer die »wahre« Kunst der Zukunft anführte, der handelte nach dieser Logik auch moralisch und kulturpolitisch richtig. Die Anfänge der Auseinandersetzungen um den musikalischen Fortschritt reichten indessen schon Jahrzehnte zurück. Einige der ursprünglich beteiligten Protagonisten, wie Robert Schumann und Franz Brendel, lebten 1870 nicht mehr. Vor dem Hintergrund dieser kulturpolitischen Grabenkämpfe spielte sich die wechselhafte Beziehung zwischen Clara Schumann und Franz Liszt 352
Handlungsreisende
ab. Obwohl sie hier personalisiert wird, betraf die Geschichte nicht allein die persönliche Konstellation der beiden Künstler mit ihren jeweils spezifischen Vorzügen oder Macken. Vielmehr lassen sich in ihrem Verhältnis zueinander im Kleinen Spannungen fokussieren, die im 19. Jahrhundert die Entwicklung der musikalischen Öffentlichkeit in Deutschland prägte. Anfangs verkehrten beide noch als freundlich gesinnte Konkurrenten miteinander. Wann und vor allem warum Liszt dann fur die Künsderin ins »feindliche Lager« rückte und weshalb sie später dermaßen allergisch auf ihn reagierte, ist zwar nicht eindeutig zu erschließen, doch lassen sich einzelnen Komplexe zumindest einkreisen. Neben ästhetischen und politischen Komponenten dürften hier auch private emotionale, psychische und vor allem irrationale Befindlichkeiten involviert gewesen sein. Clara Wieck hatte Liszt schon 1832 in Paris gesehen, wo er (damals noch mit kurzen Haaren) als junger Draufgänger mit Chopin, Hiller und Mendelssohn Bartholdy die Salons durchzog. Er nahm unter den Konkurrenten, gegen die sie sich behaupten wollte, eine feste Größe ein. So gedachte sie mit ihrem Scherzo op. 10 auf ihrer zweiten Pariser Tournee »neben Thalberg und Liszt« zu bestehen. Inzwischen hatte sie Liszt im Frühjahr 1838 in Wien näher kennen gelernt. Während sie die Serie ihrer spektakulären Erfolge gerade abschloss, traf Liszt in Wien ein. Für Clara Wiecks Karriere dürfte diese Reihenfolge der Ereignisse ein großes Glück gewesen sein. Beide wohnten im selben Hotel und amüsierten sich und die übrige Gesellschaft nach der Table d'hôte mit Klavierkunststücken. In Privatkreisen, wie im Wiener Salon der Baronin Henriette Pereira, ritten sie vierhändig Lisztsche »Galopps« ein Schauspiel, das sie mehrfach wiederholen mussten. Beide schätzten sich als Künstlerkollegen. Liszt empfand es als eine fur ihn ganz neue Ehre (»un honneur tout à fait nouveau«), dass die Wieck sein Divertissement sur la cavatirie de Pacini vor der Kaiserin spielte (in: Seibold 2005,1, S. 68f). Gewöhnlich präsentierte man sich den Herrschaften mit eigener Kunst und nicht mit Stücken der Konkurrenz. Diesbezüglich gab sich Wieck generös. Man tauschte Kompositionen aus, und Liszt versprach, ihr ein Stück zu widmen, was er auch tatsächlich einhielt. Die 1838 komponierten Etudes d'execution transcendente d'après Paganini erschienen 1840 mit einer Widmung an sie. Clara Wieck war ihrerseits nicht nur von Liszts Bravour begeistert und von seiner Galanterie eingenommen. Vielmehr schätzte sie damals auch sein Engagement fur die Kompositionen Robert Schumanns, dessen Werke op. 5, op. 11 und op. 14 Liszt 1837 in einem Artikel in der Gazette Musicale eingehend besprochen hatte. Außerdem unterstützte Liszt nun unverhohlen die
Stationen eines komplexen Verhältnisses
353
um eine Heiratserlaubnis kämpfenden Verlobten. In Leipzig verhielt er sich 1840 deswegen so kühl ihrem Vater gegenüber, dass Clara Wieck seine Parteilichkeit schon wieder undankbar fand. »Das ist herrlich«, frohlockte dagegen Schumann (Jb, 23. März 1840; Bw, S. 994). Zu diesem Zeitpunkt zählte man Liszt zur »Phalanx« eines dem dichterischen angelehnten musikalischen »jungen Deutschland«. Auf dem »neuen Olymp« thronten die »jungen Götterhelden« Chopin, Thalberg, Liszt, Henselt und Schumann, las man in der Presse (in: Seibold 2005,1, S. 147). Von diesen Helden waren Schumann und Chopin mit gerade 30 Jahren die Altesten. Wie Schumann so mischte sich auch Liszt nicht bloß musikalisch, sondern darüber hinaus durch Feuilleton-Artikel in die öffentliche musikästhetische Diskussion ein. Beide, Schumann wie Liszt, waren unabhängig voneinander vermutlich von der religiös-sozialistischen Bewegung des französischen Philosophen und Ökonomen Claude-Henri Comte de SaintSimon beeinflusst (Kabisch 1988, S. 55ff). Liszt blieb dabei einer tiefen katholischen Frömmigkeit verbunden, ein Zug, der in Deutschland kaum wahr- und wenn, dann nicht wirklich ernst genommen wurde, zumal Liszt selber durch die aufreißerischen Bühnenauftritte und die öffentlich inszenierte Galanterie seinen Ruf als Hallodri verstärkte. Beide, Schumann wie Liszt, folgten Saint-Simons Ideen einer »art social« nach der die (bürgerliche) Kunst als Avantgarde der Gesellschaft voranschreiten müsste, und beide traten für Demokratisierung ein. Liszt verknüpfte diese Aspekte in der programmatischen Artikelserie, »Zur Situation der Künstler und zu ihrer Stellung in der Gesellschaft«, die ab 1834 in der Gazette Musicale erschien. Dort wies er auf die prekäre soziale Stellung der Künstler als Dienstleister hin. Vor allem verfocht er aber hier die Idee einer programmatischen »musique humanitaire«, einer »menschlichen« Kunst mit religiöser Implikation. Auf ähnlichen Gedanken basierte das Klavierstück »Lyon« (Impression et poésies Nr. 1), das er mit der Protestparole des Lyoner Weberaufstands von 1834 überschrieb: »Arbeitend leben oder kämpfend sterben« (in: Kabisch 1988, S. 79). Schließlich hatte Liszt mit der Vertonung von Heines Gedicht Im Rhein (bei Liszt: Am Rhein) als Klavierlied, das er der aus Weimar stammenden preußischen Prinzessin Augusta widmete, und Georg Herweghs damals berühmtem Rheinweinlied für Männerchor auch eindeutig eine nationale Position fur Deutschland im 1840 ausgebrochenen Konflikt mit Frankreich um die Rheingrenze bezogen, obwohl sein privater Lebensmittelpunkt die Pariser Gesellschaft bildete. Robert Schumann, einer der damaligen Wortführer des ästhetischen Fortschritts, zögerte trotzdem, Liszt als gleichrangigen Mitstreiter anzusehen. 354
Handlungsreisende
Robert Schumann hatte 1836 ein aufschlussreiches musikalisches Parteienspektrum entworfen. Es enthielt drei Gruppen, nämlich erstens die »Klassiker«, zu denen die »Alten, die Kontrapunktler, die Antichromatiker« zählten, zweitens die »Modernen« im »Juste-Milieu« und drittens die »Romantiker«, die »Formverächter, die Genialitätsfrechen«, einschließlich der »Beethovener als Klasse fur sich« (GS 1, S. 144). Liszt hätte eigentlich nur zu den romantischen »Formverächtern« zählen können. Sowohl in den von Gedichten Alphonse de Lamartines inspirierten Harmonies poétiques et religieuses fur Klavier solo als auch in dem ebenfalls durch die Lektüre Lamartines ausgelösten meditativen Klavierzyklus Apparitions aus dem selben Jahr, 1834, experimentierte Liszt mit freien Formen, Rhythmen und Harmonien, die offenbar von François-Joseph Fétis' Theorie einer »harmonie omnitonique« beeinflusst waren, und erweiterte damit die instrumentalen Ausdrucksmöglichkeiten beträchtlich. Darüber hinaus korrespondierten Liszts Vorstellungen eines »sprechenden« und »singenden« Vortrags mit den narrativen Konzepten in Chopins und Schumanns avantgardistischer Klaviermusik dieser Jahre. Liszts Partituren gingen Schumann gegen den Strich. Vieles fand der Kritiker in der Musik, wo Liszt »aus allen Randen und Banden« schlug und »die erreichte Wirkung doch nicht genug für die geopferte Schönheit entschädigt«. »So sehen wir ihn (z. B. in seinen Apparitions) in den trübsten Phantasien herumgrübeln und bis zur Blasiertheit indifferent«, las man in der Rezension. Und die beiden Hefte der Etudes d'execution transcendente und Etudes d'execution transcendente d'après Paganini seien »wahre Sturm- und Grausetüden, Etüden für höchstens zehn bis zwölf auf dieser Welt«, urteilte Schumann 1840 (GS 1, S. 439ff). Das hieß: Niemand konnte die Stücke überhaupt spielen - außer Liszt selbst und Clara Wieck, der sie gewidmet waren. Zu den technischen Schwierigkeiten zählten etwa Dezimenpassagen in schnellem Tempo, eine Spezialität Clara Wiecks. Hier dürfte auch eine gewisse Konkurrenz aufgekommen sein. Schumann hatte schließlich ebenfalls Sechs Konzert-Etüden nach Capricen von Paganini op. 10 komponiert, von denen er im Vorwort angab, dass sie sich »von der Pedanterie einer wörtlichen treuen Übertragung« losmachten und »den Eindruck einer selbständigen Klaviercomposition« geben sollten. Darüber hinaus mochte der Rezensent Schumann weder die Beethoven-, noch die Schubert-Transkriptionen Liszts loben. An Liszts Klavierfassungen von Schuberts Erlkönig oder der Forelle rügte Schumann den Klaviersatz als unangemessen. Das »Schwerste, was fur Klavier existiert,« so Schumann, »und ein Witziger meinte, man möchte doch eine erleichterte Ausgabe derselben veranstalten, [...] ob wieder das echte SchuStationen eines komplexen Verhältnisses
355
bertsche Lied« herauskäme? Beethovens »Pastorale« aber als Klavierstück im Konzertsaal aufzuführen, »wo wir die Sinfonie so oft und so vollendet schon vom Orchester gehört«, schien ihm widersinnig. Schumann knüpfte daran die Frage, »ob sich der darstellende Künsder über den schaffenden stellen, ob er dessen Werk für sich umgestalten dürfte« und antwortete salomonisch: »einem Geistreichen gestatten wir's, wenn er den Sinn des Originals nicht etwa geradezu zerstört« (GS 1, S. 373, 443 und 481f). Dagegen spielte seine Gefährtin Liszts Arrangements mit Begeisterung. Seit 1837 führte sie dessen Divertissement sur la cavatine de Pacitii »I tuoifrequentipalpiti« und seit 1838 von seinen damals vorliegenden Schubert-Transkriptionen mit Vorliebe den Erlkönig im Programm. Trotz wechselnder Skepsis begeisterte sie sich noch 1841 an seinen Reminiscences de Don Juan, »die er hinreißend spielte - sein Vortrag des Champagnerliedes wird mir unvergesslich bleiben [...] Man sah den Don Juan vor den springenden Champagner-Stöpseln in seiner ganz[en] Ausgelassenheit, wie ihn sich Mozart nur irgend kann gedacht haben« (Tb 2, S. 197). Selbst im Sommer 1855 vertiefte sich Clara Schumann zusammen mit Brahms »mit ungeheurem Lustgefühl in das Lisztsche Arrangement der 9. Symphonie« wie Litzmann die Tagebuchnotizen zusammenfasste. »Das klang ganz herrlich«, so zitierte er die Virtuosin, »die nächsten Tage spielten wir sie täglich und mit wahrer Wonne« (in: Litzmann 2, S. 380). Zum Komponieren fehlte Liszt die Ruhe, behauptete Schumann. Vielleicht hätte er »auch keinen ihm gewachsenen Meister« gefunden. »Brachte er es nun als Spieler auf eine erstaunliche Höhe, so war doch der Komponist zurückgeblieben«, im Unterschied zu Chopin: Der »hat doch Formen; unter den wunderlichen Gebilden seiner Musik zieht sich doch immer der rosige Faden einer Melodie fort«. Waren die »Formverächter« schon passe? Hier operierte Schumann offensichtlich mit zwei Formbegriffen, nämlich dem einer erstarrten älteren Satztechnik, gegen die die »Formverächter« anstürmten, und einem maßvollen positiven, als kritische Reflexion verstandenen, den Schumann für sich selber und für Chopin beanspruchte. Liszt sprach er damit indirekt ein entsprechendes Reflexionsniveau ab und schob ihn ins Juste Milieu. Dort hielten sich laut Schumann alle diejenigen auf, die eigentlich keinen rechten Standpunkt hatten, sondern sich Einflüssen von überall her öffneten, daher Liszts »schnellberedter Ton«. Liszt hätte deswegen begonnen, »sich zu andern Komponisten zu flüchten« und »sie mit seiner Kunst zu verschönen« (GS 1, S. 439f). Der Missachtung des Komponisten Liszt schloss sich Clara Schumann später nicht nur vorbehaltlos an, sondern verstärkte sie sogar noch erheblich, obwohl oder gerade weil ihre eigenen, von der Oper inspirierten extravaganten Entwürfe (etwa die beiden »Hexenstücke« op. 5 356
Handlungsreisende
Nr. 1 und Nr. 4) oder das mit einer flirrenden Klangfläche experimentierende Scherzo op. 10 durchaus Liszts Experimenten nah kam. Für Robert Schumann wie für Clara Wieck verkörperte Liszt bis in die 1840er Jahre hinein den Gipfel virtuosen Spiels: ein »Jupiterjüngling«, »ein Göttlicher, und wir lauschen auf den Knien«. Diese Emphase milderte Schumann bei der späteren Redaktion seiner Schriften ab in: »wir lauschen andächtig« (GS 1, S. 479; GS 2, S. 435). Da im Vormärz die öffentliche W i r kungsmacht der Virtuosen eine so zentrale Funktion einnahm, stand Liszt wie Mendelssohn und Clara Wieck zwar als Klavierspieler an höchster Stelle der Kunstverbreiter. Dennoch wollte Schumann den positiven Einfluss von Liszts Transkriptionen auf die Popularisierung anspruchsvoller Musik nicht anerkennen, obwohl er selbst die für sein frühes Komponieren so wichtige Symphonie fantastique von Berlioz erst durch Liszts Klavierfassung kennen gelernt hatte. Liszts Bekenntnis, »der Name Beethovens ist heilig in der Kunst«, den er dem 1840 erschienenen ersten Teil seiner Sinfonietranskriptionen voranstellte (in: Dömling 1985, S. 54), ignorierte Schumann. Dass auch Liszt ein Künstlerethos vertrat, hätte man in Leipzig wissen können. Schließlich überlieferte Friedrich Wieck aus W i e n die Anekdote, wie Liszt 1838 auf Metternichs Spruch, »Sie machen gute Geschäfte hier«, geantwortet hätte: »Nein. Ich mache Musik« (Jb, 6. Mai 1838). Liszt wurde international gerade auch aufgrund seines Engagements für die Musik von Beethoven und Schubert verehrt. Conrad Graf gab 1840 das Ölgemälde Liszt spielt (»Erinnerungen an Liszt«) bei dem Wiener Maler Josef Danhauser in Auftrag. Danhauser hatte 1827 Beethovens Totenmaske abgenommen. In seinem Gemälde, einer Salonszene, zieht die überlebensgroße marmorne Beethoven-Büste von Anton Dietrich die Blickrichtungen an. Sie thront auf einem Graf-Flügel vor dem Fenster, das den Blick auf einen dramatisch bewölkten Himmel über weiter Landschaft freigibt. Liszt wird allegorisch umringt von Rossini, Paganini, Victor Hugo und Alexandre Dumas dem Älteren, als Wandporträt grüsst Lord Byron von ferne. George Sand schmachtet Zigarre rauchend und in Männerkleidern im Rücken des Virtuosen, zu dessen Füssen Marie d'Agoult hingesunken ist (in: Burger 1986, S. 126f). In Wien vermachte man Liszt 1841 auch den BroadwoodFlügel aus Beethovens Nachlass. Erste Risse erhielt das Verhältnis Clara Wiecks zu Liszt schon 1840. Sie, die Liszts wegen fast ihr Klavierspiel hatte aufgeben wollen, störte doch dessen fehlende Textgenauigkeit erheblich und sie registrierte, dass der damals noch von ihr begeistert empfangene Kollege »überhaupt nicht den Eindruck dießStationen eines komplexen Verhältnisses
357
mal auf mich machte als in Wien. Ich glaube es lag an mir selbst, ich hatte meine Erwartungen zu hoch geschraubt«. Liszt war einfach nur unpässlich, als sie ihn das zweite Mal hörte. Gleichwohl genoss sie den charmanten Beau. »Seine Unterhaltung ist voller Geist und Leben, auch ist er wohl coquett, das vergißt man aber ganz und gar«. Dem lebenssprühenden Charme Liszts konnte sich die Virtuosin nur schwer entziehen. Liszt bliebe trotz allem »ein ungeheurer Spieler«, »wie es Keinen mehr giebt«. »Wir lieben ihn aber auch«, bekannten die Schumanns noch im Dezember 1841, und sie schenkten ihm einen »schönen silbernen Becher mit unser beider Namen darauf« (Jb, 30. April 1840; Tb 2, S. 196£; an M. Bargiel, 29. Dezember 1841). Anfang der 1840er Jahre begann Liszt nach seinen spektakulären Auftritten in Wien und Pest mehrere dicht gedrängte Deutschland- und Europatourneen. Berlin erlebte während seiner Konzerte zwischen Dezember 1841 und März 1842 einen wahren Liszt-Boom mit kollektivhysterischen Zügen. Nicht bloß die Schumanns, selbst Chopin berührte inzwischen der Rummel, den Liszt mit seinen narzisstischen Selbstinszenierungen entfachte, peinlich. Liszt gelte der Schröder-Devrient »nur wie eine Caricatur«, referierte Schumann genüsslich, und Mendelssohn Bartholdy sprach missbilligend vom »Wechsel zwischen Skandal und Apotheose« (in: Tb 2, S. 326 und 399). Wo immer die Schumanns jetzt hinkamen, war Liszt schon gewesen, und sie wurden mit Klatsch und Anekdoten über ihn empfangen. Weibliche Fans rissen sich um verlorene Handschuhe und vergessene Zigarrenetuis oder stiebitzten sie als Reliquien. Am meisten störte Clara Schumann jetzt sein aufgedrehtes Bühnenverhalten. Während er privat liebenswürdig und aufmerksam war, setzte er sich im öffentlichen und halb-öffentlichen Rahmen unentwegt in Pose. Alles »Effecthascherei, jedes Lied, das er begleitet, begleitet er so, daß immer sein Ich das hervortretenste ist«. Außerdem sei er »arrogant«, »wie ein verzogenes Kind, herrschsüchtig in höchstem Grade, ein Fürst kann nicht mehr befehlen als Er, und dieser letzte Punkt war mir schrecklich an ihm - nur nicht gegen seine Untertanen hart, das hasse ich!« bekannte sie 1842. »Viele hier - die Kenner« zweifelten inzwischen an Liszt (in: Wendler, S. 107). Aufrichtiger formulierte dagegen Heine, wie schlecht es gelang, sich dem Sog Liszts zu entziehen und seine Bedeutung richtig zu taxieren. Er hätte die »Lisztomanie [...] für ein Merkmal des politisch unreifen Zustands jenseits des Rheins« gehalten, so Heine 1844 aus Paris. »Aber ich habe mich doch geirrt«. Selbst die »Blüthe der hiesigen Gesellschaft« geriet in Taumel. »Das war kein deutsch-sentimentales, berlinisch-anempfindendes Publikum, und dennoch! Wie gewaltig, wie erschütternd wirkte schon seine bloße Erschei358
Handlungsreisende
nung«. Liszt lebte die Antagonismen zwischen demokratisch-sozialistischen Träumen, künstlerischer Freiheit, religiösem Sendungsbewusstsein und feudalen Lebensansprüchen konflikthaft in der Öffentlichkeit aus. Er stellte sich allen Seiten und wirkte daher so schillernd. »Man hat viel über seine langen Haare gespottet, [...] über seine dämonischen Bewegungen«, so Theophil Gauthier 1844, »sein enger nach brandenburgischer Art geschnittener schwarzer Rock und sein ungarischer Ehrensäbel sind der Gegenstand mehr oder minder geschmackloser Späße gewesen«. Gauthier fand das verlogen. Schließlich könnte ein Künstler nicht wie ein »Kerzenfabrikant« aussehen. »An Liszt lieben wir, daß er immer der gleiche Künstler geblieben ist, feurig, wild, mit fliegenden Haaren« (in: Burger 1986, S. 142 und 152). Bei dem sich dramatisch verschlechternden Verhältnis Clara Schumanns zu Liszt spielten die verschieden verlaufenden politischen und kulturellen Entwicklungen zwischen der deutschen und der französischen Gesellschaft im Vormärz eine entscheidende Rolle. In Frankreich wirkte sich die mit der Herrschaft Louis Philippes begonnene Tendenz zur Refeudalisierung der Gesellschaft aus (Nagler 1980, S. 9ff). Das heißt, politisch, intellektuell und kulturell war die französische Aristokratie stark involviert. Sie stellte die Zielgruppe für die Kunstschaffenden. Damit verblasste die mit der Gründung des Pariser Conservatoire 1795 beschlossene Idee, Musik der aristokratischen Gesellschaft aus der Hand zu nehmen und sie zu einer bürgerlichen Kunst zu machen, erheblich. Aus deutscher Sicht registrierte man vor allem die soziale Orientierung der in Paris lebenden Künstler an der Aristokratie. Der »geistreiche Pole« wäre gewohnt, »sich in den vornehmsten Kreisen der französischen Hauptstadt zu bewegen«, so Robert Schumann über Chopin 1842. Sein Interesse an Chopins Musik sank deutlich. Zur Ballade As-Dur op. 47 fiel ihm bloß noch ein, »ihr poetischer Duft läßt sich nicht weiter zergliedern« (GS 2, S. 108). Dass Chopin mit seinen Sonaten einen ungewöhnlichen Beitrag zur Beethoven-Rezeption geleistet hatte und in Stücken wie der Polonaise fis-Moll op. 44 oder der Fantaisie-Polonaise As-Dur op. 61 den ehemals aristokratischen Tanz nutzte, um ihn gleichsam von innen heraus mit musikalischen Mitteln zu dekonstruieren (wie später Ravel in La Valse den Wiener Walzer), spielte im deutschen Diskurs keine Rolle mehr. An Liszt interessierte aus deutscher Sicht hauptsächlich der Starrummel und welche immensen Geldsummen er mit seinen überfüllten Auftritten zu gepfefferten Eintrittspreisen scheffelte, auch wenn er seine Einnahmen dann freigiebig verteilte. Alles schien ihm in den Schoß zu fliegen, als steckte nicht auch hinter Liszts bestechender Technik ein hartes Stück Arbeit. Darüber
Stationen eines komplexen Verhältnisses
359
hinaus sonnte sich Liszt sichtlich ohne Skrupel im Licht besonders des weiblichen Teils der Aristokratie und genoss deren Libertinage. Die Kehrseite dieses Glanzes wollte man nicht sehen. Die soziale Position der Künstler in der Pariser Gesellschaft blieb nämlich labil. So galt es zwar als schick, sich einen der wundersamen Fantasten zu angeln und ihn zum Freundeskreis zu zählen. Und sowohl Chopin als auch Liszt waren hingerissen von den charmanten, ebenso luxuriösen wie geistreichen und eloquenten Frauen. Allerdings mussten die aufsteigenden Virtuosen sich auch die Kommunikationsformen, Verhaltenscodices und Konsumgewohnheiten der vornehmen Welt aneignen, wollten sie akzeptabel bleiben. Dort, im »Juste Milieu«, in den Salons, in denen sich Künstler, Politiker, Hochfinanz und Mitglieder der Aristokratie munter vermischten, herrschte ein lebhafter offener Austausch. Doch wenn es ans »Eingemachte«, nämlich um Machtpositionen ging, dann wurden die gesellschaftlichen Standesgrenzen und der Paternalismus der alteingesessenen Familien schnell sichtbar, selbst unter Partnern. Hier hatten die umgirrten Galane wie Chopin oder Liszt wenig zu melden. Uber acht Jahre lebte Chopin mit George Sand und deren Kindern Maurice und Solange in gutem Einvernehmen zusammen. Chopin war mehr als nur ein Liebhaber der Mutter. Obwohl Sand vermutete, »er weiß selber nicht, auf welchem Planeten er lebt«, hatte Chopin doch auch irdische Züge (Sand 2003, S. 168). Er ließ sich auf die Familie ein, unternahm auch allein mit den Kindern Ausflüge in den Zoo oder Spazierfahrten. Einmal ließen sie sich auf den Champs-Elysées wiegen: die elfjährige Solange brachte »nach dem Frühstück« 84, Chopin 97 Pfund auf die Waage, wie das Mädchen der Mutter erzählte. Als Chopin dann später Partei für Solange ergriff und sich gegen die gesellschaftspolitisch orientierten Heiratspläne der vermögenden aristokratischen Mutter aussprach, nahm George Sand den Dissens zum Anlass, um Chopin endgültig zu verabschieden (Chopin 1984, S. 267ff. und 422). Diesbezüglich war auch Liszts Position nicht viel glücklicher. Seine drei Kinder mit Marie d'Agoult hatte er legitimiert. Sie wuchsen in Paris in Obhut der Großmutter Liszt und diverser Gouvernanten auf. Ihre Eltern sahen diese Kinder jahrelang nicht. Marie d'Agoult hatte gegen die ungeschriebenen Spielregeln der Gesellschaft verstoßen, als sie ihren Mann verließ, um Liszt zu folgen. Nun war ihr Herz an ihn gekettet, und sie konnte weder mit ihm noch ohne ihn leben, eine »galérienne de l'amour«, wie Balzac formulierte (S. 9). Sie musste sich ihren Platz in der Pariser Gesellschaft erst wieder zurückerobern. Doch wollte sie die Kinder weder bei sich haben, noch sollten sie unter Liszts Einfluss stehen. Stattdessen wurden sie als Spielbälle im Zwist der Eltern funktionalisiert. Ihre im Kloster erzogene gräfliche
360
Handlungsreisende
Halbschwester Claire-Christine sowie weitere Mitglieder der einflussreichen mütterlichen Familie d'Agoult lernten die Lisztschen Kinder erst 1851 kennen, als sie wie kleine »Eleven« behutsam in deren Pariser Salon eingeführt wurden. Blandine war bereits 16, Cosima 14 Jahre alt (Walker 1989, 2, S. 435fF). Wie die bei Walker abgedruckten Quellen zeigen, nahm Liszt seine Verantwortung durchaus ernst, wenn auch meistens von so fern, dass seine Kinder die väterliche Fürsorge überwiegend durch Briefe kennen lernten. Cosima Wagner beschrieb ihren abwesenden Vater rückblickend als eine »phantastische Erscheinung«, die sie in ihrer Kindheit »vorbeistreifen sah« (in: Burger 1986, S. 250). Liszt investierte viel Geld in eine strenge Erziehung und gediegene Ausbildung. Gleichwohl war er Lichtjahre vom biedermeierlichen deutschen Familienidyll entfernt. Immerhin hatte er Schumann bereits 1839 einen Einblick in seine familiäre Situation gewährt: »Sie wissen, oder vielleicht auch nicht, dass ich eine kleine Tochter von 3 Jahren habe«, so Liszt. »Sie heißt Blandine-Rachel und ihr Kosename ist >moucheron< (Mückchen) [...] Zwei oder drei Mal in der Woche (an besonders glücklichen Tagen!) spiele ich ihr abends Ihre Kinderszenen vor, was sie entzückt und mich fast noch mehr, wie Sie sich vorstellen können« (5. Juni 1839, in: Seibold 2005, 2, S. 27f). Auch Clara Wieck dürfte damals gut über Liszts Privatleben informiert gewesen sein, denn Liszts Mutter besuchte sie mehrfach. Im selben Jahr begann auch der Abdruck von Honoré de Balzacs Studie Béatrix im Feuilleton der Zeitschrift Le Siècle, der in Paris als Schlüsselroman der d'Agoult gelesen wurde (Balzac 2004, S. 479 und 529). In Deutschland entwickelte sich die Situation der Künstler im Vormärz anders als in der Pariser Kunstszene. Die Schumanns wie die Mendelssohn Bartholdys lenkten in den 1840er Jahren ihr romantisches »Fernweh nach der Zukunft« (Norbert Nagler) auf konkrete Ziele. Sie konzentrierten sich ästhetisch auf Verfeinerung und Innerlichkeit und sozial auf die Familie als intimen Schutzraum. So richteten sich die Komponierenden im bürgerlichen Alltag ein und versuchten, ihre künstlerische Berufung in gesellschaftlich akzeptierte Berufe zu transformieren. In der durch Patrizier geprägten Leipziger Stadtkultur nahmen sich die Schumanns und Mendelssohns vor, ein neues selbstbestimmtes Bürgertum zu vertreten, eine eigene, von der Infrastruktur der politischen Obrigkeit unabhängige Kultur zu verwirklichen und selbstbewusst die dazu nötigen Institutionen zu unterhalten beziehungsweise neu zu schaffen wie das 1843 von Mendelssohn Bartholdy gegründete Konservatorium. Dass die Künstler in ihren familiären Idyllen dabei gleich-
Stationen eines komplexen Verhältnisses
361
wohl ein stets gefährdetes Leben führten, weil die von ihnen initiierten Einrichtungen sich wirtschaftlich noch nicht trugen, dürfte nun umgekehrt aus französischer Perspektive schwer zu erkennen gewesen sein. Dort registrierte man vor allem den kollektiven Rückzug ins Provinzielle. Auch die ästhetischen Auseinandersetzungen verliefen unterschiedlich. Während in Frankreich seit den 1830er Jahren Victor Hugos Konzept einer »Harmonie der Gegensätze« (in: Berger 1983, S. 3 ff.) den Diskurs bestimmte, nach der Erhabenes und Tragisches sich mit Groteskem, Hässlichem und Vulgärem verbinden sollte, um der Kunst inhaltlich Lebenswahrheit zu geben und auch formal die noch immer bestehende Vorherrschaft des längst ausgehölten klassischen Formideals zu brechen, verfolgte man in Deutschland einen eher entgegen gesetzten Kurs. Statt ästhetischer Barrikadenstürme favorisierten Komponisten wie die Schumanns oder Mendelssohns immer deutlicher eine auf Verinnerlichung und Tiefe zielende sorgfältige handwerkliche Kompositionsarbeit. Dabei blieben sie einer Ästhetik des Schönen verpflichtet. Bereits 1835 hatte Zuccalmaglio in einem maliziösen Beitrag für die NZfM seinen Vorbehalten gegen den Einfluss moderner zeitgenössischer Tendenzen der französischen Poetik auf die deutsche Musikästhetik freien Lauf gelassen. So beschrieb er als visionären Alptraum ein als »Preissinfonie« ausgelobtes Werk ä la Berlioz' Symphonie fantastique, dessen einzelne Sätze sich an Dichtungen von Lamennais, Balzac, Victor Hugo und, im Menuett »recht liederlich«, von »Frau Dudevant« (George Sand) orientierten, »jener geistigen Dodekamechana, jener Bajadere des Tages, die mit ihrem sinnbildlichen Beinaufheben die fein gebildete hohe Welt entzückt« (in: GS 1, S. 137f). In Schumannschen Rezensionen von 1839 und 1840 findet sich die einschlägige Metaphorik, mit der Liszt auch von den späteren »Konservativen« noch abqualifiziert wurde. Schumann zählte Liszt aufgrund seiner Österreich-ungarischen Herkunft als Deutschen. Allerdings sei er stark durch die französische Gesellschaft korrumpiert worden. Für den deutschen Anteil in Liszts Kompositionen setzte Schumann die Kategorie »sehnsuchtsvoll«, für den französischen mit deutlich wertender moralischer Implikation »frivol« (GS 1, S. 439). Im idealisierten Lebenskonzept der Schumanns hatte eine so schillernde, quirlige Figur keinen rechten Platz. So fand auch Robert Schumann Liszt »sehr aristocratisch verwöhnt«, und er konterte auf Liszts Bedauern über die fehlende Eleganz im provinziellen Leipzig mit dessen lokalem Geistes-Adel, »nähmlich 150 Buchhandlungen, 50 Buchdruckerein u. 30 Journale«. Doch Liszt »lachte«, so Schumann, »bekümmerte sich nicht ordentlich über die hiesigen Gebräuche pp, und so ergeht es ihm denn jetzt
362
Handlungsreisende
schrecklich in allen Journalen« (Bw, S. 1000). Anlass fiir die allgemeine Empörung war ein Skandal um die überhöhten Eintrittspreise zu Liszts Konzerten. Clara Schumann befand sich Anfang der 1840er Jahre in einer Phase, in der sie sich wie ihr Mann intensiv kompositorisch weiter qualifizierte und daher mit besonders rigorosen Ansprüchen aufwartete. Ästhetisch näherte sie sich einem ausgewogenen »klassizistischen« Schönheitsideal. Dazu passt, dass sie von der »frivolen, gemeinen, zerrissenen, unwahrscheinlichen« Handlung »angewidert« war, als sie 1841 Hugos Roman Notre Dame de Paris (Der Glöckner von Notre-Dame) las. Im »ganzen Werk ist nicht ein nobler Character zu finden«. Uberhaupt wäre »diese Art Werke [...] nur fiir die Franzosen, die nur das grelle, schauderhafte lieben. Für ein deutsches gesundes Gemüth aber ist solch ein Werk Greuel« {Tb 2, S. 150f). Clara Schumanns Urteil demonstriert plastisch eine politisch funktionalisierbare Vermischung von ästhetischem und moralischem Ethos wie sie in zeitgenössischen deutschen Diskursen zu finden ist. Aus dieser Perspektive widersetzt sich die französische Kunst sowohl der ästhetischen Forderung nach einem überhöhten, idealisierten Konzept, als auch einer entsprechenden ethischen Gesinnung, die der produzierende Dichter ebenso wie seine Charaktere vermissen lassen. Diese Maßstäbe wandte die Künstlerin auf Liszt an. M i t seinem exzessiven furiosen Pathos verstieß er gegen die selbst gewählten ästhetischen wie gesellschaftlichen Normen nicht nur der Schumannschen Künstlergemeinschaft. Den Komponisten könnte sie »beinahe hassen«, schrieb Clara Schumann ihrer Mutter (29. Dezember 1841). Im Rückblick von heute kamen dagegen wesentliche Impulse für die neue Musik dann tatsächlich durch eine Radikalisierung künstlerischer Subjektivität, wie sie sich bei Liszt schon ankündigt. Sicher spielte bei Clara Schumanns Ablehnung auch eine gehörige Portion Neid auf die unterschiedlichen Karriereverläufe eine nicht eingestandene Rolle. Während Liszt Anfang der 1840er Jahre die »alte Welt« zwischen Berlin, Paris, Lissabon, Konstantinopel und Odessa im Sturm eroberte, arbeiteten die Schumanns an ihrer familiären Idylle. Allerdings waren auch sie keineswegs sesshaft, sondern in den 14 Jahren ihres Zusammenlebens ständig unterwegs, und sie wechselten häufig die Adresse, wenn auch nicht immer freiwillig. Mal waren die Wohnungen ungeeignet, für die wachsende Kinderschar zu klein, mal gefiel ihnen das dürre soziokulturelle Umfeld nicht, wie in Dresden. Meist fehlten aber die Verdienstmöglichkeiten vor Ort. »Wir denken noch ein Jahr hier zu bleiben, und dann nach Wien, Paris oder Petersburg [...] zu ziehen«, hatte die Künstlerin noch 1842 hoffnungsvoll Stationen eines komplexen Verhältnisses
363
an Viardot-Garcia geschrieben (in: Ackermann / Schneider 1999, S. 72f.). Daraus wurde nichts. Sie blieben in der Provinz. Trotz der Geburt von acht Kindern kreuzte Clara Schumann während ihrer Ehe auf über 15 nationalen und internationalen Tourneen Liszts kometenhafte Spur (de Vries 1996, S. 348fF). Allerdings blieben die Erfolge ihrer Konzerte in dieser Phase deutlich hinter Liszts Triumphen zurück. Das Verhältnis von Clara Schumann und Liszt verkomplizierte, dass die Virtuosin nicht bloß in ihren beruflichen Zielen, sondern auch in ihren persönlichen Anlagen einige mit Liszt übereinstimmende Merkmale zeigte. Von Beginn der Ehe an hatten sich Liszts bohemehafte Selbstinszenierungen kontraproduktiv auf die Auftrittspläne der Künstlerin ausgewirkt, denn sie bestärkten Robert Schumanns Wunsch, dass seine Frau sich so weit wie möglich von einem derart aufreibenden Lebensstil auf öffentlichem Parkett entfernen möchte. Noch während der turbulenten Tage mit Liszt im März 1840 sandte Schumann seiner Braut eine für die Virtuosin durchaus alarmierende Botschaft. »Aber, Klärchen, diese Welt ist meine nicht mehr, ich meine die seine. Die Kunst, wie Du sie übst, wie ich auch oft am Ciavier beim Componiren, diese schöne Gemüthlichkeit geb' ich doch nicht hin für all seine Pracht« (Bw, S. 988). Tatsächlich musste die Virtuosin im Laufe der Ehe erst lernen, »gemütlich« zu werden. Vor allem nach den Tourneen brauchte sie eine gewisse Zeit, um im engen häuslichen Alltag anzukommen. »So glücklich ich war [...], wieder bei den Kindern zu sein, so war mir die plötzliche Ruhe nach so bewegtem Leben die ersten Tage peinlich«, liest man 1847 (in: Litzmann 2, S. 163). Schließlich genoss sie wie Liszt die Selbstinszenierung auf der Bühne und den Publikumsrausch - alles Kriterien, die ihrem Mann verschlossen blieben. Mit der Reduzierung ihrer Konzertaktivitäten während dieser Zeit verband sich bei allem, was sie durch ihre Familie an Lebensqualität hinzu gewinnen mochte, nicht nur ein spürbarer finanzieller, sondern auch ein Verlust an persönlicher Autonomie und Auftrittsmacht. So beneidete sie Liszt offensichtlich um dessen hedonistisch ausgelebten »Flow«: »Dieser Uebermuth, diese Lust, mit der er [...] spielte, war einzig!« (Tb 2, S. 197). So einen Duopartner brauchte man nicht ständig anzutreiben wie Moscheies. Der flog von selbst. Sie waren beide »Feuerseelen«. Mit soviel Schwärmerei hatte Clara Schumann sich als junge Ehefrau allerdings gehörig die Finger verbrannt. Für den umwerfenden Erfolg, den sie auf der Bühne mit Liszt zusammen im Dezember 1841 erzielte, erntete sie zu Hause Kritik. »Ich war nicht zufrieden, sogar sehr unglücklich diesen Abend und die folgenden Tage, weil Robert von meinem Spiel nicht befriedigt war« {Tbl, S. 195f). Was ihm daran missfiel,wird nicht überliefert. Dass 364
Handlungsreisende
Clara Schumann aber an einem harten Selbstdisziplinierungsprogramm arbeitete, lassen die Aufzeichnungen schon in der Verlobungszeit deutlich erkennen. Liszt verkörperte vieles, was sie an sich selbst zügeln wollte, etwa das »stürmische« Temperament, den Geschwindigkeitsrausch oder die Reiselust. Das alles widersprach dem deutschen Innerlichkeitsbestreben zutiefst, und es konterkarierte gründlich die im bürgerlichen Intimitätskult vorgesehene ideologische Rolle der Hausfrau und Mutter, die sozial und politisch als strategische Gegenfigur zu »frivolen« Aristokratinnen, wie die Baronin Dudevant (George Sand) oder die Gräfin d'Agoult, konzipiert war. Um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, musste Clara Schumann ohnehin schon doppelte Überzeugungsarbeit leisten. So reichte es für sie nicht, die Berufstätigkeit bloß aus wirtschaftlichen Gründen zu erwägen. Vielmehr ging es darum, den Anteil an Berufung zu retten und ihren Mann von der Kulturarbeit auf der Bühne im Sinne einer humanitären Erziehung zu überzeugen. Robert Schumann behagten indessen die machtvollen imperialen bis despotischen Gesten der Bühnenkünstler grundsätzlich wenig, wie seine Kritik am Dirigenten Mendelssohn Bartholdy von 1836 zeigt (GS 1, S. 118 und 479). Umtriebig- und Rastlosigkeit oder lautstarke Agitation auf öffentlichen Foren standen für das »Andere«, das Fremde und Auszugrenzende. Die Virtuosin geriet hier zwischen die Fronten. Die »Hausfrau«, die sie sein wollte, diente der Stabilisierung nach innen, um Schumanns Befindlichkeit und damit auch dessen künsderische Produktivität positiv zu beeinflussen, und sie diente der bürgerlichen Fassade nach außen. Zum offenen Bruch führte dann eine Szene bei einem Schumannschen Hauskonzert in Dresden im Juni 1848. Liszt kam zwei Stunden zu spät. So etwas kannte man von ihm schon. Er traf bereits auf reichlich vergrätzte Gastgeber. Dieses Mal schien ihn die provinzielle Stübchenidylle, in die er hineingeriet, zu nerven und er etikettierte Schumanns neueste Kammermusik, die er kredenzt bekam, ganz ungalant mit »leipzigerisch«, anstatt den Fortschritt der kompositorischen Verfeinerung darin anzuerkennen. Als Liszt dann noch Meyerbeer auf Kosten von Mendelssohn verteidigte, war das Maß voll. Der Hausherr verließ wütend den Raum, und der Gast wurde verabschiedet, so jedenfalls die von Litzmann wiedergegebene Version. »Robert hatte das zu tief verletzt, als daß er es jemals vergessen könnte«, trug Clara Schumann ins Tagebuch ein. Sie hätte »für ewige Zeit« mit Liszt »abgeschlossen« (in: Litzmann 2, S. 122; Tb 3, S. 462). Offensichtlich hatte Liszt aber Clara Schumann viel tiefer getroffen als ihren Mann. Mit einer wegwerfenden Geste entwertete er aristokratisch arrogant die Früchte jahrelanger Aufbauarbeit. Das war zu viel. Dass sie sich vollkommen mit den ProStationen eines komplexen Verhältnisses
365
dukten ihres Mannes identifizierte, für deren Gelingen sie ihre eigene Karriere zurück gestellt hatte, ist auch aus anderen Situationen belegt. In Wien beklagte sie 1846 die Kälte des Publikums gegen Schumanns Komposition bitter, was der Komponist mit der weisen Prophezeiung kommentierte: »Beruhige Dich, liebe Clara; in zehn Jahren ist das alles anders!« (in: Litzmann 2, S. 146). Doch Clara Schumann hatte einen zu hohen Preis für ihre Idylle bezahlt, um Liszts Fauxpas hinnehmen zu können. Selbst bei der Popularisierung von Kunst ließ er sie im Stich, seit er an seinem 36. Geburtstag die Virtuosenkarriere abgebrochen und sie als »widerliche Notwendigkeit« denunziert hatte (in: Burger 1986, S. 166ff). Diese Vermutung stützt Hanslicks rückblickende Einschätzung von 1869: »Liszt wäre es ein Leichtes gewesen, Schumann ein Jahrzehnd früher in ganz Deutschland bekannt zu machen« (Concertwesen 1, S. 429). Ihr Widerwille ging so tief, dass fortan allein Liszts Name schon somatische Reaktionen bei Clara Schumann ausgelöst zu haben scheint. Auch Liszt war betroffen von der heftigen Reaktion der Schumanns. So machte er in den folgenden Jahren immer wieder Kontaktangebote. Doch Clara Schumann gab ihm keine Chance mehr, obwohl sich Liszt gerade in der Krankheitsphase ihres Mannes für sie engagierte. Seine Einladung nach Weimar im Oktober 1854 hatte sie selbst forciert, und sie musste annehmen, da das Honorar gebraucht wurde. Als Liszt sie zur Überraschung aller zur Begrüßung küßte, fuhr sie offenbar innerlich alle Stacheln aus. In der spontanen Geste dürfte auch ein Stück Bewunderung dafür gelegen haben, dass die spröde Kollegin ein Kleeblatt treu ergebener junger Ritter um sich scharrte. Immerhin war es ihr gelungen, Joachim von der Lisztschen auf die Schumannsche Seite zu ziehen. Die ganzen Weimarer Tage scheint sie in Liszts Nähe eine physische Unbehaglichkeit verbreitet zu haben, die sich als Nervosität und besondere Striktheit ausdrückte, folgt man der Beschreibung von Sabinina. Liszt sei es egal, ob eine Note fehle oder nicht, so die Schumann zu ihrer ehemaligen Schülerin, »für mich ist es aber überhaupt nicht egal. Liszt kann mein Spiel nicht mögen, [...] es dürfte ihm etwas hausbacken vorkommen.« Das stimmte (in: Lossewa 1997, S. 216ff). Auch bei späteren Treffen und gemeinsamen Privatauftritten zündete offenbar das virtuose Feuer zwischen ihnen nicht mehr. Diese Erfahrung ging in Liszts Charakteristik der »Priesterin« als »starr« und »streng« ein. Anstelle eines Dankbriefes auf die über 80 Seiten umfassende Clara und Robert-Schumann-Serie in der NZß\4 1854/55 ließ sie ihm über Breitkopf 8c Härtel bloß das von Ernst Rietschel entworfene Doppelporträt zukommen. Sie hätte die Artikel weder gelesen, noch aufbewahrt versicherte sie Emilie List (in: Wendler, S. 187). 366
Handlungsreisende
Die bis an Liszts Lebensende andauernde Kommunikationsverweigerung fällt deswegen besonders auf, weil Clara Schumann nicht nur sehr gut differierende Positionen ansprechen, sondern auch bemerkenswert diplomatische Fähigkeiten entfalten konnte, wenn es um musikpolitische Grabenkämpfe ging. Hermann Levi etwa zählte zu ihren langjährigen Freunden. Sie hatte ihn als Kapellmeister in Karlsruhe kennen und schätzen gelernt. Als Levi dann nach München wechselte und darüber hinaus in Bayreuth diente, wo er ab 1876 an den Proben zum Ring mitwirkte und 1883 die Uraufführung des Parsifal leitete, schaffte Clara Schumann es, Levis musikalisches Engagement für Wagner und ihre private Freundschaft zu trennen und sie selbst vor Brahms zu verteidigen. Mit Liszt wollte oder konnte sie sich nicht arrangieren. Robert Schumann hatte dagegen schon einige Zeit nach dem Dresdner Zerwürfnis den Kontakt zu Liszt wieder aufgenommen. Schließlich waren beide wichtige Funktionäre im deutschen Musikleben der Jahrhundertmitte. In den 1850er Jahren wurden in Deutschland vielfältige und ganz unterschiedliche Diskurse verfolgt, die sich schlecht in »fortschrittlich« oder »konservativ« (aus der Sicht der Liszt- und Wagner-Anhänger) einteilen ließen. Schumann und sein Nachfolger als Herausgeber der Neuen Zeitschrift für Musik, Franz Brendel, zogen in ästhetischen und vor allem in institutionellen Belangen im Prinzip am selben Strang. Beide verfolgten einen ähnlichen geschichtsphilosophischen Ansatz, das heißt sie reflektierten ihren Standpunkt in theoretischen Texten, wenn auch in unterschiedlichem Stil. Schumann favorisierte eine poetische Metaphorisierung, eine farbige, sinnliche Darstellung, den so genannten »Davidsbündler-Styl« (August Wilhelm Ambros), während Brendel eher >wissenschaftlich< prosaisch schrieb. Schumann sah jetzt den Fortschritt darin, die Kompositionsgeschichte weiter zu schreiben, indem man aus der Aneignung, der Auseinandersetzung und in Abgrenzung von den »Meisterwerken« der Vergangenheit neue Impulse für das eigene Komponieren entwickelte und dabei so klar und einfach schrieb, dass die Musik einem allgemeinen Publikum zugänglich wäre. Daher konnte er seinem Librettisten Richard Pohl, der inzwischen in die »Parthey Liszt-Wagnerschen Enthusiasmus« eingetreten war, wie Schumann formulierte, mit dem ästhetischen Bekenntnis antworten: Was »Sie für Vergangenheitsmusiker (Bach, Händel, Beethoven)« halten, »das scheinen mir die besten Zukunftsmusiker. Geistige Schönheit in schönster Form kann ich nie für »einen überwundenen Standpunkt halten« (in: Geck 2001, S. 85). Brendel pointierte indessen stärker als Schumann die Position einer indiviStationen eines komplexen Verhältnisses
367
duellen Freiheit der Komponierenden im Blick auf die Zukunft. Einig waren sich beide darin, dass die zeitgenössische Kunst einer kritischen Reflexion bedürfe, um sich ihrer selbst zu vergewissern, wie schon die Frühromantiker behauptet hatten (Dahlhaus 1980, S. 209). Als Brendel 1847 die Gründung eines Deutschen Tonkünstlervereins initiierte und Schumann dazu nach Leipzig einlud, fuhr dieser allerdings nicht hin, sondern sandte nur einen Brief mit bereits bekannten Forderungen nach »Klassiker«-Ausgaben und einer institutionalisierten musikalischen Nachwuchsförderung. Der Schritt war umso unbegreiflicher, als Schumann 1837 selber schon einmal geplant hatte, eine musikalische Standesverbindung ins Leben zu rufen (Kawohl 2002, S. 186). Was immer auch der Grund gewesen sein mochte, seine Abwesenheit schadete ihm. So trat Brendel in diesen Jahren nicht nur redaktionell die Nachfolge Schumanns an, sondern er löste ihn in den Kunstdebatten auch als Verfechter des Fortschritts ab. Kritiker der inzwischen eher gegen die Interessen ihres Begründer handelnden NZfM rückten Schumanns Kompositionen Anfang der 1850er Jahre mehr an den »Klassizismus« des inzwischen verstorbenen Mendelssohn Bartholdy heran und weg von den Positionen musikpolitischer Erneuerer. Brendel bezeichnete die Musik Mendelssohns und Schumanns im Rückblick von 1859 sogar als »eine schöne Nachblüthe« der Romantik (Geck 2001, S. 85ff.; Kabisch 1988, S. 94). Stattdessen gaben jetzt Liszts Weimarer Artikel und Wagners programmatische Schriften Das Kunstwerk der Zukunft (1849/50) sowie Oper und Drama (1851) der Auseinandersetzung richtungsweisende Impulse. Am vielversprechendsten schien der fantastische Entwurf eines »Gesamtkunstwerks« als Synthese aller Künste. Davon hatte man allerdings, außer im Zürcher Haus der Wesendoncks, noch keinen Ton vernommen. Wagner selber befand sich bis 1862 im Exil. Bekannt wurden zunächst seine Opern Lohengrin und Tannhäuser, weil Liszt Wagners Ideen tatkräftig unterstützte und die Werke 1849 und 1850 in Weimar heraus brachte. Wenige Wochen zuvor war Schumanns Oper Genoveva op. 81 in Leipzig uraufgeführt worden. Allen Opern lagen fantasievolle mittelalterliche Sagen- und Märchenstoffe zugrunde. Diese dicht gebündelten Ereignisse entfachten kontroverses publizistisches Interesse. Für Brendel lag die Zukunft in der Oper. Aufbauend auf den radikalen, dem Diesseits zugewandten Grundsätzen der Philosophie der Zukunft Ludwig Feuerbachs, forderte Wagner - so Brendels Darstellung - eine der menschlichen Natur entsprechende Kunst, die »als einzig wahre, ganze Kunst aus der Vereinigung aller unserer Kunstarten hervorgeht« (Brendel 1852, S. 543). Sie sollte die Kluft zwischen der avancierten, hoch entwickelten und dabei 368
Handlungsreisende
abgehobenen Kompositionstechnik auf der einen, und den begrenzten Auffassungsmöglichkeiten des Publikums auf der anderen Seite überbrücken. Wagners damals revolutionärer, auf menschliche (Kunst-)Bedürfnisse und deren praktische Umsetzung gerichteter Ansatz ließ sich - unter Abstrich von Feuerbachs religionskritischer Komponente - mit Liszts früher Vision einer »musique humanitaire« verknüpfen. Liszt hatte inzwischen seine ersten Sinfonischen Dichtungen realisiert. Nach Wagners Hypothese vom Ende der Sinfonie nach Beethoven konnten nun im deutschen Diskurs die Sinfonischen Dichtungen wie ein Ausweg aus einer - zumindest behaupteten - kompositorischen Sackgasse gelten. Der Fokus lag dabei einmal auf einer Aufwertung von Instrumentalmusik durch die Poesie. Liszts Konzept beruhte darauf, dass Musik analog der Dichtung als »Träger von Ideen« (Dahlhaus 1988, S. 387) genutzt wurde. Erinnert man sich an die philosophischästhetischen und die juristischen Diskurse um den geistfähigen Status von Musik, so hatte sie lange hinter der Dichtung zurück gestanden. Im Konzept Sinfonischer Dichtungen profitierte Musik von der Würde der Poesie. Darüber hinaus führte der Rekurs auf die Dichtung fort von den inzwischen etablierten Formen reiner Instrumentalmusik. Schon Mischformen wie Mendelssohn Bartholdys Lobgesang op. 52, eine »Sinfonie-Kantate« für Soli, Chor und Orchester, Nils W. Gades Comala, Dramatisches Gedicht nach Ossian für Soli, Chor und Orchester op. 12 oder Schumanns halbszenische, mit deklamatorischen Partien durchsetzte Musik Manfred, Dramatisches Gedicht in drei Abteilungen nach Lord Byron op. 115, experimentierten mit neuen Mischformen von Vokal- und sinfonischer Musik. Indessen hatten alle Komponisten auch weiterhin rein instrumentale Sinfonien geschaffen. Was dort als Diskursanbindung praktiziert wurde, nämlich die immer neue Auseinandersetzung mit der Gattung Sinfonie, werteten Liszt und Wagner als historischen Stillstand, aus dem die immer gleich gestellten Gattungsfragen nicht herausführen könnten. Vor diesem Hintergrund erhalten Liszts Sinfonische Dichtungen ihren Platz. Im »Goethe-Jahr« 1849 brachte Liszt Tasso. Lamento e Trionfo nach Goethe und Byron heraus. Die Bergsinfonie, Ce qu'on entend sur la montagne und der Prometheus nach Herder erklangen 1850. Liszt nutzte seine Stellung als Hofkapellmeister, um umfassende Pläne zur Erneuerung der Kultur zu entwerfen und eine »nouvelle Ecole de Weymar« (in: Kleinertz 2006, S. 24) zu propagieren. Bei seinen Veranstaltungen wurden Werke von Berlioz, Wagner und auch von Schumann aufgeführt, die nach Liszts Vorstellungen eine hybride neue Form von Musik und Dichtung präsentierten, wie Schumanns Szenen aus Goethes »Faust« für Soli, Chor und Orchester WoO 3 und Manfred op. 115. Stationen eines komplexen Verhältnisses
369
Liszt brachte das Stück im Juni 1852 im Weimarer Hoftheater heraus, allerdings ohne Schumann, der erkältet war (»immer unwohl«, Tb 3, S. 596). Die Schumanns agierten auf ihre Weise rege und setzten selbst Akzente. So zelebrierten sie in Dresden 1849 ihre eigene Goethe-Feier, in Konkurrenz zu den Weimarern. Dass die Dresdner Veranstaltung mit einer allgemeinen öffentlichen Beteiligung draußen im Park verbunden war, zeigt ihren Anspruch, im Sinne einer »Volksbildung« zu wirken. Robert Schumann stellte dann seine dritte Sinfonie (Rheinische) op. 97 im Frühjahr 1851 noch taufrisch aus dem Manuskript in Düsseldorf den Lisztschen Sinfonischen Dichtungen entgegen (Tb 3, S. 791). Wie Liszt, so kämpften indessen auch die Schumanns mit organisatorischen Problemen, nämlich unzulänglichen Auffiihrungsbedingungen, knappen Etats, zu vielen Laien und zu wenig professionellen Musikern in den Orchestern, die diese groß angelegten, komplexen und keineswegs volkstümlichem Werke aufführen sollten. Die Weimarer Hofkapelle verfügte 1850 über 35 Mitglieder, dazu einen Chor aus zehn Männer- und dreizehn Frauenstimmen (in: Burger 1986, S. 174). Mit diesem Grundstock einen Lohengrin herauszubringen, war ein Kunststück für sich. In Düsseldorf sah es nicht besser aus: »Robert kam alterirt nach Hause«, liest man im Tagebuch 1851. »Der Gesangsverein ist ganz im Untergehen, kein Eifer, keine Liebe zur Sache da, und das Orchester ist vor der Hand noch nicht einmal zur Not vollständig, da jetzt kein Militärmusikkorps hier ist«, das heißt, dass qualifizierte Bläser fehlten. Clara Schumann ärgerte sich mit ihrem Mann über Musikliebhaber, die »nur« aus Spaß am Musizieren im Chor saßen und wenig Neigung mitbrachten, sich mit so schweren, sperrigen Stücken wie Bachs h-Moll-Messe abzuplagen (in: Litzmann 2, S. 240). Anstatt sich zu solidarisieren, um das Beste aus der noch reichlich unterentwickelten Musiklandschaft zu machen, grenzte man sich von einander ab. Liszt führte in seinen Weimarer Jahren immerhin mehr Schumann-Musik auf als jeder andere Veranstalter (außer Schumann selbst). Sieht man von den ideologischen Scheuklappen der Schumanns einmal ab, so mochte bei den ganzen Rivalitäten auch eine Rolle spielen, dass im frühkapitalistischen Umfeld jener Jahre jeder verbissen für sich und seine eigenen Interessen stritt, während es für Kooperationen weder politische noch wirtschaftliche Vorbilder gab. Dabei übersahen selbst Liszts Anhänger, wie viel Arbeit darin steckte, Festivals zu organisieren, Opern aufzuziehen, beim Großherzog immer wieder die nötigen Mittel einzuwerben und die gesamten Aktivitäten auch noch publizistisch zu verbreiten. Nur Peter Cornelius, der einen Teil von Liszts französisch verfassten Artikeln übersetzte, stöhnte gehörig über dessen Arbeitseifer (Seibold 2005 1, S. 266). 370
Handlungsreisende
Dazu kam Liszts angreifbarer Lebensstil, der die Glaubwürdigkeit seiner Absichten immer wieder konterkarierte. Als Liszt während eines Urlaubs im Rheinland 1851 den Schumanns seine »künftig sein sollende« Frau, Carolyne Fürstin von Sayn-Wittgenstein samt deren 14jähriger Tochter vorstellte, waren die Schumanns allerdings »überrascht, in der Fürstin eine etwas matronenhafte Frau zu finden« - sie war so alt wie Clara Schumann - , »die nur durch ihre Liebenswürdigkeit und ihren Geist und feine Bildung, was sie alles im wahren Sinn des Wortes besitzt, ihn fesseln kann«. Was hatten sie erwartet? »Ich mag die Fürstin sehr und kenne alle ihre Vorzüge«, ließ Clara Schumann später Sabinina wissen (in: Lossewa 1997, S. 217). Ausgerechnet der Kosmopolit Liszt besetzte den Standort Weimar. Die Stadt mochte ein konservatives Provinznest sein und der Hof kaum über bessere Auffiihrungsbedingungen verfugen als andere, doch Weimar, das war die Stadt Herders, Goethes und Schillers, den Gründungsheroen einer deutschen Literaturtradition. Durch geschickte Hofpolitik hatte sich Weimar im späten 18. Jahrhundert in ein kulturelles Zentrum verwandelt. In den Gedenkjahren 1849 (Goethe) und 1859 (Schiller) erstrahlte in Weimar, zumindest zeitweilig, noch einmal der alte Glanz, als es in den Mittelpunkt einer an nationaler Kunst beteiligten bürgerlichen Öffentlichkeit rückte (Becker 2003, S. 23). Liszt zog sein Projekt »Weimar« mit weitreichender Perspektive auf und rührte die große Werbetrommel. Strategisch ging er umfassend vor, wie Detlef Altenburg und Britta Schilling-Wang nachgezeichnet haben (in: Liszt, Schriften 3, Vorwort und S. 257ff). Er nutzte einen im Juli 1849 in deutschen Tageszeitungen veröffentlichten Aufruf zur Gründung einer deutschen Goethe-Stifung, die unter anderem Adolph Diesterweg, Wilhelm Humboldt, Ludwig Rellstab und Karl August Varnhagen van Ense unterzeichnet hatten, um seinen opulenten Entwurf De la Fondation Goethe zu platzieren. Das Projekt sah eine breite Kulturförderung von Literatur, Musik, Bildender Kunst und ästhetischer Theorie vor. Wettbewerbe und Festivals sollten die öffentlichen Foren bilden, Weimar das Zentrum sein. Liszt publizierte noch 1849 im Pariser Journal des Débats einen programmatischen Bericht über die Goethe-Feiern und lieferte 1851 in der umfangreichen Schrift über die Goethe-Stiftung ein ausgearbeitetes Programm, samt historischer und kulturpolitischer Begründung nach {Schriften 3, S. lff. und 21ff). Durch auswärtige Korrespondenten gelangte die Neuigkeit in internationale, auch überseeische Zeitschriften. Außerdem hatte Liszt geschäftstüchtig einige Exemplare der mit dem preußischen Prinzen Wilhelm verheirateten Weimarer Prinzessin Augusta überreicht, als sie im Sommer 1851 auf Einladung von Queen Victoria zur Weltausstellung nach London reiste. Stationen eines komplexen Verhältnisses
371
Liszts Entwurf löst kontroverse Diskussionen aus. Während in Frankreich die Ideen für ein »Ilm-Athen« sogleich Anlass zur Persiflage gaben, begann unter deutschen Gegnern und Befürwortern eine aufgeregte Diskussion. Dabei spielte Liszts schillernde Person nur eine Rolle im Stimmengemisch der Meinungen. Musste ausgerechnet ein französisch sprechender, mit ungarischem Ehrensäbel umhängter Virtuose Goethe beerben und deutsche Kulturpolitik betreiben? Rellstab unterstützte die Sache grundsätzlich, der nationalen Bedeutung wegen, und auch Varnhagen van Ense, der schon seit Goethes Tod den Plan verfolgte, in Weimar eine Akademie für Kunst und Wissenschaft zu gründen, stand dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber (Altenburg/Schilling-Wang, in: Liszt, Schriften 3, S. 194ff). Trotzdem ging es nicht recht voran, und das lag nicht an den ideologischen Differenzen, Künstlerrivalitäten oder den sofort einsetzenden Hofintrigen allein. Vielmehr kreuzte Liszt zugleich in politisch brisanten, internationalen Hoheitsgewässern. Darauf machte ihn die in Bad Eilsen weilende Sayn-Wittgenstein vorsichtig aufmerksam. Preußens aggressive Unionspolitik der 1850er Jahre wurde von Osterreich attackiert. Russland stützte Österreich, um seine Position im Machtgefüge gegenüber der expansiven Politik der westeuropäischen Staaten auszubauen. In England und Frankreich wurden diese Schritte aufmerksam verfolgt. An einem vereinigten Deutschland unter Preußen war im Ausland niemand interessiert. Dass ausgerechnet in Weimar ein die deutschen Länder ideologisch einendes nationales geistiges Zentrum entstehen sollte, erschien daher pikant. Schließlich regierte mit Maria Pavlovna eine Schwester des Zaren am Weimar Hof. Dort ruderte man beflissentlich zurück. Liszts hochfliegende Pläne schmolzen zusammen (Altenburg/Schilling-Wang, in: Liszt, Schriften 3, S. 267ff). Auch auf gesellschaftlicher Ebene verstärkte sich der Widerstand. Den Bürgerlichen war das Projekt zu abgehoben. Rellstab sprach aus, was viele dachten, dass nämlich in der »wüsten, wirren Zeitrichtung, die [...] in sich zersplittert, sich selbst bekämpft und vernichtet« vorerst keine Kräfte vorhanden seien, um »diese idealen Traumbilder« zu verwirklichen (Vossische Zeitung, 2. April 1851, in: Liszt, Sämtliche Schriften 3, S. 269). Überdies gefielen weder den Demokraten, noch anderen Fürstenhöfen die bevorzugte Rolle des Weimarer Großherzogtums. Wenig Anklang fand bei den Intellektuellen überdies die Idee, einen künstlerischen Wettbewerb auszulohen. Selbst Wagner, der von Liszts Plänen überaus profitiert hätte, riet ihm von der »Kunstlotterie unter der Firma Goethe ab« (in: Liszt, Schriften 3, S. 276). Viele der von Liszt entwickelten Ideen kamen den von Semper formulierten Vorschlägen aus Kunst, Industrie und Wissenschaft nahe, wie der Wett372
Handlungsreisende
bewerb, die Festivals und die Anregung einer begleitenden ästhetischen Theorie. Der entscheidende Unterschied lag indessen in der Blickrichtung: Während Semper von der neuen industriellen Entwicklung und einer sich abzeichnenden Massenkunst ausging, bei der die Bürger die treibende Kraft waren, hielt Liszt sich an das Modell eines großherzoglichen Mäzenatentums wie in der Goethezeit. Die Realisierung seiner Ideen blieb an feudale Strukturen gebunden. Indessen hatte die Chuzpe, eine neue Weimarer Schule, die das musikalische Kunstwerk der Zukunft lehrte, international zu verkünden, in der Tat ein anderes Prestige als die Fortschrittsrufe der Schumanns aus Dresden oder Düsseldorf. Auch deshalb wollte man dieses Vorhaben Liszt doch lieber aus der Hand nehmen. Schumann setzte im Streit um die Zukunft 1853 einen gezielten Coup mit seinem Aufsatz Neue Bahnen, in dem er Brahms' Musik als kommende Avantgarde propagierte. Ein hellblonder Parzival. Niemand kannte ihn. Bei der Durchreise in Weimar hatte er keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Flugs drückte Schumann dem gerade erst adoptierten und ansonsten noch völlig unbeschriebenen Zwanzigjährigen das Artusschwert in die Hand. Der so überraschend im Kampf um die Deutungshoheit funktionalisierte Brahms nahm die Rolle an. Parallel dazu bot Schumann mit der Herausgabe seiner Gesammelten Schriften ein Gegengewicht zu Liszts programmatischen Artikeln sowie Wagners beredter Textproduktion und positionierte noch einmal seine in 20 Jahren gewonnenen ästhetischen Uberzeugungen auf dem Buchmarkt, nun als geballtes Angebot in zwei Bänden zu vier Teilen, während Clara Schumann die wahre »gute« Musik in den Konzertsälen verbreitete. Alle beriefen sich auf Beethoven, alle sahen sich als sein Erbe, und jeder wollte um die Jahrhundertmitte volksnah sein. Die meisten verstanden sich als »fortschrittlich« oder als »zukünftig« und glaubten, der neuen Zeit entgegen zu eilen. Verbindliche Maßstäbe für das, was mit »fortschrittlich« bewertet werden sollte, gab es nicht. In diesem Gewirr unterschiedlicher Interessen, Koalitionen und Konkurrenzen verschärften zwei Ereignisse die Diskussion, nämlich einmal Brendels programmatisches Ausrufen einer »neudeutschen Schule« 1859 und die Gründung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 1861 als künftiger Standesorganisation. Die »Schule« war eine Anmaßung, die Liszt schon begangen hatte, und »neudeutsch« klang verdächtig nach dem einst so attraktiven Jungen Deutschland Heines (Altenburg und Kleinertz, S. 9ff). Vor allem setzte man sich damit von der inzwischen als weltfremd und verträumt geltenden »altdeutschen« Biedermeiergemütlichkeit ab. »Neudeutsch« umriss zunächst einen auf der neuen Basis einer praktischen Umsetzung formulierten, weiterzuführenden synästhetischen
Stationen eines komplexen Verhältnisses
373
Ansatz der Frühromantik. W i e Schumann, der in den 1830er Jahren unter anderem Chopin und Bennett zum idealistischen deutschen Fortschritt gerechnet hatte, so summierte Brendel unter die »Neudeutschen« neben Liszt und Wagner auch Berlioz und Schumann. Letzterer konnte sich 1859 nicht mehr wehren. Berlioz missfiel entschieden, als Vorläufer von Sinfonischer Dichtung im deutschen Richtungsstreit funktionalisiert zu werden. Clara Schumann war ihrerseits in keiner Form bereit, die Interessenvertretung über Werk und Bedeutung ihres Mannes ausgerechnet einem LisztWagnerschen Clan zu überlassen. Warum sie bei dieser Ausgangslage dann allerdings darauf verzichtete, das Zwickauer Schumann-Fest zum 50. Geburtstag des Komponisten im Juni 1860 in die Hand zu nehmen und es den »Weimarer Koryphäen« überließ, bleibt unergründlich. Anstatt als »gepanzerte« Kämpferin ihr Terrain zu verteidigen wie in Wien 1838, zog sie sich zurück. Womöglich hatte sie sich einschüchtern lassen von einer allgemeinen Stimmung, nach der sie als Frau nicht mit offenem Visier streiten konnte, ohne sich der »Frauen-Emancipation« verdächtig zu machen. Gegen die Proklamation einer »Neudeutschen Schule« sprangen die »1854er« in den Ring und initiierten einen allgemeinen Rundbrief. Darin widersprachen sie der Absicht, dass die »ernster strebenden Musiker« durch die Neudeutschen repräsentiert würden, und kündigten deren »Vertretern und Schülern« den Kampf an. Der Text wurde 1860 in der Berliner M u sikzeitung Echo veröffentlicht. Clara Schumann kam nicht mehr dazu, ihn zu unterzeichnen. W i e wenig Autorität der Protest von Brahms, Joachim, Grimm und Bernhard Scholz besaß, konnte man in der prompt verfassten Persiflage in der NZß\4 nachlesen. »Die Unterzeichneten wünschen auch einmal erste Violine zu spielen, und protestiren deßhalb gegen Alles, was ihrem dazu nöthigen Emporkommen im Wege liegt [...], J. Geiger. Hans Neubahn. Pantoffelmann. Packe. Krethi und Plethi« (in: C. M . Schmidt 1983, S. 20f). Brahms und Joachim, 20 Jahre jünger als Wagner und Liszt, hatten weder Opern noch Sinfonien im Gepäck, sondern hauptsächlich Klavier- und Kammermusik (Brahms) sowie Ouvertüren (Joachim). Für die Gegenseite blieben die beiden Schumann-Enthusiasten als Komponisten daher Leichtgewichte. Auch dass Anton Rubinstein sie 1857 belustigt als »Tugendpriester« tituliert hatte, stärkte ihre kämpferische Position nicht gerade (in: Litzmann 3, S. 20). Ende 1861 gab Liszt seine Weimarer Stellung auf. Damit verloren die gerade getauften Neudeutschen schon wieder ihr attraktives Zentrum. Mit Liszts Rückzug wuchs in den 1860er Jahren der Einfluss von Wagner auf die Deutungsmacht der Zukunft. Eine Dekade später mauserte sich dann Bayreuth
374
Handlungsreisende
zur Sammelstätte der »Wagnerianer«, die allerdings nicht unbedingt mehr identisch mit den ursprünglichen Neudeutschen waren. Hier rückte endgültig der Personenkult um den »Meister« ins Zentrum. Statt eines »Ilm-Athen« schwebte Wagner ein germanisches Olympia vor. Wagner polarisierte die musikinteressierte Gesellschaft auch nicht allein durch seine Musiksprache und die Ideen vom Gesamtkunstwerk. Mindestens ebenso provokativ wirkten sein pompöses Gehabe, der aufwändige Lebensstil und die peinliche Hofhaltung, die er betrieb. Liszt ließ sich einspannen, gab als Wagners »Pudel«, wie er sich selbst karikierte, Benefizkonzerte zur Finanzierung der Festspiele und spielte dann in Bayreuth doch nur eine untergeordnete Rolle als Schwiegervater. Was er in Weimar einrichten wollte, nämlich eine Institution, die alte und neue Musik förderte, war ihm nicht gelungen. In Bayreuth gab man nur Wagner. Ein Streiter fehlt noch auf der öffentlichen Bühne: Eduard Hanslick. Mit seiner ab 1853 im Vorabdruck und 1854 dann als Buch publizierten Schrift Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst setzte er einen Kontrapunkt im Musik reflektierenden Diskurs. Hanslick pochte auf den Kunststatus von Musik und vertiefte in einem systematischen Ansatz die Theorie einer musikalisch-ästhetischen Autonomie. Dabei berief er sich (ähnlich wie A. B. Marx und Brendel) auf die Objektivität wissenschaftlicher Maßstäbe, um den musiktheoretischen Diskurs von subjektiven Bekenntnissen zu trennen. Er ging von derlhese aus, dass Instrumentalmusik eine Lautäußerung wäre, die keine Inhalte oder metaphysischen Botschaften vermittelte, sondern »musikalische Ideen« in einer individuellen, von Komponierenden entworfenen Erscheinung (1854, S. 62). Seine Thesen boten Anknüpfungspunkte an Schumanns Idee von Musik als einer entpragmatisierten poetischen Sprache. Die Bedeutung dieser M u sik fokussierte Hanslick jedoch radikal auf ihre selbstbezügliche Referenz. »Die Ideen, welche der Componist darstellt, sind vor Allem und zuerst rein musikalische. Seiner Phantasie erscheint eine bestimmte schöne Melodie. Sie soll nichts Anderes sein, als sie selbst« (S. 45). Ihre Dignität als höchste Kunst erhielt die autonome Musik, weil sie etwas Allgemeines, Objektives in individueller Formulierung enthielte, das durch die abstrahierbare Form und die musikalische Logik der Verknüpfungen benannt werden könnte. Insofern seien »tönend bewegte Formen [...] einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik« (S. 75). Alles andere, was sonst noch an Gefühlen, Assoziationen und Erinnerungen beim Musikhören aufstieg, gehörte nicht zum Kunstwerk, sondern würde an die Musik von außen herangetragen, so Hanslicks Folgerung. Stationen eines komplexen Verhältnisses
375
Hanslicks Schrift war keine spekulative Ästhetik. Sie entstand vielmehr vor dem Hintergrund seiner bereits längeren Erfahrung als Rezensent und Musikschriftsteller. In Konzerten, an sich selbst und im Austausch über das Gehörte konnte der Autor immer wieder erleben, dass die Hörer während der Aufführungen »halbwach in ihrem Fauteuil geschmiegt, [...] von den Schwingungen der Töne sich tragen und schaukeln« ließen, »statt sie scharfen Blicks zu betrachten«. Diese von Hanslick als »pathologisch« denunzierte hedonistische Lust am »Elementarischen« wurde seiner Ansicht nach dem hohen Kunstcharakter zeitgenössischer Instrumentalmusik nicht gerecht. Stattdessen forderte er ein aufmerksames, gespanntes Zuhören, um das »ästhetische Merkmal des Geistigen« zu erfassen (Hanslick 1854, S. 129). Vor diesem Hintergrund wird deutlicher, dass der Rezensent Hanslick sowohl mit Clara Schumanns als auch mit Rubinsteins und von Bülows »objektiven« und »Werktreuen« Interpretationen viel anzufangen wusste. Hanslick formulierte 1854 (und in den rasch folgenden Nachauflagen der nächsten Jahrzehnte) eine Gegenposition zu Wagners Visionen vom Gesamtkunstwerk ebenso wie zu Liszts Konzept der Sinfonischen Dichtung, indem er die Autonomie von Musik als Kunst ins Zentrum stellte. Er positionierte sich als Galionsfigur der Wagnerkritik. Man bewarf sich gegenseitig kräftig mit Schlamm. Tatsächlich differierten Hanslick und Wagner gar nicht in allen Punkten. So verfochten beide die Absicht, der Kunst eine ihrem Rang entsprechende Würde zu geben. Die Begründung konnte allerdings kaum verschiedener ausfallen. Während Hanslick an den wachen, analytischen Verstand appelliert, setzte Wagner auf einen mystischen Rausch, der hellsichtig machen sollte. Es war Wagner, der gut 20 Jahre nach Hanslicks Forderung nach Konzentration auf die Kunst veranlasste, den Zuschauerraum im Bayreuther Festspielhaus dunkel zu lassen, um auch noch den letzten geselligen Rest gemeinsamen Kunstgenusses auszuschalten und eine ungeteilte Aufmerksamkeit jedes nun isolierten Mitglieds der Kunstgemeinde auf das Musikdrama zu erzwingen. Dazu hatte Wagner den monofunktionalen Raum des Festspielhauses überhaupt bauen lassen und nach Ideen Sempers (mit dem er allerdings inzwischen zerstritten war) den Orchestergraben mit einem Schalldeckel überdacht, so dass er unsichtbar blieb. Die zwischen der Bühne und den Sitzreihen entstandene Distanz nannte Wagner den »mystischen Abgrund«. Er hatte die Funktion, »Realität und Idealität« voneinander zu trennen. Daraus entstand die optische Täuschung, dass der kleinere, engere Bühnenraum als weiter entfernt wahrgenommen wurde, während die »auf der Szene auftretenden Personen vergrößert« und in »übermenschlicher Gestalt« erschienen. Durch das Dunkel »entrückte« das Bild in die »Unnahbar376
Handlungsreisende
keit einer Traumerscheinung«, so Wagner, »während die aus dem »mystischen Abgrunde< geisterhaft erklingende Musik, gleich den unter dem Sitze der Pythia dem heiligen Urschoße Gaias entsteigenden Dämpfen,« den Zuschauer »in jenen begeisterten Zustand des Hellsehens« versetzte, »in welchem das erschaute szenische Bild ihm jetzt zum wahrhaftigen Abbilde des Lebens selbst« werden sollte (Wagner o.J., 9, S. 336fF), so beschrieb Wagner das multimediale Ereignis aus stabgereimtem Gesang, Musik, Bild und Aktion. Schon das Pathos dieser Sprache brachte die Gegner auf. Die auf mythologischen Sagen beruhenden Stoffe von Wagners Opern gefielen Clara Schumann durchaus. Tannhäuser, Lohengrin, Rheingold und die Walküre hatte sie in München und Breslau gehört. In Erwartung vorbildlicher Helden und Heldinnen auf der Bühne empörten sie allerdings »solche Lumpen« wie »dieser Wotan«. Uberhaupt sah sie bloß »lauter lappige, schurkische Götter«. Trotzdem ging sie ein zweites Mal hin, um »mehr noch auf die Musik zu achten«, und sie fand wirklich »einige schön klingende Perioden, aber auch viele Anklänge an Mendelssohn - Schumann - Marschner« (in: Litzmann 3, S. 426f). Die Oper Tristan und Isolde, die sie 1875 in München sah, schockierte sie jedoch auf ganzer Linie. Die Verflüssigung der Musik zu einem unendlichen Tonemeer fand sie grässlich. Aber auch das Sujet und seine Umsetzung stießen sie ab. Die Liebenden »reissen sich förmlich das Herz aus dem Leibe und die Musik versinnlicht das in den widerlichsten Klängen!« Man würde »betäubt und verwirrt« von der Musik (in: Litzmann 3, S. 326ff). Das war Absicht. Und hätte sie in Wagners Oper und Drama gelesen, wie der »liebende Drang« des »dichtenden Verstandes« »dem herrlich liebenden Weibe Musik den Stoff zur Gebärung« zuführte (4, S. 103), sie wäre bestimmt nicht hingegangen. Nach Wagners und Liszts Tod wollten sie und Brahms gern »incognito« nach Bayreuth fahren. Leider war das unmöglich. Zu sehr fürchteten beide das öffentliche Spektakel, das losbrechen würde, wenn sie sich dort blicken ließen. »Den Parsifal fand sie zum Sterben langweilig«, erinnerte sich ihr Enkel Ferdinand (in: NZfM 1917, S. 87). In keinem Fall war es diese Musik, die für Clara Schumann das Erbe Beethovens vertrat. Immerhin durften ihre Enkel später Wagner-Opern anschauen, während sie ihnen Verdis Rigoletto verbot, weil der Stoff so drastisch war (NZfM 1917, S. 86). Clara Schumann richtete sich im Laufe der Jahrzehnte in ihrer Abneigung gegen Liszt und dessen Anhänger so gründlich ein, dass es ihr nicht gelang, auch nur ein halbwegs gelassenes Verhältnis ihm gegenüber zu entwickeln. Zu keinem Zeitpunkt war sie offenbar bereit, Liszts Aktivitäten überhaupt als Kulturarbeit anzunehmen und sein Weimarer Engagement vielleicht als Stationen eines komplexen Verhältnisses
377
effektivere Variante zu seinen Virtuosenkonzerten zu sehen. Obwohl sie Sabinina gegenüber zugab, dass Liszt sich in Instrumentation und »Klangeffekten [...] bedeutend vervollkommnet« hätte, führte nicht sie, sondern von Bülow Liszts 1854 publikumswirksam Robert Schumann gewidmete h-Moll-Sonate auf. Weder die weiteren Klavierwerke noch die Sinfonischen Dichtungen oder seine geistlichen Werke wie die Graner Messe stießen bei ihr auf Gnade. Liszt brachte 1872 sogar Transkriptionen von Clara Schumanns RückertLiedern »Warum willst Du andre fragen« op. 12 Nr. 3 und »Ich hab' in Deinem Auge« op. 13 Nr. 5 sowie vom Rollett-Lied »Geheimes Flüstern« op. 23 Nr. 3 zusammen mit verschiedenen Liedern von Robert Schumann heraus - ein letztes Angebot an die noch immer geachtete Kollegin. W i e sie darauf reagierte, ist nicht bekannt. Entgangen sein dürften ihr Liszts Transkriptionen nicht. Vielmehr scheinen sie sie dazu bewogen zu haben, 1873 selbst im Auftrag des französischen Verlegers Gustave Alexandre Flaxland SchumannLieder für Klavier solo zu bearbeiten, »bevor ein Andrer es [...] vielleicht weniger gut machen würde« (in: Bromen 1997, S. 109). Robert Schumann hatte vorausschauend schon 1848 in einem Brief an Robert Reinick bekundet, seine eigenen Lieder wünschte er »ohne Pfeffer und Zutat ä la Liszt« arrangiert (GS 2, S. 419). Liszt hat sich daran gehalten, wenngleich er Schumanns Wunsch nicht kennen konnte. Der Brief wurde erst 1885 publiziert. Inzwischen hatte sich seine Kompositionsart entschieden verändert. Seine Versionen sowohl von Clara als auch von Robert Schumanns Liedern sind dem poetischen Stil der Vorlagen angepasst. Liszt integrierte die Singstimme in den Klaviersatz, um die Lieder spielbar zu machen. Das gleiche Verfahren wählte auch die Schumann (Bromen 1997, S. 189ff). Ihre Liedtranskriptionen ähneln sich daher. Obwohl Clara Schumann wusste, was sie der Großzügigkeit Liszts verdankte, blieb sie doch in ihrer Unbeweglichkeit befangen. Uber seinen Tod im Juli 1886 notierte sie sich, »wie ist es Einem leid, daß man Diesen nicht mit vollem Herzen betrauern kann. Der viele Flitter um ihn herum verdunkelt Einem das Bild des Künstlers und Menschen« (in: Litzmann 3, S. 479). Nur die Hochachtung vor seiner technischen Bravour behielt Clara Schumann trotz der glühenden Verachtung für Liszt bei. »Denke Dir, auf der Rückreise hörte ich nach vielen Jahren 'mal wieder Liszt«, schrieb sie Brahms 1876. Sie schmolz, wenn auch nicht durch »seine Sachen«. Er spielte »wunderbar schön«. Es sei doch »immer eine dämonische Gewalt, die einen mit fortreißt«, so ihr Fazit über den Fünfundsechzigjährigen. »Ich habe ihn viel beobachtet, seine feine Koketterie, seine vornehme Liebenswürdigkeit etc. Die Damen waren natürlich wie verrückt nach ihm - das war widerwärtig« (Schumann-Brahms 2, S. 68). Die Tür schlug wieder zu. 378
Handlungsreisende
KAISERREICH U N D KANON
Patriotisch und heilig
Kunst und deutsche Politik »Capitulation von Paris! Wären wir nur heute in Deutschland gewesen. Denn hier haben wir keine Sympathien«. Clara Schumann befand sich bereits auf ihrer Frühjahrstournee in London, als Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen wurde. Die Gründung des Deutschen Reichs stimmte auch sie patriotisch. »Meinen vertrautesten Freunden darf ich es wohl sagen«, gestand sie Brahms, es »vergeht keine Stunde fast, wo ich nicht einige verstohlene Seufzer nach Deutschland sende, die ich kaum mir selbst eingestehen mag, weil es mir so undankbar vorkömmt«. Von ihren Londoner Freunden und Fans war sie nämlich trotz der englischen »Sympathien dem schwachen Theile, also den Franzosen« gegenüber, mit gewohnter Herzlichkeit aufgenommen worden. Diese Fairness rechnete sie ihnen hoch an. Sie selbst reagierte in der Öffentlichkeit ausgesprochen diplomatisch und spielte in jenem Frühjahr bei ihren Londoner Konzerten abwechselnd auf einem französischen Flügel von der Firma Erard, die mitsamt einiger deutscher wie französischer Arbeiter ihren Vertrieb im Londoner Exil fortsetzte, und auf einem englischen Broadwood (in: Litzmann 3, S. 253). Clara Schumann hatte bei aller Emphase für die deutschen Interessen während des Krieges die Opfer auf beiden Seiten nicht aus den Augen verloren. »Das große furchtbare Leid, das über ganz Deutschland und Frankreich gekommen, nimmt mein ganzes Denken und Fühlen in Beschlag«, schrieb sie am 25. August 1870. Jeder »neue Sieg bringt mir die furchtbarste Traurigkeit, denn welche Opfer kostet es!« Sie fand es selber zwar »weiblich schwach, wenn man sich in solch'ner Zeit an das Einzelne hängt, aber ich kann nicht anders, wünschte, hätte solch eine Metzelei nie erleben müssen. Wir werden große schöne Folgen sehen, und das ist gewiß erhebend, doch der Moment des Grausens verlangt sein Recht.« So bedauerte sie »das arme Frankreich, man muß doch auch Mitleid haben mit den armen Soldaten, die kaum nothdürftig gesättigt in den Krieg ziehen, und wie die Löwen kämpfen.« Das »arme Volk von Paris« wähnte sie von den politischen Führern »immerfort belogen und betrogen«. »Ich bin gewiß eine gute Deutsche«, schrieb sie ihrer Mutter, »aber jubeln kann ich über so schwer erkaufte Siege nicht. Unsere Kunst und deutsche Politik
379
schönsten frischesten Kräffte werden geopfert, eine wahre Metzelei ist es auf beiden Seiten!« {Litzmann 3, S. 244fF.; Wendler, S. 281; an M. Bargiel, 26. August 1870). Da verwunderte sie, dass der Sänger Julius Stockhausen ihr ein »deutschpatriotisches Lied« schickte, dessen einschlägiger Text sie abstieß. Als Elsässer werde er doch auch Sympathien für Frankreich haben, mutmaßte sie. »Daß ich in Paris geboren, im Elsaß groß geworden bin, das ist nicht meine Schuld«, antwortete Stockhausen jedoch. »Keiner meiner Brüder ist französisch gestimmt.« Im Elsaß habe er nichts von der deutschen Kultur erfahren, Goethe und Schiller erst im Studium in Paris lesen dürfen, von Bach »keine Note zu Gesicht bekommen«. In Paris, bei Garcia, hätte er nichts gelernt, behauptete er. Und erst »1852 lernte ich durch die unvergleichliche Schröder-Devrient die ersten Schumannschen Lieder kennen.« Es wäre ihm ein peinliches Gefühl, zu Hause zu sitzen, während seine Brüder in die Schlacht zögen (in: Litzmann 3, S. 243f). Clara Schumanns Antwort darauf ist nicht bekannt. Ihre abwägende Position kam fast schon der sozialdemokratischen gleich. Die stimmten im Herbst 1870 gegen eine Annexion Elsaß Lothringens und wurden deswegen als »vaterlandslose Gesellen« diffamiert (Ullrich 2007, S. 64). Doch beflaggten auch die Schumanns patriotisch ihr BadenBadener Haus, als die ersten Siegesmeldungen kamen. Vom Kampf um Elsaß Lothringen bekam man in Baden-Baden hautnahe Eindrücke. »Gestern Abend begann die Beschießung Straßburgs«, berichtete sie Emilie List, »es dauerte die ganze Nacht, wir hörten es; und da mußte man zu Bette gehen, während ein neues Blutbad begann!« (in: Wendler, S. 281f). Tagsüber kletterte man auf die Yburg,um die Rauchwolken über Straßburg zu beobachten. In der internationalen Baden-Badener Sommerfrische nähten nicht bloß die Schumann-Töchter für die Soldaten, sondern auch Pauline Viardot-Garcia und ihre Mädchen. Ihr Mann war mit Ausbruch des Krieges sofort nach Frankreich zurückgereist. Beide Mütter berieten sich. »Pauline, was machen wir, wenn die Franzosen kommen?« »Da bringen wir vor allem unsere Töchter in Sicherheit« (in: E. Schumann, S. 152). Erst nach der Einnahme von Sedan und der Niederlage von Napoleon III. am 1. und 2. September 1870, flüchtete Viardot-Garcia nach London und kehrte von dort aus später nach Paris zurück. Nur in dieser Phase interessierte sich Clara Schumann tatsächlich für Frauenvereine, und zwar für deren Logistik bei der Verteilung von Spenden und dem Versand von Kleidung und Verbandszeug an die Heereslager. Ende August wurde auch Ferdinand Schumann eingezogen. »Wir vermuthen ihn in Metz.« Wenig später erhielten sie die Nachricht, er stehe »vor 380
Kaiserreich und Kanon
den Thoren v. Paris«. Nach dem Fall von Straßburg hatten die Schumanns und Hermann Levi die ramponierte Stadt besichtigt (E. Schumann, S. 207). Aber »an dem Heldenmuthe der Deutschen wird man sich doch erst wirklich erfreuen und erheben können, wenn die Erinnerung an die Gräuel etwas mehr in den Hintergrund tritt.« Und vor allem: wenn die Söhne wieder zurückkehrten. Diese Sorge ließ sie nicht los. Kaum waren die Kampfhandlungen beendet, so schockierte der Aufstand der Pariser Commune und seine Niederschlagung, die 30.000 Tote kostete, Clara Schumann. Die Brutalität auf beiden Seiten empörte sie. »Ich bin außer mir über Paris! solchen Vandalismus in unserem Jahrhundert haben wir doch nie geahndet«, schrieb sie, als Details der Straßenkämpfe in den Zeitungen publik wurden. W i e »dauern Einem die vielen Unschuldigen und vortrefflichen Menschen, deren es in Frankreich doch auch so gut wie anderswo giebt«. Aufgeregt tauschte sie in diesen Jahren mit ihrer politisch wachen, stets gut informierten Freundin Emilie List Meinungen aus. Ferdinand Schumann war glücklicherweise nicht im Gefecht, sondern hinter den Linien eingesetzt worden. Nach dem Friedensschluss in Frankfurt am Main, am 10. Mai 1871, begann auch für ihn der Rückzug. Er befand sich unter den Truppen, die am 16. Juni 1871 in Berlin einzogen. Den Krieg überlebte er. Erst nachträglich zeigten sich dann Spätfolgen seines Einsatzes. »Was wird uns das nächste [Jahr] bringen?«, hatte sich Clara Schumann Silvester 1870 gefragt. »Ein einiges Deutschland? Man hofft es, - Viele wohl, deren Söhne gefallen, suchen in dieser Hoffnung Trost!« Die bürgerliche Vision eines deutschen Nationalstaats, die die allgemeine Kampfbegeisterung im deutsch-französischen Krieg 1870/71 ideologisch motivierte, hatte seit Anfang des 19. Jahrhunderts auf der Vorstellung von Freiheit, Einigkeit und Gleichheit aller, die durch gemeinsame Sprache und Herkunft zusammengeschlossen waren, aufgebaut (Wehler 2001, S. 12ff. und 63ff). Sowohl die Orientierungslosigkeit der politisch ohnmächtigen bildungsbürgerlichen Schicht als auch die durch die französische Besatzung gemachten Erfahrungen prägten die Situation. Dabei war die ursprüngliche Idee eines von der Volkssouveränität ausgehenden deutschen Nationalstaats darin fortschrittlich, dass man den Freiheitsgedanken und das Ideal von brüderlicher Solidarität aus den allgemeinen Menschenrechtsdeklarationen des 18. Jahrhunderts übernahm. Gleichzeitig enthielt der Nationalismus mit der Selbstverheißung deutscher Überlegenheit eine chauvinistische Komponente. In pathetisch aufgeladenen aus der Theologie auf den Nationalismus übertragenen Denkfiguren und Metaphern multiplizierten Dichter die Uto-
Kunst und deutsche Politik
381
pie von einer »vollendeten Nation« als einem säkularen Paradies, in dem die Deutschen gleich einem auserwählten »Urbild der Menschlichkeit« (Kleist) und »Griechen der Neuzeit« (Schlegel, beide in: Wehler 2001, S. 65f.) in brüderlicher Gemeinschaft lebten und durch die Künste zur Humanität veredelt würden - ein Programm, das sich noch in Karl Friedrich Schinkels neoklassizistischen Bauten spiegelte. Die Ausdrucksweise entsprach einer »Ubersetzung der religiösen Formen« ins Ideelle, um einen wahren Glauben an das Nationale einzuleiten, und sie funktionierte als »Isomorphismus der Gefiihlsprozesse«, wie der Philosoph Friedrich Albert Lange 1866 kritisch analysierte (in: Hamann/Hermand 1965, S. 58f). Das Besondere der Nation sollte sich in spezifisch deutschen Eigenschaften zeigen. Was genau darunter fiel, variierte indessen ein Stück weit und musste im Einzelnen ausgehandelt werden, denn »die Nation« war »ein vom Nationalismus entworfenes flexibles Produkt der modernen Geschichte« (Wehler 2001, S. 37). Gemeinsamkeiten, wie die nach damaliger Auffassung von Luther geschaffene deutsche Hochsprache oder Errungenschaften deutscher Wissenschaft und Kunst wurden mit Inbrunst als unvergängliche heroische Leistungen großer deutscher Geister der Vergangenheit gefeiert. Sie setzten in der Philologie eine national orientierte Forschung in Gang, die Germanistik, sowie diverse literarische mehr oder weniger fantasierte und idealisierte Geschichtsdarstellungen, aber auch die von 1835 bis 1842 verfasste wirkungsmächtige fünfbändige Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen von Georg Gottfried Gervinus (Weimar 2003, S. 312ff). Veranstaltungen wie die Dürer-, Gutenberg-, Goethe-, Schiller- oder LutherFeste in verschiedenen deutschen Städten schärften das Bewusstsein für nationale Geschichte. Die Verleger- und Buchhandelsstadt Leipzig hatte bereits 1840 der 400 Jahre alten Buchdruckkunst gedacht und vor allem sich selbst in einem mehrtägigen Bürgerfest gefeiert. Albert Lortzing steuerte die Oper Hans Sachs bei. Man enthüllte ein Gutenberg-Denkmal, während die »Buchdrucker mitten auf dem Markt ein Lied druckten, das, nachdem Raimund Haertel eine Rede gehalten, vertheilt und gesungen wurde«, nämlich zu der Melodie des Lutherchorals Ein feste Burg, liest man in Clara Wiecks Tagebuch. Sie genoss das damalige Ereignis samt Festumzug und »Illumination«, doch fand sie »das Volk in seinem Deutschthum unausstehlich« (Jb, 24. Juni 1840). Am nächsten Tag gab man ein Festkonzert mit Carl Maria von Webers JubelOuvertüre von 1819, die die Melodie von Heil Dir im Siegerkranz enthielt, und als Höhepunkt führte Mendelssohn Bartholdy in der Thomaskirche seinen Lobgesang op. 52 auf, »eine Symphonie für Chor und Orchester«, mit 382
Kaiserreich und Kanon
Texten aus der Lutherbibel. Die Komposition war für diesen Anlass vom Rat der Stadt in Auftrag gegeben worden (Reiser, S. 49ff). Eine universale Kunst konnte man so gut mit der Idee des Nationalen verbinden, weil sie wie die Religion ein übergeordnetes sinnstiftendes »kulturelles Deutungssystem« (Wehler 2001, S. 32) zur Orientierung bot. Charakteristisch für die Vermengung war die Rolle Luthers im 19. Jahrhundert. Er wurde nicht nur als religiöser, sondern auch als politischer, die Deutschen kulturell einender Reformator und durch diese Tat sogar als Vorläufer des Reichsgründers Bismarck gefeiert (W. Hofmann 1983, S. 46fF.; Parr 1992, S. 82). Mit Luther, Hölderlin, Schiller und Goethe wählte auch Brahms in seinen großen Chor- und Orchesterwerken repräsentative »Geistesgrößen« deutscher Kunst und Kultur, denen im Zuge einer allgemeinen »Humanitätsreligion« eine identitätsstiftende Funktion im Kaiserreich zugewiesen wurde. »Ihr Beruf war es«, so der Theologe David Friedrich Strauß 1872, »eine feste Burg des Geistes zu bauen, worin die Deutschen, indem sie sich als Menschen ausbildeten, zugleich als Nation fühlen lernten«. Die Bedeutung beruhte vor allem auf den Leistungen für die deutsche Sprache, da die Sprache ein zentraler Aspekt der Nationalbildung war. »Ohne Luther und Goethe wären wir nicht, was wir sind«, bestätigte auch der Historiker und Germanist Hermann Grimm (in: Klassen 2001, S. 334; Hamann/Hermand 1965, S. 55). Inwieweit Kunst- oder Nationalismusglaube wirklich die Religion ersetzten, sei dahin gestellt. Indessen existierte die Idee einer universalen Kunst von zeitunabhängiger Geltung bloß als Behauptung. Weder in der Musik, noch in der Literatur, der Baukunst oder der Malerei herrschten einheitliche Tendenzen. Im Gegenteil. Die unterschiedlichen »Schulen« und ihre Anhänger befehdeten sich heftig. Ohnehin trug zunächst nur eine kleine intellektuelle Schicht den Nationalismus weiter. In ihrem Umfeld entwickelte man »unter Rückgriff auf vermeintliche Traditionen [ . . . ] eine programmatische Vision«, so Wehler (Wehler 2001, S. 42), die dann in allen Bevölkerungsschichten weite Kreise zog. Als Multiplikatoren wirkten neben der Publizistik auch die vielen, ursprünglich nicht miteinander zusammenhängenden Vereine, Gesellschaften und Festivals. Künstler und Wissenschaftler stellten nationale Traditionen her, erfanden die Geschichte dazu und machten die Kunst zu einem nicht mehr weg zu denkenden, zentralen Faktor in der bürgerlichem Gesellschaft. Mit der Reichsgründung erfüllte sich zwar die von bürgerlichen Intellektuellen als utopischer Fluchtpunkt verfolgte Idee eines geeinten Deutschlands, doch mit wesentlichen Verschiebungen. Anstelle einer Volkssouveränität, die auf den Säulen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beruhte,
Kunst und deutsche Politik
383
war durch den »Reichsgründer« Bismarck eine föderale »Fürstenherrschaft« unter einem »Reichsmonarch[en]« sozusagen von oben entstanden (Wehler 2001, S. 77). Dafür wurde Bismarck als Held verehrt. Die Verfassung spiegelte einen Kompromiss zwischen Monarchie, Nationalstaat und der Einigung föderaler Bundesstaaten sowie mit dem Dreiklassenwahlrecht die Interessen von Aristokratie und Besitzbürgertum wider. »Es gibt keinen Nationalgeist im politischen Sinne des Wortes«, so der liberale Reichstagsabgeordnete von Rochau (in: Wehler 2001, S. 75). Man musste eine allgemeine Akzeptanz des neuen Reiches zwischen Ostpreußen, Niederbayern und Südbaden erst schaffen (Nipperdey 1998,2, S. 84ff). Die Gesellschaft des Kaiserreichs profitierte von den einigenden, gesamtkulturellen Errungenschaften. Sie vereinfachten das Alltags- und Erwerbsleben, wie etwa die Angleichung der Rechtsordnungen und die jetzt eingeleitete Formulierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). In Leipzig wurde ein Reichsgericht installiert. Das neue Handelsrecht unterstützte die Wirtschaft. Dort zählten die Vereinheitlichung der Währung und die Gründung der Reichsbank mit Filialen in allen Ländern zu wichtigen Neuerungen. Eine Reichsgewerbeordnung und die Einfuhrung einheitlicher Maße und Gewichte erleichterten Produktion und Handel. Im deutschen Reich galt einheitlich die mitteleuropäische, anstelle der Länderzeit als Richtwert, was die Koordinierung der Fahrpläne erheblich erleichterte. Hinzu kam eine allgemeine Verwaltungsreform. Mit der Umwandlung der Straßburger in eine Reichsuniversität wurde im nun zum deutschen Reich gehörenden Elsaß Lothringen ein markantes nationales Zeichen gesetzt. Wilhelm Scherer gründete ein Germanistisches Institut und der Mittelalterforscher Gustav Jacobsthal las dort seit 1872 Musikgeschichte. Die Künstler überboten sich freiwillig in bekenntnishaften patriotischen Gesten. Brahms reagierte in Wien aus freien Stücken mit der Komposition seines Triumphlieds für Bariton-Solo, achtstimmigen Chor und Orchester op. 55 auf die Reichsgründung. Schon im Oktober 1870 hatte er mit dem Entwurf begonnen. Dazu kompilierte er für die drei Sätze biblische Texte aus dem 19. Kapitel der Offenbarung, die sich ohne weiteres auf den neuen deutschen Kaiser applizieren ließen. Seine Vermischung von Gotteslob und Kaiserverherrlichung wurde vom zeitgenössischen Publikum auf den aktuellen Anlass bezogen und offenbar begeistert angenommen (Horstmann 1986, S. 199fF). Erst in der weiteren Rezeption des Stücks löste sie Zweifel aus. Von den ursprünglich vorgesehenen Untertiteln, »Auf den Sieg der deutschen Waffen« beziehungsweise »Bismarck-Hymne«, riet ihm sein Verleger Simrock erfolgreich ab. Stattdessen erschien das Triumphlied 1872 mit dem 384
Kaiserreich und Kanon
Zusatz »Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser Wilhelm I. ehrfurchtsvoll zugeeignet«. Das Titelblatt der Erstausgabe zierten Reichsadler, Kaiserkrone, Palmzweige und Standarten (Brahms-Institut, Lübeck). Was immer er sich davon erhofft haben mochte, die anerkennende Medaille, die der Kaiser als Dank schickte, war es sicher nicht. Wien schien diesmal der falsche Ort für das patriotische Bekenntnis des Exilanten Brahms zu sein, der gern nach Deutschland zurückgekommen wäre. Noch 1876 bewarb er sich vergebens in Düsseldorf um eine Leitungsposition. In Berlin führte Julius Stockhausen das Triumphlied 1874 mit dem Sternschen Gesangsverein auf. Der erste Satz war schon im Karfreitagskonzert 1871 im Bremer Dom zu hören gewesen, kombiniert mit einer Aufführung des Deutschen Requiem op. 45 zum Gedächtnis der Kriegstoten. Hermann Levi leitete dann die Uraufführung des ganzen Werks in Karlsruhe. Es sei »wohl das Tiefste und Großartigste, was in dem Genre der Kirchenmusik seit Bach geschaffen«, lobte Clara Schumann überschwänglich. »Das Werk machte trotz der mangelnden Kraft durch Massen eine tief ergreifende Wirkung auf Musiker und Musikkenner. - Das Publicum hatte mindestens Respect«. Theodor Billroth schickte zur Erinnerung an das Ereignis einen »silbernen Becher« mit der Gravur: »Dem Meister deutscher Tonkunst Johannes Brahms zur Erinnerung an den 5. Juni 1872.« (in: Litzmann 3, S. 275f). Brahms zielte auf eine repräsentative Wirkung und richtete seine Komposition dementsprechend aus. Kretzschmar fand in seiner Kritik ähnlich wie Clara Schumann, dass so ein Werk einen riesigen Aufführungsapparat brauche, um zu wirken, mit »14 Trompeten« und »sechsfachen Pauken« sowie 4.000 Sängern, wie bei den Londoner Händel-Aufführungen »im Krystallpalast«, so Kretzschmar (in: Horstmann 1986, S. 200). Dass Brahms sich bei den Vorstudien an Händel orientiert hatte, wollte man vor allem im ersten Satz, dem »Hallelujah! Heil und Preis«, heraushören und wertete das Stück als zeitgenössische Version von Händeis Dettinger Tedeum. Wagner spottete über die »Halleluja-Perrücke Händeis«, die Brahms sich übergestülpt habe (Wagner o.J., 10, S. 148). In dieser besonderen politischen Situation stach Brahms Wagner tatsächlich aus. Wagner hatte den Segen des Kaisers abgewartet und erhielt auf sein Angebot, eine Feiermusik für das siegreiche Heer und zum Gedenken der Toten zu schreiben, eine Absage. Seinen Kaisermarsch, in den er das luthersche Glaubenskampflied Ein feste Burg einmontiert hatte, führte er im Mai 1871 dem Herrscherpaar privat vor, ohne dass sich daraus weitere Konsequenzen ergaben (Gregor-Dellin 1980, S. 640ff). Auch musikalisch kamen Brahms' Kompositionen dieser Zeit Liszts und Wagners Musik-SprachKunst und deutsche Politik
385
Konzept als Synthese aus hoher Theaterkunst und Weiterentwicklung des von Beethoven erreichten musikalischen Standards durchaus nahe. M i t den Stücken Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester op. 45, der Rhapsodie für Alt-Solo, Männerchor und Orchester op. 53 auf einen Text aus Goethes Harzreise im Winter, dem Schicksalslied op. 54 auf einen Text aus Hölderlins Hyperion und dem Triumphlied op. 55 hatte Brahms innerhalb von vier Jahren fünf große Werke in der Öffentlichkeit platziert, die allesamt über die reine Instrumentalmusik hinaus gingen und den Nerv der Zeit trafen. Sowohl die deutschen Texte, als auch deren Inhalte ließen sich konkret auf die aktuelle Situation beziehen und reflektierten die kollektive, zwischen allgemeinem Siegesjubel und persönlicher Betroffenheit angesiedelte Stimmung. Als Bibelwort und Dichtung behielten sie dennoch ihren eigenen über den spezifischen Anlass hinausgehenden Wert. Diese Serie von Werken besiegelten Brahms' endgültigen »Durchbruch« als Komponist. Wagner war dagegen wie viele Kunstschaffende vom deutschen Reich ernüchtert. Drei Wochen vor der Uraufführung von Brahms' Triumphlied, nämlich am 22. Mai 1872, fand in Bayreuth die Grundsteinlegung zum Bau des Festspielhauses statt. Wagners Hoffnungen, dort das deutsche Nationaltheater des Reichs mit dem Segen Bismarcks installieren zu können, schwanden. Nur sein Hauptsponsor, der bayerische König Ludwig II., schickte ein Glückwunsch-Telegramm. Es wurde eingekapselt und in die Fundamente versenkt (C.Wagner 1976,1, S. 520ff). Die Finanzierung blieb heikel. Patronatsscheine konnten erworben werden. Und schon bei den ersten Bayreuther Festspielen 1876 verkaufte man Andenkenkitsch wie Nibelungenmützen und Wagner-Krawatten (Gregor-Dellin 1980, S. 718). Ansonsten trugen nach wie vor spendable Gönnerinnen und Gönner aus der Aristokratie und immer öfter auch die seit Dezember 1871 entstehenden Richard WagnerVereine zur Unterstützung bei. Der bayerische König konnte das von Wagner erhoffte Versprechen, ihm eine üppige Apanage auszusetzen, damit er so frei schaffen könne wie der vom Mäzen Carl Fiedler in München ausgehaltene »Malerfürst« Hans von Marées (Hamann/Hermand 1965, S. 52), nicht erfüllen. Vielmehr revoltierte der Landtag bereits gegen Wagners Einfluss auf Ludwig II. Wenn Wagner sich an die politische Führung des Reichs wandte, so in der Hoffnung, dass der Staat ihn durch die Finanzierung seines Ä/rag-Projekts in Bayreuth entlasten werde. Abgesehen von einem gewissen Anteil an Größenwahn, basierte Wagners Gesuch auf der Überzeugung, dass seine Aktivitäten eben nicht rein privat, sondern von öffentlichem Interesse seien. Der Grund dafür 386
Kaiserreich und Kanon
lag in der Funktion, die die Kunst und die sie verbreitenden bürgerlichen Intellektuellen im Zuge der Nationalstaatbildung einnahmen. Bayreuth sollte eine Art Hybridform aus antiker, öffentlicher Tragödie und deutscher Weimarer Klassik repräsentieren, schwebte Wagner vor. In seiner Schrift Deutsche Kunst und deutsche Politik, die er Bismarck zukommen lassen wollte, plädierte er 1867 für (s)ein neues Theater, das alle Künste vereinen sollte. Aufgrund »seiner ungemein populären Wirksamkeit« werde es »auch auf die Sitten seinen unwiderstehlichen Einfluß« ausüben, behauptete Wagner in freier Anknüpfung an Piaton, und könnte so auch die »öffentliche Moralität« stärken (Wagner, o.J., 8, S. 69). Daraus leitete er die Bedeutung eines Nationaltheaters für die Politik ab. Wagner erreichte nichts. Den Darlehensantrag für den Bau und Betrieb von Bayreuth sandte der Kaiser postwendend an den Kanzler weiter, der empfahl ihn zur Vorlage an den Reichstag. Wagner zog sein Gesuch daraufhin zurück (Gregor-Dellin 1980, S. 689). Bismarck nutzte die Möglichkeiten einer symbolischen Repräsentation des deutschen Nationalstaates durch die Kunst nicht. Schon die Ausrufung des Kaisers war aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zu den Kriegshandlungen und zur Kapitulation von Paris stark militärisch geprägt (Nipperdey 1998,2, S. 261f.; Hamann/Hermand 1965, S. 218). Selbst auf dem verklärenden Historienbild Die Kaiserproklamation in Versailles Anton von Werners von 1877 blitzten Säbel, Helme und Uniformen, die Zivilpersonen ließ der Maler weg. Wilhelm I. legte keinen gesteigerten Wert auf eine besonders feierliche zivile Ausgestaltung von Staatszeremonien und Staatssymbolen. Der Sedanstag wurde zum Feiertag erklärt, und man beging deutschlandweit den Kaisergeburtstag. Als Flagge figurierte eine synthetische Trikolore aus den preußischen Farben schwarz und weiß, ergänzt durch rot. Das »fantastische« Gold aus den frühen burschenschaftlichen Einheitsbewegungen vermied man damit. Erst 1888 wurden die Nationalfarben schwarz-weiß-rot auch gesetzlich fest geschrieben (Schulze 1999, S. 124). Eine einheitliche Hymne war nicht vorgesehen. In den ehemaligen Rheinbundländern sang man Die Wacht am Rhein, sonst die preußische Hymne Heil Dir im Siegerkranz von 1793, ein neuer Text auf die englische Hymnenmelodie von God save the King. Diese Weise nutzten schon mehrere deutsche Länder, jeweils mit anderem Text, darunter Sachsen, Württemberg, Hessen und Mecklenburg Schwerin. Auch Hoffmann von Fallerslebens Lied der Deutschen auf die Melodie von Haydns Kaiserhymne, heute die bundesdeutsche Nationalhymne, war schon im Umlauf. Der neue Kaiser verbat sich ein Reiterstandbild. Stattdessen errichtete man vor dem Berliner Schloß ein Germania-YiztígsaA (Erz und Stein, S. 31). Anstelle staatlicher Großaufträge an die Künstler blühte die AndenkeninKunst und deutsche Politik
387
dustrie. Lebensgroße, maschinell hergestellte gipserne Büsten vom Kaiser oder Bismarck füllten die in neuem gründerzeitlichen Prunk ausstaffierten bürgerlichen Vestibüle und Salons. Brahms hängte ein Lorbeer geschmücktes Bismarckmedaillon neben die Sixtinische Madonna Raffaels (Brahms-Fantasien 1983, S. 57). Clara Schumann schwärmte wie Brahms für Bismarck und den Kaiser. »Ein Mann von über 70 Jahren zeigt sich wie ein Held - wundervoll, und dabei spricht aus jedem seiner Worte der edle Mensch«, schieb sie begeistert über Wilhelm I. (in: Litzmann 3, S. 245). Kulturpolitik war nicht vorrangig. Das Kaiserreich setzte andere Prioritäten. Schon 1863 hatte der Staatswissenschaftler Adolph Wagner Vorschläge für ein »Gesetz von der wachsenden Ausdehnung der öffentlichen, speziell der Staatstätigkeiten« formuliert. Neben Militär- und Verwaltungsausgaben, Polizei, Justiz-, Finanz- und Verkehrswesen und öffentliche Gesundheitspflege rechnete er darunter Sozial- und Rentenversicherungen, um die Bürger loyal zu stimmen, und besonders den Ausbau von Bildungsmöglichkeiten. Letzteres kam in erster Linie den Schulen, Kunstakademien, Konservatorien und Universitäten zugute. Erst 1871 erreichte die Anzahl der Studierenden wieder den Stand von 1830 und stieg danach kontinuierlich an, besonders in Medizin und Naturwissenschaften, aber auch in den staats- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten (Statistik, S. 191ff). Die Erziehung wurde zur nationalen Aufgabe erklärt, deshalb entzog der Staat den Kirchen die Aufsicht über die Schulen, eine Maßnahme, die den so genannten »Kulturkampf« zwischen Staat und Kirche auslöste. Gleichzeitig benutzte man Schul- und Hochschulabschlüsse verstärkt, um sich als >Gebildete< gegenüber >Ungebildeten< zu profilieren. Schon seit der Jahrhundertmitte stieg das soziale Prestige erworbener Zeugnisse, Diplome und Doktorhüte. Das spiegelten auch die Anreden an die Künstler. Hatte man sie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch mit diversen Orden behängt, so dass Schumann sich öffentlich über den hoch dekorierten »Ritter Kalkbrenner« lustig machte, so nahm man die akademischen Ehrentitel jetzt ernst und sprach ehrfürchtig vom »Dr. Brahms«. Selbst Clara Schumann war respektvoll als »Innigst verehrte Frau Doctorin« dekoriert und in einer Rezension sogar als »Frau Dr. Schumann-Wieck« angesprochen worden (in: Brunner, S. 264; Freischütz, 26. März 1850). Darin mochte durchaus die Anerkennung ihrer musikalischen Autorität und Gelehrsamkeit mitschwingen. Tatsächlich war sie aber Kammervirtuosin, der akademische Ehrentitel der Jenaer Universität hatte Robert Schumann gegolten. Trotz der Aufwertung änderte sich das allgemeine Bildungsniveau allerdings nicht flächendeckend solange
388
Kaiserreich und Kanon
die unteren Schichten weiterhin keinen Zugang zum Gymnasium hatten (Gruhn 2003, S. 134ff). Das jetzt etablierte deutsche Reich bestätigte zwar die föderale Einheit. Gleichzeitig vertiefte sich aber eine innere Aufspaltung der Gesellschaft. Neben Aristokratie und Hochfinanz formierte die Schicht von »Besitzund Bildungsbürgern« einen »großbürgerlichen«, Gewerbetreibende sowie Dienstleistende einen »kleinbürgerlichen« und die Arbeiter gesondert einen »vierten Stand«. Von den bürgerlichen Kräften wurden neue Feindbilder konstruiert, etwa das von der Arbeiterschaft als aggressionsbereiter Masse, die es zu kontrollieren galt. Viele »Bildungsbürger« hatten noch die Gräueltaten der Revolution von 1848/49 in Erinnerung und waren von der Radikalität der Auseinandersetzungen auf allen Seiten erschüttert. So hatte Hanslick in Wien den Lynchmord des »Kriegsministers Latour durch einen wütenden Pöbelhaufen« miterlebt. Er »rannte fast bewußtlos nach Hause [...] und schlug einen Band Goethe auf«, um sich »reinzuwaschen von dem Gesehenen« (Hanslick, Aus meinem Leben, S. 86). Auch Liszts feudaler Förderer Fürst Lichnowski war 1849 gefoltert und ermordet worden. Im deutschen Reich sollten die ärmeren Bevölkerungsteile durch die Bismarckschen Sozialversicherungsgesetze beruhigt und eingebunden werden, damit sie nicht zu den Arbeiterverbänden überliefen. Als das nicht funktionierte, unterdrückte der Staat das kritische Potential durch die 1879 erlassenen Sozialistengesetze (Nipperdey 1998,2, S. 231). Außerdem verschärfte sich der Antisemitismus. Immer massiver wurde die historisch und geisteswissenschaftlich fundierte Behauptung einer Überlegenheit des Deutschen durch fragwürdige naturwissenschaftlich verbrämte biologische und rassistische Theorien ersetzt und radikalisiert (Nipperdey 1998,2, S. 301ff). Welchen zerstörerischen Sprengstoff dieser Rassismus besaß, erfuhr Theodor Billroth drastisch. Nachdem der renommierte Professor sich 1876 öffentlich darüber ausgelassen hatte, dass unter seinen Wiener Medizinstudenten zu viele Juden seien, griffen deutsche Burschenschaftler ihre jüdischen Kommilitonen in den Hörsälen tätlich an. Die Wucht der Gewalt erschreckte Billroth dermaßen, dass er nach nutzlosen Dementis sogar einem »Verein zur Abwehr des Antisemitismus« beitrat (Hamann 1996, S. 472f. und 625). Künstler wie Clara Schumann, Brahms, Wagner oder Joseph Joachim gehörten als Vertreter der deutschen »Hoch«-Kultur eindeutig zu den Gewinnern des wirtschaftlichen »Gründungsbooms« (Nipperdey). Sie genossen bei den neuen großbürgerlichen Eliten des Kaiserreichs enormes Ansehen, weil der Besuch von Oper, Theater und Konzert inzwischen zum bürgerlichen Selbstentwurf zählte. Das Verhältnis von Künstler und Publikum entspreche Kunst und deutsche Politik
389
dem von »Arbeitern zu den Abnehmern, und der Künstler soll nichts geben, was er nicht des Zahlens werth hält. Das Schenken wollen wir Dilettanten überlassen«, impfte Joachim Woldemar Bargiel ein {Joachim 1, S. 421). Hier formulierte er ungeschoren eine profane Variante seiner sonst gepflegten Heiligen- und Verkündigungsrhetorik. Wollte man Clara Schumanns politische Haltung vor dem ParteienSpektrum des gründerzeitlichen Deutschlands der 1860er und frühen 70er Jahre einordnen, so dürfte sie wohl am ehesten der liberalen Fortschrittspartei nahe gestanden haben. Man verfocht die Ziele »von Freiheit und Einheit, vom Verfassungsstaat, Nationalstaat und einer Gesellschaft rechtsgleicher Bürger«, eine »säkulare Modernität«, die sich auf der Rechts-Links-Skala der Parteien in der Mitte ansiedelte (Nipperdey 1998,2, S. 314ff). Die ethische Grundlage war der Glaube an Vernunft und die moralische Eigenverantwortung des Individuums, ohne klerikale Bindung oder obrigkeitsstaatliche Nachhilfe. Ihm galten daher die gesamten Erziehungsanstrengungen. Bürgerliche Ideale wie Leistungs- und Bildungsbereitschaft, Verfassungsrecht und Ordnung, Arbeit und Familie, Humanität und Kultur standen im Mittelpunkt. Jeder sollte die Möglichkeit bekommen, sich durch Ausfaltung seiner Begabungen eine Existenz gründen zu können. Clara Schumanns Äußerungen bestätigen diese Linie, wobei sie hauptsächlich die Menschen gleichen Ranges um sich herum im Auge gehabt haben dürfte. Ihre wirtschaftsliberale Sympathie mochte durch die guten Erfahrungen in England bestärkt worden sein. So zögerte sie immer wieder, Selbständigkeit und »Reisefreiheit« aufzugeben, um eine feste Stellung anzunehmen. Stuttgart, Hannover, Wien, Berlin, Dresden, alle geplanten oder möglichen Hochschulengagements ließ sie ungenutzt verstreichen, oder sie verhandelte so lange, bis nur noch eine Absage möglich war, wie in Berlin. Die spätere nationalkonservative Wende der Liberalen im Kaiserreich dürfte ihrem angelsächsisch ausgerichteten Horizont allerdings wenig entsprochen haben. Die Veranstaltung und Förderung der schönen Künste blieb weitgehend Privatinitiative. Der Kaiser besuchte die Eröffnung der Bayreuther Festspiele 1876 in betont privater Pose, nämlich bürgerlich gekleidet, und wurde daher im ersten Augenblick nicht einmal erkannt, obwohl der Sonderzug, mit dem er tags zuvor angereist war, am Bahnhof mit Hoch- und Jubelrufen begrüßt worden war (Gregor-Dellin 1980, S. 716ff). Bunte »Liebig«-Sammelbildchen, ein Werbeartikel für den gleichnamigen Fleischextrakt, bildeten den Empfang durch Wagner, dessen Tochter Eva und Isolde, Liszt und von Bülow ab (in: Hamann 2005, S. 60). Theater- und Konzertveranstaltungen waren weiterhin Unternehmungen auf eigenes Risiko, finanziert durch 390
Kaiserreich und Kanon
Mäzene, Sponsoren oder Vereine. Eintrittsgelder machten von Beginn der bürgerlichen Konzertkultur an Musik zwar einerseits zur Ware, sie trugen andererseits aber gerade dadurch zur Möglichkeit bei, dass sich überhaupt eine »zweckfreie«, das heißt ohne einen besonderen politisch repräsentativen oder kultischen Anlass und unabhängig vom Auftraggeber entworfene Kunst entwickeln konnte (Habermas 1990, S. 101). Anders als in England und auch anders, als Semper in seiner programmatischen Schrift Wissenschaft, Industrie und Kunst 1851 entworfen hatte, fand in Deutschland nur eine sparsame Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kunst statt. Sie florierte vor allem bei der Verbreitung von mehr oder weniger anspruchsvoller Literatur in »Groschenheften« wie den Bändchen des Reclamverlags, der eine preiswerte Taschenbuchausgabe von Goethes Faust herausbrachte und das Stück damit für den Unterrichtskanon tauglich machte, sowie der Reproduktion von Kunstwerken etwa aus der Dresdner Gemäldegalerie. Die Schumanns wie Brahms besaßen derartige Bilder-Mappen. Vergleichbare Einrichtungen wie die Londoner St. James Hall, die durch die Verlagshäuser der Chappells gebaut und unterhalten wurden, waren im deutschen Reich nicht üblich. Nach wie vor übernahmen Vereine und Gesellschaften, oft angefeuert von engagierten Einzelpersonen, die Aufgabe, professionelle Orchester und Spielstätten zu unterhalten. So spielte bei der Etablierung von Musik in der Öffentlichkeit der 1861 ins Leben gerufene Allgemeine Deutsche Musikverein und die von ihm kontinuierlich veranstalteten Tonkünstlerfeste eine wichtige Rolle. In Berlin startete 1882 die Philharmonische Gesellschaft eine eigene Reihe »Philharmonischer Konzerte«. Sie galten als öffentliche Veranstaltungen, da sie für jeden, der das Eintrittsgeld zahlte, zugänglich waren. Trotzdem hatte sich das Spektrum von dem, was »öffentlich« bedeutete, im Laufe des 19. Jahrhunderts grundlegend verschoben. Legt man die von Jürgen Habermas umrissene Definition von Öffentlichkeit als einer zwischen Gesellschaft und Staat vermittelnde Sphäre zugrunde, in der das Publikum als Träger der öffentlichen Meinung fungierte, so zeigt sich der Wandel besonders in der Trennung von politischer und kultureller Öffentlichkeit. Ihr mediales Forum war die Presse. Sie verbreitete die öffentliche Meinung. Diese öffentliche Meinung hatte im Zuge der Spätaufklärung als kollektive Stimme und daher als vernünftig gegolten. Deswegen konnte sie eine allgemeine Orientierung geben (Habermas 1990, S. 121; Öffentlichkeit, S. 46). Im Laufe des 19. Jahrhunderts schmolz die positive Bewertung der weitgehend mit der Öffentlichkeit übereinstimmenden öffentlichen Meinung in dem Maße zusammen, wie das Vertrauen in die allgemeine Ur-
Kunst und deutsche Politik
391
teilsfähigkeit des Volkes beziehungsweise der anonymen Masse, wie es später bezeichnenderweise hieß, sank. Kollektive Äußerungen hielt man am Ende des Jahrhunderts nur mehr für emotional, kopflos, hysterisch und manipulierbar. Vor diesem Hintergrund entstand Nietzsches finstere Kulturkritik (iÖffentlichkeit, S. 62ff). In den bildungsbürgerlichen Selbstkonzepten des frühen 19. Jahrhunderts waren alle Schichten stillschweigend inbegriffen, da man sich einheitlich als »Volk« in Abgrenzung vom Adel sah. Für viele Bürger rückte die neue Schicht der Proletarier erst während der revolutionären Erhebungen zwischen 1830 und 1848 ins Bewusstsein, über die die internationale Presse ausfuhrlich berichtete. Aber auch Bücher wie Bettina von Arnims 1843 publizierte Schrift Dies Buch gehört dem König, in dem sie auf soziale Missstände in Preußen aufmerksam machte, verfehlten ihre Wirkung nicht. Deswegen bespitzelte sogar die Metternichsche Polizei die prominente Schriftstellerin (Drewitz 1969, S. 200). Erst nach den verlorenen demokratischen Träumen 1849 reflektierte man unter Intellektuellen genauer die kaum zu vereinbarenden Divergenzen innerhalb der unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung. In der Gründerzeit wurde dem Kollektiv kein brauchbares Urteil im ästhetischen Diskurs mehr zugetraut. Trotzdem geisterte weiterhin eine ideologisch verklärte Vorstellung vom »Volk« als eine durch Abstammung und Sprache verbundene, ursprüngliche oder natürliche Kulturgemeinschaft durch Kunst und Literatur. Die Abwertung der unteren Schicht basierte auf zwei Erfahrungen, nämlich einmal der Langsamkeit, mit der die Bildung des Publikums voranschritt - viele Künstler hielten dessen ästhetische Erziehung inzwischen für aussichtslos und stuften das allgemeine Publikum als bildungsresistent ein — und zum anderen der nach wie vor großen Gewaltbereitschaft, die das Bürgertum zutiefst erschreckte und verunsicherte. Der Aufstand der Pariser Commune 1871 sei nur ein »kleines Vorpostengefecht« gewesen, drohte August Bebel im Reichstag (Ullrich 2007, S. 64). Die in der Presse publizierte »öffentliche Meinung« galt längst nicht mehr als Stimme des »Volks«. Auch die Presseorgane selber verloren an Ansehen. Zum Prestigeabfall der Presse trug die für alle spürbare Verschärfung politischer Restriktionen in der zweiten Jahrhunderthälfte bei, darunter eine durchgreifende staatliche Zensur sowie politische Manipulationen, die de facto eine Beschränkung der öffentlichen Meinungsäußerung bedeuteten. Darüber hinaus waren Zeitungen und Zeitschriften korrumpierbar, weil sie sich vermehrt durch Anzeigen finanzierten und nicht mehr überwiegend durch Abonnenten, was im »Gründerboom« zu einer Abhängigkeit von der Industrie führte. Inzwischen gehörten die Nachrichten selbst zur Handels392
Kaiserreich und Kanon
wäre und wurden von Agenturen wie Reuters in London oder Mosse in Berlin verkauft. Massive staatliche Eingriffe in die Kunst wie die 1857 in ganz Europa verfolgten Prozesse gegen Gustave Flauberts Roman Madame Bovery und Charles Baudelaires Gedichtzyklus Les fleurs du mal durch die Staatsorgane von Napoleon III. oder die Verbannung Victor Hugos aus Frankreich trugen zur Einschüchterung bei und verstärkten die Tendenzen, Kunst und Politik künftig sorgfältig voneinander zu trennen. Der preußische König hatte auf die Revolutionen der Jahrhundertmitte mit einer rigiden Schulpolitik reagiert und erteilte 1854 neue Richtlinien für Lehrerseminare: »Es ist die unbestrittene Aufgabe der Schule« in den Schülern »die Gesinnung der Anhänglichkeit, der Treue und des Gehorsams gegen den Landesherrn und gegen den Staat zu erwecken«. Wenn aber »politische Lieder« gesungen würden, «so werden wir solchen strafbaren Ausschreitungen mit der größten Strenge begegnen« (in: Gruhn 2003, S. 114f). Statt kritisch-analytischem Denken sollte erhebende Geschichte anschaulich gelehrt und die Beschäftigung damit gefördert werden. Hatte der Autor und Literaturwissenschaftler Robert Prutz im Vormärz wie Semper gefordert, anstelle einer »idealen« Öffentlichkeit von verständigen Lesern, die den Kunstschaffenden bei der Produktion offenbar vorschwebte, die »empirische« Öffentlichkeit mit ihren realen Bedürfnissen nach Bildung und Unterhaltung zu setzen, so wechselte er im Nachmärz angesichts der politischen Entwicklung die Seite und plädierte für den Eigenwert von Kunst. Der »Dramatiker soll nicht mehr sein ästhetisches Gewissen mit politischen Gründen beruhigen«, so Prutz. Vielmehr ginge es um die »Objectivität« der Kunst (in: Öffentlichkeit, S. 66). Auf dieser Linie lag Hanslicks Schrift Vom Musikalisch-Schönen mit dem kompromisslosen Plädoyer für eine Autonomie der Musik. Dabei galten zwei Bereiche von Autonomie, nämlich ein ästhetischer und ein sozialökonomischer. Der erste fokussierte sich auf das selbstreferentielle Kunstwerk, das nur immanenten Regeln folgen sollte. Der zweite, weiter gefasste, zielte auf die Anerkennung von Kunst als eigenständiger Sparte neben der Wissenschaft und Politik sowie auf die Freiheit der Kunstschaffenden, denen es möglich sein sollte, ihr Leben ausschließlich der Kunst zu widmen. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreicht. Strittig blieb dagegen die Frage, auf welche Weise die Unabhängigkeit der Künstler gewährleistet werden sollte. Brendel hatte schon 1852 beklagt, dass Musik »selten oder nie [...] als Kunst um ihrer selbst willen eine besondere Pflege und Obhut von Seiten des Staates« erfahren habe, und genau dies eingefordert (Brendel 1852, S. 537). Dahinter stand die Hoffnung, Kunst als nationale Aufgabe in die VerantworKunst und deutsche Politik
393
tung des Staates zu legen, um vom Publikumsgeschmack unabhängig zu sein. Demgegenüber plädierte Liszt bei den Versammlungen des Allgemeinen deutschen Musikvereins für den Erhalt künstlerischer Souveränität durch die Eigenfinanzierung in beitragspflichtigen Korporationen (Lucke-Kaminiarz 2006, S. 222). Künstler wie Clara Schumann oder Joachim gingen einen dritten Weg und setzten auf ihr persönliches Uberzeugungsvermögen im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf. Wie Clara Schumann so handelte auch Brahms im Sinne eines wirtschaftlichen Liberalismus, wenn er die durch seine Kompositionen und Auffuhrungen erzielten Gewinne nutzte, um möglichst selbständig und unabhängig arbeiten zu können. Solange ihm das nicht gelang, nahm er Posten als Chorleiter an, konzertierte und unterrichtete. Später, als er allein von seinen Kompositionseinnahmen leben konnte, »privatisierte« er. Wenn er jetzt dirigierte, so hauptsächlich Aufführungen eigener Werke. Ob er seine Verpflichtungen einhielt, hing nurmehr von seinen Launen ab. Dagegen konnte Wagner für sein Riesenprojekt Bayreuth mit Dirigaten nicht genug erwirtschaften. Daher musste er sich weiterhin um Mäzene bemühen. Doch beklagte er wie viele vor, mit und nach ihm, dass die Einwerbung von Geldern genau die Zeit koste, die er eigentlich zum Komponieren brauchte. Einig waren sich hingegen die meisten Künstler in ihrem Selbstverständnis, die geistigen Grundlagen des Reichs aufzubauen. Allerdings existierte gar kein einheitlicher Bereich von »Kunst« oder »Kultur«. Vielmehr hatten sich auch hierin die gesellschaftlichen Schichten weiter ausdifferenziert. Während sich die Angestellten, Kaufleute und Dienstleister an den Gepflogenheiten der großbürgerlichen Schicht orientierten, entwickelte der vierte Stand in Deutschland eigene kulturelle Strukturen und Organisationsformen. Nach der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1864 durch Ferdinand Lassalle, dessen Bundeslied Georg Weerth dichtete (Nipperdey 1998,2, S. 276ff".,Maase 1997, S. 41), etablierten sich neue Strukturen. Arbeiterkulturvereine veranstalteten Fortbildungen, Lesungen, Theateraufführungen und Musikabende. Tatsächlich waren die Uberschneidungsbereiche von allgemeinen Freizeitvergnügungen und Kulturangeboten zwischen den Schichten nach wie vor groß. Neben traditionellen kollektiven Festen wie dem Karneval, Jahrmärkten mit ihren Karussells, Schaustellern, Puppenspielern und Bänkelsängern oder Zirkusvorstellungen, trafen sich die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten auch bei Paraden, Militär- und so genannten »Garten«-Konzerten, in Operetten, Tanzveranstaltungen und den neu entstehenden Cabarets. Die gutbürgerliche Schicht behielt indessen im ästhetischen Diskurs die kulturelle Deutungsmacht für sich allein und behauptete, über alle internen 394
Kaiserreich und Kanon
Zwiste zwischen Wagnerianern und Brahminen hinweg die Kunst insgesamt und in ihren Diskursen die kunstöffentliche Meinung zu vertreten. Dabei nutzte sie Kunst wie ein abwehrendes Symbol, um sich gegen die »Realitäten des Staates und des öffentlichen politischen Lebens« abzuschirmen, so Werner Hofmann (W. Hofmann 1983, S. 51). In Phasen, wo das äußere Leben, die Wirtschaft, die Politik und die Bismarcksche »soziale Frage« wechselvoll, unberechenbar oder turbulent abliefen, boten die von der Außenwelt abgeschotteten Darbietungen »höchster« Kunst in den tempelartigen, neoklassizistischen Konzerthäusern und Stadttheatern nicht zuletzt eine immer wieder erneuerbare Vergewisserung des unangreifbaren symbolischen Kapitals. Allerdings unterschied sich die Situation im Kaiserreich deutlich von den volksnahen Popularisierungsbestrebungen um die Jahrhundertmitte. Was jetzt hier inszeniert wurde, war weihevoller, reiner Kunstbetrieb, mit dem sich privilegierte Teile des Bildungsbürgertums von der so genannten »Massenkultur« und den Aktivitäten der Arbeiterkulturvereine abgrenzten. Von der Vorstellung der Jahrhundertmitte, dass das »Volk« der wahre Kunstrichter sei, für dessen ästhetische Fortbildung Semper 1851 in seiner Schrift Wissenschaft, Industrie und Kunst verschiedene praxisorientierte Vorschläge entworfen hatte, war die deutsche Gründerzeitgesellschaft weit entfernt. »Arme Leute aus den äußersten Vorstädten«, die 1838 in Wien »ihre saueren 20x [Kreuzer]« für ein Konzert des neuen Stars Clara Wieck ausgegeben hatten (Wieck Briefe, S. 87), oder die »Unbemittelten« wie in den Londoner Populär Concerts dürften die Konzertsäle des deutschen Reichs kaum betreten haben. Den Kunstbegriff verengten die »Meinungsführer« aus dem Bildungsbürgertum wie Clara Schumann, Joachim und Brahms auf die in Konzerten und Museen praktizierte »Hochkultur«, während man die inzwischen entstandenen Formen der Arbeiter- und Unterhaltungsmusik ignorierte. Eines ihrer wichtigsten Instrumente hatte die bildungsbürgerliche Schicht längst institutionalisiert, nämlich einen Kanon anerkannter Meisterwerke.
Kanon und Museum
Historistische Aspekte »Die Concerte sind das für die Tonkunst, was Galerien und Gemäldeausstellungen für die Malerei«, behauptete Franz Brendel 1852. »Wenn aber für die ältere Malerei und die der Gegenwart zwei verschiedene Vereinigungspuncte gegeben sind, so für die Werke der Tonkunst nur ein einziger. Es ergiebt sich Historische Aspekte
395
hieraus die Forderung umfassender Programme, in die das Bedeutende aller Zeiten aufzunehmen ist« (Brendel 1852, S. 518). Brendel hielt in seinen Leipziger Vorlesungen drei Optionen für die Funktion von öffentlichen Konzerten fest, nämlich einmal die Konzentration auf die Werke (anstatt auf die darstellenden Künstlerinnen und Künstler), zum zweiten die Präsentation herausragender Beispiele aus Geschichte und Gegenwart sowie drittens den zu erzielenden Bildungseffekt. Hier reflektierte Brendel eine schon erprobte Praxis. Im Januar 1838 hatte Felix Mendelssohn Bartholdy als Musikdirektor des Leipziger Gewandhausorchesters die zuvor schon von François-Joseph Fétis in Paris praktizierte Museumsidee aufgegriffen und vier »hystorische Concerte« (Clara Schumann) initiiert, die »nach der Reihenfolge der berühmtesten Meister, von vor 100 Jahren bis auf die jetzige Zeit angeordnet« waren, wie ein zeitgenössischer Bericht informiert. Man riss sich um die Karten, so dass »alle Saalthüren nach den Vorsälen, der Menge der Hörer wegen, offen bleiben mussten« (in: Dörffel 1980,1, S. 91 und 98). Die vier Abende waren Teil der Abonnementreihe. In der ersten Serie stellte Mendelssohn ein historisches Panorama mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn, Domenico Cimarosa, Vincenzo Righini, dann Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri, Etienne Nicholas Méhul und Bernhard Romberg, und schließlich Abbé Vogler, Carl Maria von Weber und Ludwig van Beethoven vor. Eine Pioniertat im deutschen Konzertleben. Das Unternehmen traf den Nerv der Zeit. Die Konzerte boten eine sinnlich zu erfahrende Musikgeschichte in Beispielen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als noch kaum schriftlich formulierte und weitererzählbare Geschichten der Musik bis in die Gegenwart vorlagen. Die historischen Konzerte euphorisierten allein schon deswegen, weil Musikwerke, egal aus welcher Epoche, nach wie vor aufgeführt werden mussten, um überhaupt präsent zu sein. Viele Stücke waren selbst in Notenausgaben noch nicht allgemein zugänglich. Musikalische Kunstwerke besaßen kein vergleichbares Verbreitungsmedium wie die in den Gemälde- und Skulpturgalerien gesammelte Bildende Kunst. Deren Bestand reproduzierte man seit Anfang des 19. Jahrhunderts in einfarbigen Stichen. Bildungsreisende bekamen durch die Grafik eine gleichsam vorstrukturierte Anschauung von dem, was sie in den Galerien besichtigen würden, und sie konnten die einzelnen Kunstwerke nach den Bildvorlagen bereits studieren, um sich dann umso intensiver in die »Originale« zu vertiefen. Gleichzeitig trug die in den Katalogen publizierte Auswahl viel zur Kanonisierung bestimmter Kunstwerke bei (Belting 1998, S. 66f). Diese Funktion erfüllte in den Konzertserien die Programmauswahl.
396
Kaiserreich und Kanon
Musik wurde durch Notendrucke verbreitet. Damit auch Opern, Orchester- oder Kammermusik wenigstens ansatzweise klanglich reproduziert werden konnten, kursierte eine Fülle von Bearbeitungen ftir Klavier und verschiedene andere Instrumente. Allerdings setzte die Realisierung der in Klavierauszügen zusammengefassten Werke fortgeschrittene musikalische Kompetenzen voraus. Da die Drucke nach wie vor teuer waren, blühte ein Musikalienleihhandel. Beliefert wurden neben Privatpersonen verschiedene Institutionen, wie Chorund Orchestervereine. Nach Tobias Widmaier bestand ein direkter Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Aufschwung und der Verbreitung von Musikalien. Das dort vertriebene Repertoire folgte allerdings merkantilen und nicht musikpädagogischen oder bildungsorientierten Interessen. Angeboten wurde die »Favorit-Musikalien des Publikums« (in: Widmaier 1998, S. 168), die Händlern dutzendfach zum Verleih und Verkauf anschafften. Die musikalische Museumsidee faszinierte Ende der dreißiger Jahre nicht nur Veranstalter, sondern auch Komponierende. Louis Spohr konzipierte 1840 seine Sechste op. 116 als »historische Sinfonie im Stil und Geschmack vier verschiedener Zeitabschnitte«, wie der Untertitel lautete. Der erste Satz folgte stilistisch Händel und Bach, das Adagio bezog sich auf die Periode Haydns und Mozarts, das Scherzo auf Beethoven, das Finale auf die »allerneueste Periode«, so Spohr. Derartige systematisch angelegte Kompositionen in älteren Stilen lagen auch schon von Otto Nicolai, Ignaz Moscheies und Wilhelm Taubert vor, wie Schumann bei der Besprechung von Spohrs Sinfonie anmerkte. Bezeichnenderweise hielt Schumann das Werk für die Stilübung einer älteren Kunstdidaktik, nach der man Tonsätze »alter Meister« kopierte, um sich mit deren Techniken vertraut zu machen. Das Scherzo im Beethovenschen Stil sei am gründlichsten misslungen. Am selben Abend hörte man im Konzert nämlich noch »echtesten Beethoven« (die Ouvertüre Zur Namensfeier op. 115), »wie er freilich nie in einer historischen Sinfonie zu bannen sein wird«. Während er das Experiment in der Rezension »interessant« nannte, notierte Schumann im Tagebuch: »Spohr's nicht würdig«. Schumann verurteilte Spohrs Verfahren als beliebig adaptierbaren Stilpluralismus. Diese Form einer subjektiven Aneignung der Vergangenheit trivialisierte seiner Auffassung nach den Sinn von Geschichte und ignorierte das darin enthaltene Entwicklungsmoment. Die in der Vergangenheit entworfenen Kompositionen sollten dazu herausfordern, die eigene historische Position kritisch zu reflektieren, anstatt sie einfach nachzumachen. Ein »Genie wie das eines Mozarts [würde], heute geboren, eher Chopinsche Konzerte schreiben«, lautete eine bekannte Uberzeugung Schumanns von 1836 {Tb 2, S. 139; GS 1, S. 159; GS 2, S. 50).
Historische Aspekte
397
Die aus der Aufklärung stammende moderne Museumsidee geriet im 19. Jahrhundert unter den Einfluss des Historismus. Ein Stück weit kann die ausgeprägte Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit und der Wunsch, die nationale Geschichtsschreibung auf wissenschaftliche Grundlagen zu stellen (wofür Historismus um 1850 steht), als ein kulturelles Krisenphänomen gesehen werden, das durch die beginnende Globalisierung beschleunigt wurde (Riedel 2004, S. 113ff.; Bayly 2004, S. 248ff). Kolonialismus und die Ausweitung des internationalen Handels brachten unter anderem auch Einsichten in außereuropäische Kulturen, deren Erzeugnisse man bei den seit 1851 regelmäßig veranstalteten Weltausstellungen bestaunen und auf dem europäischen Markt kaufen konnte. Inzwischen hatte auch die wissenschaftliche Erforschung außereuropäischer Völker begonnen, die zeigte, dass viele Kulturen früher als die europäischen über ausgeklügelte Schriftsysteme und profundes Wissen verfugten. »Bis jetzt kennen wir nur deutsche, französische und italienische Musik als Gattungen. Wie aber, wenn die andern Völker dazukommen bis nach Patagonien hin?«, fragte Schumann 1833 (GS 1, S. 29). Diese Konfrontation forcierte eine intensive Beschäftigung mit der eigenen Kultur und beflügelte das Motiv, die eigene historische und ethnische Überlegenheit mit universalistischem Anspruch als naturgegeben zu behaupten. Die Geschichte sollte Halt und Identität geben. So führte die Beschäftigung mit außereuropäischen Tonsystemen Musiktheoretiker wie Fetis und Helmholtz zu der These, die der artifiziellen europäischen Musik zugrunde liegende harmonische Tonalität sei »in einer unveränderlichen Natur der Sache und des Menschen begründet« (Dahlhaus 1977, S. 96). Damit ließen sich alle anderen Systeme zu Abweichungsphänomen deklarieren. Wie man mit Geschichte umgehen sollte, blieb allerdings umstritten. Seit der Einrichtung von Museen als öffentliche, einem allgemeinen Publikum zugängliche, permanente Schauräume Bildender Kunst diskutierte man deren Funktion. Dabei kreuzten sich verschiedene Konzepte. Während eine Gruppe die im Museum ausgestellten Werke als »Schule des Geschmacks« nutzte (eine Idee, der sich noch Sempers didaktische Vorschläge zur ästhetischen Volkserziehung von 1851 anschlössen), wollte die andere Seite die Sammlungen als eine »Schule der Geschichte« aufziehen, insofern sich an Kunstwerken das Beste aus dem Fortschritt menschlichen Geistes ablesen ließe (Belting 1998, S. 63ff). Die Geschmacksschulung setzte eine ältere Tradition fort, nach der aus den mustergültigen »Meisterwerken« der griechischrömischen Antike, oft vermittelt durch die Renaissance, die Ideale von Kunst abgeleitet und nachgeahmt werden konnten. Allerdings lauerte hier die Gefahr, das Uberlieferte zu dogmatisieren. Unter Schumanns Musikparteien
398
Kaiserreich und Kanon
von 1836 galt diese Sorte Traditionalisten als »Reaktionäre« und »Kontrapunktler« (GS 1, S. 144). Dagegen fokussierten Vertreter eines individuellen Konzepts das Interesse auf die Bedeutung der menschlichen Kunstleistungen insgesamt. Sie standen indessen vor dem Problem mit einer Fülle beliebiger Beispiele umgehen zu müssen. So beschäftigte Mendelssohn Bartholdy offensichtlich die gleiche Frage wie zahlreiche Museumskomittees, nämlich nach einer qualitativen Auswahl, damit die bedeutendsten Glanzstück nicht schlicht in der Menge untergingen. Vermutlich wurden deswegen die Programme bei der Fortsetzung seiner historischen Konzerte 1841 entsprechend modifiziert. Mendelssohn ließ das historische Umfeld (Kompositionen von Salieri, Righini, Romberg, Méhul, Vogler und Weber) weg und reservierte die der Musik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts gewidmeten Abende allein Bach und Händel, Haydn, Mozart und Beethoven. Anstelle eines Rundblicks historischer Musik standen jetzt allein die exquisiten Leistungen von herausragenden Heroen aus der Musikgeschichte im Mittelpunkt. Obwohl man schon seit mehr als einem Jahrzehnt öffentliche Konzerte mit »alter Musik« kannte, erschien Mendelssohn Bartholdys Präsentationsform indessen selbst für die Schumanns derart gewöhnungsbedürftig, dass sie nicht ganz damit zu Recht kamen. So viel geballte, die ganze Aufmerksamkeit erfordernde »höchste« Kunst musste man erst aushalten lernen. »Fast des Herrlichen zuviel«, so Schumanns Urteil. Man habe »nicht alle Tage Kraft zum Abspiegeln und Auffassen des Außergewöhnlichen (daran erkennt man es eben)«. Doch hätten Bachs Solostücke, neben der Chromatischen Fantasie und einer von Ferdinand David gespielten Chaconne (vermutlich d-moll B W V 1004), den Beweis gegeben, dass man damit »im Konzertsaale noch enthusiasmieren könne«. Zum Abschluss bot Mendelssohn Bartholdy Beethovens Neunte Sinfonie op. 125, und Schumann lobte ausdrücklich das Publikum für seine Anteilnahme am musikalischen Geschehen (GS 2, S. 55f. und 352; Tb 2, S. 142). M i t der Form des historischen Konzerts, bei dem man an einem Abend das Œuvre eines Komponisten würdigte, nahm Mendelssohn Bartholdy eine Aufwertung einzelner »Meister« vorweg, die sich allgemein erst in den kunstpädagogischen Präsentationsformen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchzusetzen begann. So konzipierte Semper beim Neubau der Dresdner Gemäldegalerie 1855 für die Inszenierung von Raffaels Sixtinischer Madonna einen eigenen kapellenartigen kleinen Saal. Das Gemälde ruhte jetzt erhöht auf einem Postament und war prunkvoll golden eingeschreint. Auf samtbezogenen Bänken konnten die Betrachter davor andächtig in Kontemplation versinken. Erst nachdem er es »von der gesamten übrigen Welt Historische Aspekte
399
abgesondert« gesehen habe, sei ihm die Madonna als Kunstwerk der »ganzen Bedeutung nach immer heller vor die Seele« getreten, behauptete Carl Gustav Carus (in: Belting 1998, S. 93f). Der entscheidende Aspekt dabei war die Isolierung der Werke aus ihrem historischen und funktionalen Kontext. Erst dadurch forcierte man ihre überzeitliche, gleichsam »absolute« Bedeutung. Ahnliche Präsentationsformen wählte man im Louvre auch für die Ausstellung von Leonardo da Vincis La Gioconda. Damit wandelte sich das Museum endgültig in eine pseudoreligiöse »auratische Heimstatt« für die Kunst (W. Hofmann 1983, S. 51). Der gleiche Vorgang lässt sich auch im Konzertsaal beobachten. Franz Brendel orientierte sich in seinen Vorlesungen zur Musikgeschichte 1850 wie nach ihm August Wilhelm Ambros an Modellen der Kunstgeschichte und setzte die »Meisterjahre, die klassische Zeit der Tonkunst« (S. 35), in der Renaissance an. Ambros' 1862 begonnene mehrbändige Geschichte der Musik brach an diesem historischen Punkt ab. Allerdings war die Kunstgeschichte mit ihren reichhaltigen Kapiteln zur Antike und zur Renaissance nur sehr eingeschränkt als Modell für die Musikgeschichte geeignet. Schließlich konnte man in der Musik nicht auf die glorreiche Antike als eine bereits in sich vollendete Kunstepoche zurückgreifen. Die raren Fragmente antiker Musik bezeugten eher verstörende Fremdheit. In den frühen Entwürfen deutscher Musikgeschichtsschreibung wie etwa in Johann Nikolaus Forkels zweibändiger Allgemeinen Geschichte der Musik (1788 und 1801) war nicht einmal entschieden, ob der ernüchternd spröde Kirchengesang des Mittelalters, der Ursprung »abendländischer« Musik, beziehungsweise die Zeugnisse früher Mehrstimmigkeit überhaupt als Kunst gelten sollten. Entgegen der kunstgeschichtlichen Positionierung als Stilepoche blieben auch historisch kritische Köpfe wie Schumann bei der schon Ende des 18. Jahrhunderts geläufigen Wendung, die Besonderheiten gotischer Baukunst musikalisch mit den »gothischen Tempelwerken von Bach, Händel, Gluck« und nicht mit historisch adäquateren Zeugnissen aus früheren Jahrhunderten zu vergleichen (GS 1, S. 114). Brendels Darstellung der Musikgeschichte gewann erst an der Stelle an Emphase, wo er die deutsche Musik nach der Reformation ins Licht rückte. Aus dieser Perspektive ragten Bach und Händel als »Spitzen eines Gebirges« hervor. Sie vertraten in seinem dialektischen Konzept die geistige, Haydn und Mozart die sinnliche und Beethoven die Synthese aller Komponenten. Diese Komponisten wuchsen zu den eigentlichen Riesen, auf deren Schultern die Kunst der Gegenwart ruhte, unabhängig von der »klassischen« Tonkunst der Renaissance und ihren hoch gelobten Kontrapunktmeistern (Brendel 1852, S. 147ff. und 238ff). 400
Kaiserreich und Kanon
Wie Schumann legte Brendel ein moderneres Werkverständnis zugrunde, das sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts herausgebildet hatte, und projizierte es in die Geschichte zurück. Danach waren Meisterwerke mehr »Wunder der Kunst« als mustergültig vollendete Handwerksstücke. Ihr »schöpferischer Akt« konnte nicht rational definiert, sondern nur erahnt und daher auch nicht erklärt, sondern bloß metaphorisch umschrieben werden (Belting 1998, S. 64). An Beispielen wie Beethoven ließ sich gerade die unnachahmliche Originalität als vorbildlich bewundern. Wenn man etwas aus ihnen lernen wollte, dann die Idee der Freiheit, der Selbstschöpfung des Menschen im Akt der Kunst. Dass Bach und Händel unter die geniehaft produzierenden Künstler gereiht wurden, dürfte neben einem am Meisterwerk orientierten Geschichtskonzept nicht zuletzt mit ihrer frühen »Entdeckung« beziehungsweise Aufwertung Ende der 1820er Jahre zusammen hängen. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Kultur tragende bürgerliche Schicht in Deutschland auf keine nennenswerte eigene Geschichte zurück blicken. Sie musste erst geschrieben, wenn nicht überhaupt erfunden werden. Mit Bach und Händel lagen Zeugnisse aus einer näheren, bereits durch »Bürgerfleiß« geprägten Vergangenheit vor, an denen man alte Musik schätzen lernen konnte. Die historischen Prämissen, unter denen die Werke entstanden waren, spielten in diesem Geschichtskonzept keine Rolle. Im Fall von Bach etwa wurden die Kompositionen aus dem zeitgenössischen Kontext heraus gelöst, ihrer ursprünglichen Funktion enthoben und als zeitlos gültige Produkte der Autonomieästhetik in den Konzertsaal überfuhrt. So zelebrierten Spontini in der Oper in Berlin und Mendelssohn Bartholdy im Leipziger Gewandhaus Teile aus Bachs h-Moll-Messe BWV 232 als Konzertstücke. Wenn Schumann Bach zum Stammvater der Moderne deklarierte, so leiteten ihn allerdings noch andere Motive. Indem er eine musikalische Genealogie konstruierte, gliederte er die neue Musik mitsamt den »Fortschrittlichen« in ein Musikgeschichtskonzept ein und positionierte sich selbst als Nachfahre einer bedeutenden Ahnenreihe. Wie vor ihm schon E. T. A. Hoffmann zog Schumann eine Ideallinie von Bach über Beethoven in die eigene Gegenwart. Diese Funktion erfüllte das Bild vom zeitgenössischen Komponisten, der »wenigstens noch Blumen« ziehe »auf dem Feld, wo er [Bach] riesenarmige Eichenwälder angelegt«, das Schumann in einer 1837 verfassten Rezension über Mendelssohn Bartholdys Präludien und Fugen op. 35 entworfen hatte (GS 1, S. 253). Die Pflanzenmetapher verwies auf einen gemeinsamen Nährboden und suggerierte, die eigene Kunst sei quasi organisch daraus erwachsen, auch wenn die Avantgarde Ende der 1830er Jahre in feiner Abgrenzung gegenüber reiner Traditionspflege Blumen statt Eichenspros-
Historische Aspekte
401
sen kultivierte. Traditionalismus stand nämlich für eine »Dogmatisierung des Uberlieferten«, die dem Konzept kritischer Reflexion des Historischen widersprach (Riedel 2004, S. 115). Mit der Eiche griff Schumann auf ein zentrales Symbol nationaler Identifikation zurück. Wenn er den Namen »Bach« in ihren Stamm ritzte, dann lag darin zwar mehr eine literarische Projektion als eine historisch ableitbare Herkunft. Doch behauptete er damit einen doppelten Anspruch. Zum einen sollte demonstriert werden, dass der Musik ein wesentlicher Anteil an der nationalen Kultur zukam. Zum anderen positionierte Schumann sich und seine eigene bildungsbürgerliche Schicht als legitime Repräsentanten einer in der nationalen Geschichte wurzelnden aktuellen Kultur. Abseits von Herrschergenealogien, politischer und Kriegsgeschichte bekundeten die Kunstzeugnisse damit emphatisch einen positiv konnotierten, historischen Fortschritt, den die bürgerliche Intellektuellenschicht in Deutschland als eigene, nationale Errungenschaft für sich reklamierte. Diese genuin bürgerliche Kunst stand nicht hinter der früheren feudalen zurück. Ganz im Gegenteil. Sie überflügelte sie noch durch das Moment schöpferischer Freiheit und Humanität, das man im autonomen Meisterwerkskonzept enthalten sah. Noch »kein Land der Welt [hätte] Meister, die sich mit unseren großen vergleichen könnten«, so Robert Schumann 1844. Dem »tiefer blickenden Denker und Kenner der Menschheit wird es nur natürlich und erfreulich vorkommen«, dass die »angrenzenden Nationen sich von der Herrschaft der deutschen Musik emanzipieren wollten«. Allein, gelingen würde das kaum, denn »die höchsten Spitzen italienischer Kunst reichen noch nicht bis an die ersten Anfänge wahrhafter deutscher« heran (GS 2, S. 89 und 158). Die positive Bewertung der Meisterwerke hing vor allem mit dem ideologisierten Ansehen von ästhetischer Autonomie zusammen. Ein ästhetisch autonomes Kunstwerk symbolisierte das Ideal der Freiheit von Handlungszwängen und Utilitarismus. Insofern konnte es in Anlehnung an Schillers Utopie mit dem Humanitären verknüpft werden: »Das Schöne beschäftigt und kultiviert Vernunft und Sinnlichkeit, befördert durch Verengung ihres Bundes die Humanität, stiftet Vereinigung zwischen der physischen und moralischen Natur des Menschen« (Schiller 2004, 5, S. 1041). Gleichzeitig deklarierte man die individuellen Künstler aus der eigenen Geschichte zu Genies, die aus dem Kollektiv eines »natürlichen« Volkes hervorgegangen waren und mit ihrer Kunst nationale Potentiale repräsentierten (von Heydebrand/ Winko 1996, S. 25ff). Dabei wurde der humanitäre Bildungsaspekt immer stärker von Motiven einer Nationalgeschichte beeinflusst. Verschränkte man allgemeine Werte wie Humanität und Autonomie mit nationalen Mythen 402
Kaiserreich und Kanon
und entsprechenden Heldentypen, so konnte die Reihe großer Komponisten und ihre »Meisterwerke« nicht allein unter Kunstenthusiasten, sondern auch im nationalen Interesse identitätsstiftend wirken. Die Kunst lieferte wertvolle Werke, in denen nicht nur zentrale ästhetische und politische (Autonomie, Freiheit), sondern auch moralische Normen (Humanität) des sich bildenden deutschen Nationalstaats kodiert waren. Das neue Meisterwerksideal beflügelte die in den Konzertsälen erklingenden Musikgeschichten. Es synthetisierte gewissermaßen den älteren Disput zwischen ästhetisch fundierter Selektion und historischer Dokumentation. In diesem Sinne sollten die in Konzerten wie im Museum präsentierten Stücke jeweils das in ihrer Zeit Unübertroffene demonstrieren. Umgekehrt verpflichteten die »Meisterwerke« nun alle, die damit umgingen, auf ein bestimmtes Künstlerethos. Gemeinsam verachtete man triviale oder kommerzielle Tendenzen in der Kunst, gemeinsam berief man sich auf hohe Werte und Ideale. Zugleich ermöglichte der Kanon dem Bildungsbürgertum, sich über ihn zu legitimieren und gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. Daher konkurrierten die Komponierenden untereinander nicht mehr bloß um Marktanteile, sondern auch um das Prestige, zum Kanon zu gehören. Robert Schumann hatte 1848 für seine ältesten Töchter eine klingende Musikgeschichte entworfen, um sie mit unterschiedlichen Satztechniken vertraut zu machen. Dafür bearbeitete er Musik von Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven (sogar die neunte Sinfonie), Weber, Schubert, Spohr und Mendelssohn (Appel, in: Schumann-Interpretationen 1, S. 436). Hier wurde in nuce ein »klassischer« Kanon zusammengestellt, der (außer Spohr und Weber) weitgehend dem entsprach, was Robert Schumann schon 1841 als die »größten« Werke »deutscher Komponisten« bezeichnet hatte (GS 2, S. 53) und Clara Schumann auf dem Podium tradierte. Am Repertoire und an einzelnen Äußerungen der Virtuosin lässt sich ablesen, dass sie - anders als zu Beginn ihrer Karriere - seit den 1840er Jahren das gleiche geschichtsphilosophische Konzept wie ihr Mann vertrat. Selbst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts reichte die in den Konzertsälen erklingende Musikgeschichte indessen kaum weiter als bis Bach zurück. Anders als Brahms, der in seinen Veranstaltungen gezielt Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert aufführte (K. und R. Hofmann 2006, passim), blieben auch Clara Schumanns Programme historisch einem Zeitraum von etwa 100 Jahren verhaftet. Vielmehr schälte sich jetzt in den Konzertprogrammen ein doppelt eingeschränkter Werkkanon heraus. Zunächst reduzierte man die Fülle von Komponierenden in den Programmen auf wenige herausragende Männer aus der nationalen Vergangenheit. Frauen kamen
Historische Aspekte
403
darin nur als sehr seltene Ausnahmen vor, da man ihnen inzwischen - nun biologisch begründet - schöpferische Fähigkeiten gänzlich absprach. Sodann stellte man aus dem individuellen Werkbestand einiger weniger Heroen einen kleinen Strauß von Werken zusammen, meist ohne die Gründe und Motive der Wahl darzulegen. Die Praxis kam dem Bedürfnis der Gründerzeitgesellschaft nach festen Werten entgegen. Reinhard Kopiez und Andreas Lehmann bestätigen diese Eineingung im Repertoire Clara Schumanns. Von den 77 in ihrem Künstlerleben gespielten Komponistinnen und Komponisten beherrschten 15 auserlesene mehr als Dreiviertel ihrer Programme, darunter Schumann, Beethoven, Chopin, Mendelssohn Bartholdy, Bach und Schubert. Und selbst bei Schumann, dessen Musik sie möglichst umfassend präsentieren wollte, kristallisierten sich innerhalb des Gesamtwerks immer wieder gespielte »Favoriten« heraus, etwa das Klavierkonzert op. 54, das Klavierquintett op. 44 (nach Hanslick eine »Lieblingsnummer des Publikums und der Clavierspieler«, Concertwesen 1, S. 429), aus den Klavierzyklen der Carnaval op. 9 und von den Einzelstücken Traumes Wirren op. 12 Nr. 7 und Ties Abends op. 12 Nr. 1 sowie das Schlummerlied, op. 124 Nr. 16. Innerhalb ihrer Beethoven-Auswahl gehörten die Waldstein- und die S/wr/w-Sonate (op. 53, op. 31,2), die Appassionata op. 57 sowie das vierte und fünfte Klavierkonzert (op. 58, op. 73) dazu. Außerdem ragte nach Ute Bär in den mit Joachim gespielten Programmen noch die »Kreutzer«-Sonate op. 47 vor allen anderen heraus (Bär 1999, S. 54). Obwohl Clara Schumann von Hanslick ausdrücklich dafür gelobt wurde, dass sie seit den 1850er Jahren neben den bekannten auch so manches wenig gespielte Beethoven-Stück vorführte wie die Eroica-Variationen op. 35 oder die letzten Sonaten (Concertwesen 1, S. 428), begannen die Rezensenten sich mit ihrem und Joachims immer wieder zu hörendem »Paradestück«, der »Kreutzer«-Sonate, zu langweilen. Nicht nur die besondere Qualität, sondern auch eine gewisse Bequemlichkeit mochte dazu gefuhrt haben, dass beide das ihnen schon so geläufige Stück immer wieder aufführten. »Die zur Eröffnung des Concerts gewählte Kreutzer-Sonate wurde zwar von den Concertgebern in seltener Vollendung vorgetragen, dennoch waren wir mit dieser Wahl nicht vollkommen einverstanden. Gewiß wäre es dem größten Teil des Publikums erwünschter gewesen, von 130 [!] Beethoven'schen Sonaten für Ciavier und Violine eine weniger bekannte zu hören, als die gerade bei uns schon so oft und immer wieder gespielte Kreutzer-Sonate«, so der Rezensent der Didaskalia nach dem Auftritt von Schumann und Joachim in Frankfurt am Main am 31. Oktober 1865 (in: Bär 1999, S. 55). 404
Kaiserreich und Kanon
Die Konzentration auf wenige Meisterwerke führte bereits in den 1850er Jahren zu einem als Verarmung kritisierten Auffiihrungsrepertoire. Man höre öffentlich nur noch acht Klavierkonzerte, nämlich »die Beethovenschen« und zwar das dritte, vierte und fünfte, die »Mendelssohn'schen«, das »Mozart'sehe in D-Moll, das Schumann'sche, endlich das Concertstück von Weber«, beklagte Brendel 1852 (S. 521). »Eroica, Meeresstille und glückliche Fahrt, Esdur-Concert von Beethoven - Alles vortreffliche Sachen, gut ausgeführt aber gar zu eingewöhnt«, so Moritz Hauptmanns Evaluierung der Leipziger Gewandhauskonzerte Ende der 1860er Jahre. Man »weiß jede Note, jedes Nötchen, jeden Effect voraus. Ich möchte manchmal zuerst etwas Anderes, etwas noch nicht Gekanntes, sei es Vergangenheit oder Gegenwart, nicht um dem Gekannten und Geliebten den Rücken zu wenden, nur um es in einer Umgebung zu sehen. Auch nicht immer höchste Spitzen, ohne Thäler und Hügel [...] Wir brauchen nicht jeden Winter alle Neune von Beethoven zu hören« (in: Concertwesen 2, S. 452). Genau aus diesem Grund hatte Liszt im Allgemeinen Deutschen Musikverein engagiert dafür gestritten, dass »bedeutende, wenig gehörte, insbesondere neue Tonwerke«, aber »auch ältere Werke, welche selten oder gar nicht mehr zu öffentlichen Aufführungen gelangen und dennoch durch ihre Bedeutsamkeit von allgemeinem Interessen« seien, aufgeführt werden. Das gelang nur halbherzig, weil die einzelnen Mitglieder des Vereins einerseits recht unterschiedliche Vorstellungen von der zu treffenden Auswahl hatten, andererseits aber auch partikulare Interessen verfolgten. Dies bildet die von Irina Lücke-Kaminiarz erstellte Konzertstatistik des Vereins ab. Zwischen 1859 und 1886 (Liszts Todesjahr) wurden in den Veranstaltungen der Tonkünstlerfeste mit Abstand am häufigsten Liszts Werke aufgeführt, gefolgt von denen Bachs. Bereits an dritter Position stand Brahms, vor Berlioz und Wagner. Dagegen rutschte Beethoven, den ja alle anderen schon dauernd aufführten, auf Platz elf, noch hinter Schumann und Felix Draeseke (in: LuckeKaminiarz 2006, S. 223 und 234f). Auch wenn die Repertoires einzelner Künstler und Veranstalter im 19. Jahrhundert unterschiedlich ausfielen - allein schon aufgrund der Besetzung - , so lassen sich nach der Jahrhundertmitte doch Gemeinsamkeiten ausmachen. Wie in Clara Schumanns, so rangierten in Hans von Bülows Klavierrepertoire Beethoven, Chopin, Bach und Brahms ebenfalls unter den am meisten vertretenen Komponisten. Der Unterschied zwischen beiden lag vor allem bei Werken von Liszt, die Schumann früher gelegentlich, später nicht mehr, von Bülow dagegen ausgiebig spielte (Hinrichsen 1999, S. 458ff). Im Ranking des von Joachim präsentierten Violinrepertoires stand bei den KonHistorische Aspekte
405
zerten Beethoven vor Mendelssohn und Spohr, bei den Solostücken Bachs Chaconne d-Moll BWV 1004 einsam an der Spitze, gefolgt von Tartini und Beethoven. Wieder etwas anders gelagert waren die Programme des JoachimQuartetts,, das zwischen 1869 und 1911 konzertierte. Hier konzentrierte sich die Auswahl auf Haydn, Mozart, Beethoven, dazu Mendelssohn und Brahms. In Ergänzung dazu hatte sich das Hellmesberger-Quartett besonders die Pflege der späten Beethoven-Quartette auf die Fahnen geschrieben (Borchard 2005, S. 500ff.; Concertiuesen 1, S. 427). In den Schnittmengen dieser Repertoires sammelten sich die neuen musikalischen »Klassiker« der Instrumentalmusik, vor allem Beethoven, aber auch Bach, die »Wiener« Haydn und Mozart sowie unter den jüngeren Mendelssohn Bartholdy, Chopin und Schumann, im späten 19. Jahrhundert ergänzt durch Brahms und Schubert (Klassen 2006, S. 63). Ein ebenso gelehrsamer, durchstrukturierter Programmablauf mit einem Barockstück, einer klassischen Sonate oder einem Konzert, romantischer Klaviermusik und einer Portion neuer Stücke, wie Clara Schumann ihn etablierte, boten seit den 1860er Jahren dann fast alle Pianistinnen und Pianisten. Er gilt heute noch für die meisten Klavierabende. Und jede beziehungsweise jeder reklamierte die Erfindung einer mit anspruchsvollen Werken bestückten Dramaturgie fur sich, wie von Bülow, der vom »Clavierconcert à la moi« sprach (in: Hinrichsen 1999, S. 61). In den 1870er Jahren zog Hans von Bülow Schumanns gedachte Ideallinie weiter bis Brahms und popularisierte die Formel von den drei großen »B's« (Bach -Beethoven - Brahms) als Richtschnur einer »ästhetischen Konfession«, so Hinrichsen (Hinrichsen 1999, S. 92fF), die in der deutschen Musikauffassung ungeahnt lange hielt, selbst wenn sie - bezogen auf Brahms sofort persifliert wurde: »Bier - Bart - Bauch«. Diese Einseitigkeit prägte den Wert und die Bedeutung des musikalischen Kanons mit. Und hier dürfte auch der Unmut der Avantgarden begründet liegen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gegen seine einseitige kulturelle Deutungsmacht randalierten. Neu war nicht nur die implantierte historische Achse, neu war auch der Fokus auf die Autorität der einzelnen Werke. Sie bestimmten nicht nur das Repertoire, sondern formierten einen Bestand, an dem man sich abarbeitete, mit dem man sich immer wieder befasste, um an den einzelnen »Meisterwerken« in die »Tiefen« der Tonkunst einzudringen und wie bei der ständig wiederholten Lektüre kanonisierter Bibeltexte immer weitere Dimensionen des Verstehens auszuloten. Dazu kamen die seit Ende der 1860er Jahre besonders von Anton Rubinstein und von Bülow veranstalteten »monographischen« Konzerte, die jeweils dem Œuvre eines Komponisten gewidmet waren. So brachte von Bülow Beethoven-, Chopin-, Mendelssohn und auch Schu406
Kaiserreich und Kanon
mann-Konzerte aufs Podium. Hanslick lobte die Absicht grundsätzlich, auch wenn er nicht alles für gelungen hielt. Dass der Pianist dann aber 1881 einen ganzen Liszt-Abend veranstaltete, fand der Kritiker »tötlich« (Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fiinfaehn Jahre 1870-1885, S. 67f. und 315). Clara Schumann lehnte ein derartiges Konzept kategorisch ab, veranstaltete selber allerdings gelegentlich auch reine Robert Schumann-Abende. Nicht die Präsentation von Werkmonographien lag ihr am Herzen, sondern die Interpretation einzelner Meisterstücke. »Dieser Fortschritt in der geistigen Beherrschung, das Gefühl der vollkommenen Herrschaft über das Ganze beglückte mich«, schrieb Clara Schumann 1880 nach einer Aufführung von Beethovens Es-Dur Konzert op. 73, das sie seit mehr als 40 Jahren im Repertoire hatte (in: Litzmann 3, S. 415). Für die Virtuosen eröffnete sich die Möglichkeit, das Bekannte immer wieder neu zu interpretieren und die Werke auch dem Teil eines allgemeinen Publikums bis ins Detail vertraut zu machen, das sich sonst wenig oder selten damit auseinandersetzte, wie etwa die Vertreter der Politik- und Wirtschaftseliten. Nicht nur die Klavierkonzerte, auch Beethovens Violinkonzert op. 61, von dem Clara Wieck noch gefunden hatte, dass es »doch schon sehr alt klingt« (Jb, 31. Oktober 1839), wurden jetzt im Sinne einer einmaligen Genieleistung individualisiert. Seit Joachims Auffuhrung des Konzerts in London 1844 unter Mendelssohn Bartholdys Leitung und vor allem seit der legendären Interpretation beim Niederrheinischen Musikfest 1853 gehörte es zum Kanon beständiger Meisterwerke, unabhängig davon, dass die technische Entwicklung des virtuosen Spiels längst über Beethovens Stand hinaus gewachsen war (Borchard 2005, S. 509). Parallel zu einer in der Literaturgeschichte konstruierten, durch die Heroen Goethe und Schiller vertretenen literarischen deutschen »Klassik« (Hohendahl 1985, S. 164), verschweißte man nun die Werke von Haydn, Mozart und Beethoven zu einer musikalischen »Klassik« von Zeit überdauernder Größe, Bach als Gründungsvater inbegriffen. Eine einschlägige Repertoirepraxis sowie entsprechende theoretische Musikgeschichtsmodelle wirkten hier gleichsam Hand in Hand. Erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erweiterte sich der allgemeine historische Rahmen, da mehrere Künstler die Idee einer klingenden Musikgeschichte wieder aufgriffen. Berühmt wurde Rubinsteins siebenteiliger Zyklus mit Klavierwerken aus drei Jahrhunderten, angefangen bei Byrd und Bull bis in die eigene Zeit mit Rubinsteins Kompositionen und denen russischer Zeitgenossen, den der Künstler, unterstützt durch die Klavierfabrik Bechstein, 1885 und 1886 in Amerika und Europa bot. Beethoven und Schumann widmete Rubinstein darin je ein eigenes Konzert. Ahnlich Historische Aspekte
407
entwarf Amalie Joachim 1891 eine an vier Abenden gesungene Geschichte des deutschen Lieds. Sie begann mit Volksweisen aus dem 15. Jahrhundert sowie Volksliedbearbeitungen, an die sich eine Geschichte des Kunstlieds anschloss, die mit Brahms, Cornelius und Bruch endete (in: Borchard 2005, S. 465ff). Clara Schumann blieb dagegen bei ihrem Format. Die Kanonisierung weniger überschaubarer Meisterwerke verstärkte den rituellen Charakter öffentlicher Theater- und Konzertdarbietungen noch. Man begab sich in die im Stil des Klassizismus oder der Neorenaissance gebauten Kunst- und Musentempel wie an einen weihevollen Ort. Unabhängig vom tatsächlichen Interesse leistete man sich ein Abonnement, denn Kunstbeflissenheit ergänzte das bürgerliche Wertesystem. Theater- oder Konzertbesuch galten als Ereignis. Man zog sich dafür um, tauschte die Alltags- gegen festliche Kleider. Die Damen zwängten sich in Korsetts und Tournüren, schminkten und parfümierten sich. Die Herren mutierten zu Kavalieren, pomadierten die Haare, trugen Zylinder und weiße Handschuhe. Zur Pausenerfrischung drehte die Großmama Clara Schumann ihren Enkeln kleine Pralinentütchen (in: 7VZ/M1917, S. 97). Der Festcharakter jeder Veranstaltung, die stille Andacht und Konzentration während der Aufführungen, die Gewissheit, an etwas Erhabenem und Erhebendem teilzunehmen, das alles trug wesentlich zum »Kult« bei. Hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allmählich ein Konzertkanon herauskristallisiert, so war der nächste wichtige Schritt dessen Tradierung. Daran beteiligten sich unterschiedliche Institutionen. Es entspann sich eine Art »offenes, heterogenes Netzwerk« (Winko 2001, S. 300) aus Komponierenden und Virtuosen, Veranstaltern, Verlagen, Hochschulen und Bibliotheken. Dieses Netzwerk sorgte dafür, dass der Kanon etabliert und flächendeckend verbreitet wurde. Clara Schumann focht sowohl als Virtuosin als auch als Lehrerin und Herausgeberin nicht nur für einen allgemeinen Kanon »höchster« Kunst, sondern auch für die Durchsetzung und Kanonisierung der Werke ihres Mannes.
D e n k m ä l e r a u s M a r m o r und Papier Erinnerungskultur »Hier war jeder mit dem ganzen Herzen dabei«, so Clara Schumann. »Es fehlte ganz das PubÜcum, das kommt, um sich zu amüsiren«. Drei Tage dauerte die Gedächtnisfeier für Robert Schumann in Bonn 1873. Alle noch le-
408
Kaiserreich und Kanon
benden Schumannschen Kinder nahmen teil. Ferdinand hatte seine frisch angetraute Frau Antonie Deutsch mitgebracht. Aus Dresden reiste Clara Schumanns Bruder Alwin Wieck an. Dietrich, Grimm Joachim und Brahms, die »1854er«, fehlten nicht. In einer langen Liste unterrichtete die Bonner Zeitung darüber, welche Prominenten wo abgestiegen waren. Jenny Lind mit ihrem Mann beehrte das Schumann-Fest ebenso wie Livia Frege, Amalie Joachim, Julius Stockhausen und der Verleger Simrock, die Townsends aus London, Reinthalers aus Bremen. Auch Hiller, Rudorff und Max Bruch reihten sich unter die Gäste. Ganz im Sinne des Andenkenkults konnte man ein »Erinnerungsblatt« erwerben, in dessen Mittelpunkt Bendemanns posthume Schumann-Zeichnung von 1859 schwebte, umkreist von den Porträts aller an den Konzerten mitwirkenden Solisten und Dirigenten. Clara Schumann stand im Zenit (Bodsch, in: Kat. S. 297ff). Nach langem Gezerre teilten sich von Wasielewski, damals Bonner Musikdirektor, und Joachim die Leitung. Auch um das Programm stritt man im Vorfeld heftig. Brahms hätte gern sein Requiem zu Ehren Schumanns aufgeführt, doch brachte man das große Stück im Festival-Programm nicht unter, weil die Ausfuhrenden für Schumanns Paradies und Peri op. 50 sowie die Faust-Szenen gebraucht wurden. Der Erlös des Schumann-Festes, »4000 Thaler« (in: Litzmann 3, S. 296), sollte für eine repräsentative Neugestaltung von Schumanns Grab in Bonn verwendet werden. Dafür beauftragte man den Bildhauer Adolf von Donndorf aus Stuttgart, einen ehemaligen Schüler Rietschels. Sieben Jahre später konnte das Grabdenkmal der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Einweihung 1880 wurde von einem weiteren Robert Schumann-Fest umrankt. Diesmal übernahmen Joachim und Brahms die Leitung. Doch nicht das Brahmssche, sondern Schumanns Requiem fiir Mignon op. 98b erklang zum Andenken an den Verstorbenen. Im Zuge der Bauarbeiten mussten die Uberreste Schumanns umgebettet werden. Den ersten inzwischen mit Efeu überwachsenen Grabstein, um dessen schlichte Gestaltung »in gothischer Schrift« Brahms sich 1856 gekümmert hatte, senkte man mit in die neue Gruft ein. Bei dieser Gelegenheit entnahm man einige Haare des Toten und Holzsplitter seines Sarges. Wie kostbare Körperspuren eines Heiligen wurden sie in ein Silber beschlagenes Reliquar aus Ebenholz eingeschreint und dem ausführenden Maurermeister als Ehrengabe überlassen (Nauhaus, in: Zwischen Poesie und Musik 2006, S. 383f). Für sich allein wäre Clara Schumann vielleicht mit der vorhandenen Grabstätte zufrieden gewesen. Sie selbst hatte dessen schlichte Gestaltung gewünscht und bei ihren Besuchen die Stille und den »Frieden auf dem Kirchhof« wohltuend empfunden. Doch ging es hier nicht mehr allein um Erinnerungskultur
409
private Gefühle. Vielmehr war die Verehrung des Komponisten eine öffentliche Angelegenheit. Clara Schumann behielt ihre vermittelnde Verantwortung in diesem Punkt fest im Blick. Daher wünschte die Witwe einen Denkmalentwurf, der »etwas Symbolisches« enthalte und »die Charakteristik meines Mannes künstlerisch« präsentiere. Donndorf entwarf für das heute noch auf dem alten Bonner Friedhof zu besichtigende imposante Denkmal eine im Halbrund abschließende konkave Vorderfront, in die oben ein dem Rietschelschen Porträt von 1846 nach geschnittenes Halbrelief Schumanns im Profil eingearbeitet ist. Es wird von den Flügeln eines auffliegenden Schwans getragen und von allegorischen Putten der Musik und der Poesie begleitet, während unten am Sockel in gehöriger Distanz eine anmutige Muse mit Schleifenkranz und Notenrolle kauert und ehrfurchtsvoll zu ihm aufblickt. »Das Denkmal findet großen Beifall«, so Clara Schumann. Allerdings gefiel ihr das Porträtrelief nicht. Es »fehlt zwar nicht die Ähnlichkeit, aber der geistige Ausdruck.« Ansonsten sei das Grabmal »poetisch, zart, reizend erfunden«, und sie freute sich »der Anerkennung für Donndorf« (in: Litzmann 3, S. 294 und 408; Zwischen Poesie und Musik 2006, S. 382). Als sie selbst am 20. Mai 1896 ihre letzte Ruhestätte dort an der Seite von Robert Schumanns sterblichen Uberresten fand, veränderte man das Grabmal allerdings nicht mehr. Es wäre ja denkbar gewesen, dem Medaillon mit Robert Schumanns Profil wieder die ursprüngliche Fassung von Rietschel zu geben, nämlich als Doppelporträt. Doch die Töchter beließen das Denkmal, wie es stand. Clara Schumann erhielt eine eigene Grabplatte, die an die unterste Stufe von Donndorfs Monument angelehnt wurde. Mit jeder Aktion, die sie begann, um Robert Schumann unsterblich zu machen, setzte Clara Schumann sich selbst ein Denkmal. Dass ihr diese Funktion bewusst war, zeigen ihre Notizen zum Schumann-Fest 1873. Sie hätte weinen mögen über »all die Liebe und Verehrung für ihn«, die »wie aus einem Füllhorn auf mich herabfluthete, während er draußen auf dem Kirchhof ruhete!« »Welch eine Theilnahme wurde mir entgegen gebracht! Diese hundert Händedrücke, wie hingen alle Blicke an mir [ . . . ] Ich fühlte mich ganz unerwartet im Mittelpunkt des Festes«. Jenny Lind hatte sich Clara Schumann zu Ehren vom Platz erhoben, als die Virtuosin die Bühne betrat. Joachim wedelte mit einem weißen Taschentuch, und offenbar taten es alle im Saal ihnen nach (in: Litzmann 3, S. 295ff). In der Gründerzeit, als Robert Schumann daran war, in den Reigen »großer Geister« der Musikgeschichte eingereiht zu werden, musste man sich ernsthaft und professionell um sein musikalisches Erbe kümmern. Dazu gehörte, 410
Kaiserreich und Kanon
verstreute Handschriften einzusammeln, Briefe und Tagebücher für die Öffentlichkeit zu exzerpieren und sich vor allem um autorisierte Notendrucke zu bemühen. Nach- und Raubdrucke mit zweifelhaften Text-Versionen kursierten schon überall. Auch ein Heft mit Clara Schumanns Klavierwerken (op. 10 bis op. 21) erschien möglicherweise ohne ihr Zutun. Außerdem häuften sich Anfragen nach persönlichen Dokumenten Schumanns, um sie biografisch auszuwerten. Manche aus dem Freundeskreis und der näheren Verwandtschaft, wie Marie Wieck etwa, stellten schon bereitwillig das, was sie besaßen, anderen zur Verfugung, ohne die Witwe deswegen zu fragen. Warum sollten sie? Hanslick wandte sich 1877 über Brahms an Clara Schumann mit der Bitte, die Briefe ihres Mannes aus Endenich einsehen zu dürfen. Sie reagierte »sehr erschrocken«: »Die Welt kennt Schumann noch lange nicht, wie er in gesunden Tagen war, und nun soll ich zur Schilderung seiner kranken Tage meine Einwilligung geben«, fragte sie Brahms fassungslos. »Für Arzte, von einem Arzt geschrieben kann es von wirklichem Interesse sein, für andere nur von pikantem« (Schumann-Brahms 2, S. 90ff). »Was die Schreiber aber über seine Person sagen, ist mir doch stets fast verletzend«, schrieb sie 1882 ihrem Bruder Woldemar Bargiel. Sie hätten von »seiner feinen Organisation, die ihn oft gegen die leiseste Berührung von außen empfindlich machte, gar keine Idee«, sondern stellten »seine Eigentümlichkeiten als solche hin ohne dem Grunde nachzuspüren« (in: Litzmann 3, S. 426). Es war also höchste Zeit für Clara Schumann, die Sache in die Hand zu nehmen, wollte sie die Rezeption Schumanns weiterhin in ihrem Sinne steuern. Die Voraussetzungen dafür lagen gut. Schließlich konkurrierten Autoren und Verlage nicht allein aufgrund ihrer Zeitzeugenschaft um ihre Kooperation bei künftigen Robert Schumann-Ausgaben, sondern hauptsächlich, weil sie nach wie vor den Nachlass ihres Mannes hütete. Bevor sie Gustav Jansen weiteres Material überließ, publizierte sie 1885 selbst Robert Schumanns Jugendbriefe. Niemand könne einschätzen, »welche Arbeit so etwas macht«. Selbst Clara Schumann hatte nämlich manchmal Mühe, die Handschrift ihres Mannes zu entziffern und die Kontexte zu rekonstruieren. Gerade beim Ubertragen der »Namen damaliger Professoren und Gelehrten« müsse man vorsichtig sein, »daß man sich nicht blamirt«. Wenn sie mit ihrem Latein an Ende war, half der Karlsruher Altphilologe Gustav Wendt (in: Litzmann 3, S. 469). Hanslick veröffentlichte seinen Aufsatz über Schumann in Endenich dann tatsächlich erst 1899, drei Jahre nach Clara Schumanns Tod. Mit einer seriös unternommenen Werkausgabe setzte man dem Komponisten ein bleibendes Monument. Damit waren die Stücke nicht bloß für alle Erinnerungskultur
411
Interessierten in einer autorisierten, »authentischen« Lesart öffentlich zugänglich. Vielmehr bedeutete dieser Schritt eine Aufwertung der Partituren zu nationalen Kulturdenkmälern, die als so bedeutend eingeschätzt wurden, dass man sie dem Sog des Vergessens entriss und für nachfolgende Generationen bewahrte. Aufgrund ihrer Materialität leisteten Noten- und Briefausgaben wesentlich mehr für die Verbreitung seiner Musik als Clara Schumann mit ihrem Spiel erreichen konnte. Die Robert Schumann-Ausgabe war ein auf die Zukunft gerichtetes Projekt. Und mit ihr als Herausgeberin würden ihrer beider Namen auch auf diesem Denkmal unsterblich miteinander verbunden sein, so wie schon auf den gegenseitigen Widmungsstücken. Die Idee, Denkmäler musikalischer Tonkunst zu schaffen, um die Kulturleistungen vergangener Generationen zugänglich zu machen, verfolgten schon Johann Nikolaus Forkel und Joseph von Sonnleithner Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien. Ihre Realisierung verlor sich jedoch in den Wirren der napoleonischen Kriege. Als dann Ende der 1830er Jahre die Initiativen zur Gründung einer Bach-Gesellschaft klarere Konturen annahm, standen zwei Motive besonders im Vordergrund, nämlich erstens das inzwischen patriotisch grundierte Erforschen und Bewahren von Bachs Gesamtwerk als Gründungszeugnis deutscher Musik, und zweitens die Herstellung verlässlicher Notenausgaben. Darin kündigte sich bereits eine neue Bedeutung der Philologie für die Musikdrucke an. Die schriftlich fixierte symbolische Notation erhielt - zumindest wenn sie von »großen Meistern« stammte - den Status einer quasi kanonisierten Schrift. Autographe wurden inzwischen als profane Reliquien geschätzt. Wie die Familie Mendelssohn, die sich schon seit Generationen um Autographe bemühte, um sie als kulturelles Erbe zu verwahren, so sammelten seit den 1840er Jahren auch die Schumanns Komponistenund Dichter-Handschriften. Das Wertvollste, was Clara Schumann später an repräsentativen Geschenken überreichen konnte, war ein Autograph ihres Mannes. »Ich habe viel in meinem Scripturenschranke gekramt, wollte so gern Etwas finden, das ich Ihnen als Andenken an die Tage, die durch Sie eine so hohe Weihe erhielte, und mir durch Sie doppelt festlich wurden, senden könnte«, schrieb sie Joachim nach dem Schumann-Fest 1873. »Eine der Symphonien wäre mir das liebste gewesen, leider aber habe ich keine mehr, auch nicht die Manfred-Ouvertüre, und so bleibt mir nur das Nachtlied«, vermutlich op. 108. Da längst ein schwunghafter Handel mit Musiker-Handschriften begonnen hatte, entschloss sich Clara Schumann später, »Roberts Manuscripte, so viel ich noch besitze, an die königliche Bibliothek in Berlin [zu] verkaufen«, um »so viel als möglich beisammen [...] der Nach412
Kaiserreich und Kanon
weit erhalten sehen«. Es schien ihr »das pietätvollste« zu sein, sie dorthin zu geben, »wo sie neben dem Besten aufbewahrt werden«. Das geschah (in: Litzmann 3, S. 298 und 498). Robert Schumann hatte 1839 »alle, die im Besitz von noch ungedruckten Bachianis« seien, aufgefordert, ihre Schätze zur Verfugung zu stellen und das »Nationalunternehmen« einer Bach-Gesamtausgabe zu unterstützen (GS 1, S. 402). Nachdem der englische Verleger Samuel Arnold schon Ende des 18. Jahrhunderts eine 49bändige Händel-Reihe auf den Markt geworfen und der Londoner Verlag Novello zwischen 1810 und 1840 mit verschiedenen einschlägigen Sammlungen nachgezogen hatte, brachte Breitkopf & Härtel 1851 den ersten Band einer Bach-Gesamtausgabe heraus (Berke 1995, S. lllOff"). Dokumentations-, Prestige- und Marktbedürfnisse gingen dabei Hand in Hand. Nun erhielten die Komponisten allerdings keine schlichten Werk- oder Sammelausgaben mehr, sondern man schuf imposante, vielbändige musikalische Monumente, an deren Herstellung mehrere Fachleute oft über Jahre hinweg beteiligt waren. An der Programmstrategie des Verlags Breitkopf 8c Härtel kann man ablesen, welchen Rang im allgemeinen historischen Bewusstsein die Komponisten nun bekamen und wie die musikalische Walhalla deutscher Tonkunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und nach gefüllt wurde und - was man eben dort nicht aufnahm. Der 1851 begonnenen Bach-Gesamtausgabe folgte ab 1858 eine Händel- und ab 1862 eine Beethoven-Ausgabe, parallel zu Palestrinas Werken. Ab 1874 erschien mit Mendelssohn Bartholdy bereits die erste Romantiker-Ausgabe. Vier Jahre später, 1878, folgte Chopin, dazwischen, ab 1876, Mozart. Nach langen Verhandlungen begann die Robert Schumann-Ausgabe dann 1879, eine Schubert-Ausgabe vier Jahre später, ab 1883. Im Zuge der Bach-Rezeption würdigte man nun auch Heinrich Schütz, dessen Gesamtausgabe 1885 begonnen wurde. Johann Strauß (1887), Corelli und Friedrich der Große (1888), Lasso und Sweelinck (1894), Loewe (1899), Berlioz (1900) und Schein (1901) folgten, bevor der Verlag schließlich Cornelius (1905), Liszt (1907) und Wagner (1912) ins Programm der Gesamtausgaben aufnahm. Zwischen 1926 und 1928 kam dann die erste Brahms-Gesamtausgabe dazu. Damit dürfte der bürgerliche Konzert- und Lehrkanon ziemÜch genau umschrieben sein, einschließlich des Repertoires der Silvester- und Neujahrskonzerte. Im Mai 1877 hatte der Plan einer Robert Schumann-Gesamtausgabe an Zug gewonnen, weil der Verlag Novello Clara Schumann ein attraktives Angebot für eine Edition Schumannscher Klavierstücke unterbreitet hatte, sich im Gegenzug aber »das Eigenthumsrecht meines Namens für alle Länder«
Erinnerungskultur
413
sichern wollte, da er als Gütesiegel galt. Brahms riet zu Gelassenheit. »Erwarte keine Noblesse«. Er beschleunigte dann allerdings seinerseits das Verfahren, indem er bei Breitkopf & Härtel nachhakte, warum sie nicht längst die Konkurrenz ausgestochen und sich die Rechte gesichert hätten? So kam die Ausgabe ins Rollen. »Nicht wahr, Du hilfst auch mir«? Sie verstünde »ja gar nichts von solchen Editionen«, behauptete Clara Schumann wider besseres Wissen, als hätte sie nicht schon zu Lebzeiten Schumanns Bearbeitungen seiner Werke vorgenommen und mit herausgegeben (in: Schumann-Brahms 2, S. lOOff). Auch für die Übernahme einzelner Bände der Chopin- und der Mendelssohn-Ausgabe war sie nicht zufällig als Expertin im Gespräch. Seit dem von ihr verantworteten Sammelband mit 20 Klavierstücken Domenico Scarlattis schätzte man ihre Editionsarbeit. Unerfahren war sie also nicht. Allerdings leitete sie nun ein Unternehmen mit ganz anderen Dimensionen. Für das Gesamtwerk veranschlagte man 31 Teile in 14 Bänden. Clara Schumann grauste vor dem Arbeitsaufwand, den sich stapelnden Korrekturbögen auf ihrem Flügel und dem ständigem Druck durch den Verlag. Schließlich konnte sie in der Zeit, die sie der Edition widmete, nichts anderes machen. Doch Konzertieren und Unterrichten wollten auch bewältigt sein, besonders, nachdem sie 1878 ihre Stelle an der Frankfurter Hochschule angetreten hatte. Nach wie vor reiste sie überdies nach England, wo sie inzwischen als musikalische Institution galt. »Ich habe nun angefangen, den Nachlaß Roberts copiren zu lassen«, teilte sie Emilie List 1879 mit. Es sei »recht aufregend« (in: Wendler, S. 341). Noch bevor sie den Vertrag unterschrieb, hatte sie Brahms überredet, die Redaktion der Orchester- und Ensemble-Werke zu übernehmen und ihm die Hälfte des Honorars angeboten. Obwohl sie allein als Herausgeberin genannt wurde - »Dein Name hat eben für Härtels Ausgabe Wert«, so Brahms lakonisch (Schumann-Brahms 2, S. 108) - , arbeiteten außer ihr und Brahms ein ganzer Stab von Musikkundigen daran mit, wie Joachim und Grimm, Heinrich von Herzogenberg, Philipp Spitta, Ernst Rudorff, Hermann Levi und Franz Wüllner (de Vries 1996 S. 280). Als übergeordnetes Editionsideal dürfte Clara Schumann und Brahms vorgeschwebt haben, »eine möglichst correcte, auf die Originalhandschriften und die ältesten Drucke gestützte, mit Angabe der verschiedenen Lesarten versehene Ausgabe« herzustellen, sozusagen eine frühe Urtextausgabe, wie sie Robert Schumann 1845 für Bachs Wohltemperiertes Klavier gefordert hatte (in: Reich 1991, S. 338). Indessen traten sofort Probleme auf. Gerade Schumanns frühe Klavierwerke, mit denen das Projekt starten sollte, existierten 414
Kaiserreich und K a n o n
in verschiedenen Fassungen. Welche galt? Wie sollte man eine Selbstidentität von einem einzigartigen, singulären Stück herstellen? Hier gingen die Herausgeberin und ihre Berater nach heutigen Maßstäben oft diplomatisch vor. Im Unterschied zu Brahms neigte Clara Schumann allerdings dazu, als Hauptquelle strikt die letzte von Schumann autorisierte Version gelten und die früheren Fassungen auszulassen. Darüber wurde lange und heftig gestritten. Offensichtliche Druckfehler mussten von Autoren-Korrekturen unterschieden, Varianten abgeglichen und bewertet werden. Wo noch Druckplatten verschiedener Stiche existierten, flössen auch merkantile sowie grafische Erwägungen ein, wie die Entscheidung für eine musikalisch sinnvolle und besser lesbare Aufteilung der Seite (Schumann-Brahms 2, S. 162). Gravierender waren Probleme einer Bewertung der ästhetischen und kunsthistorischen Bedeutung mancher Werke. Im Widerstreit zwischen dem Erhalt des Gesamtwerks als Lebensdokument Robert Schumanns oder der Ausgabe aller nach kunsttheoretischen Maßstäben »gültigen« Kompositionen wählte Clara Schumann die zweite Variante. In diesem Punkt vertrat sie ein »Meisterwerkkonzept«, nachdem nur das Beste tradierungswürdig sei, ganz im Einklang mit ihrer Repertoirepolitik dieser Jahre. Ihren Entscheidungen dürften mehrere Überlegungen zugrunde gelegen haben. Bei vielen Werken hatte sie miterlebt, wie sich die Kompositionsweise ihres Mannes veränderte. Bei der Revision früher Klavierwerke hatte Robert Schumann 1850 einige Exzentrizitäten geglättet und eine größere Ausgewogenheit im Tonsatz vor die Originalität der teilweise bizarreren Strukturen der Frühfassungen gesetzt. Die Klavierstücke wurden der inzwischen weiter entwickelten Kompositionsweise angepasst, und einiges, was in den 1830er Jahren als unbekümmerte »Frische« gegolten haben mochte, nun wie handwerkliche Fehler eliminiert. Insofern zeigten die späteren Fassungen einen höheren Grad an »Klassizität«. Bei manchen Werken, wie der vierten Sinfonie, dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Clara Schumann das intensive Ringen um die Entstehung der Komposition noch in guter Erinnerung hatte und deswegen die nach Jahren überarbeitete zweite Fassung allein gelten sollte. Darüber hinaus wollte sie auf gar keinen Fall »zweifelhafte« Stücke aufnehmen. Das betraf vor allem die Unsicherheit über das ästhetische Gelingen mancher später Stücke. Dabei spielte die nicht verstummende Diskussion um die musikalische Qualität von Schumanns letzten Werken eine bedeutende Rolle. Schließlich war ein »Spätwerk« mit dem Nimbus behaftet, dass hier die Summe eines Kompositionslebens ausgedrückt wäre. Gelegenheitswerke hatten da keinen Platz. Alles, was das Andenken des Komponisten auch nur im geringsten beeinträchtigen könnte, kam auf die Ausschlussliste. Erinnerungskultur
415
So vergab Clara Schumann pietätvoll die letzte Opusnummer im Werkverzeichnis für Schumanns Requiem op. 145, so als würde dieses Stück sein Vermächtnis enthalten. Doch machten sich alle Beteiligten die Entscheidung darüber nicht leicht, und sie blieben in manchen Punkten bis zuletzt uneinig. Neben Brahms zog Clara Schumann auch Joachim hinzu. Man beriet und verwarf, überlegte und zögerte, argumentierte hin und her. Am Ende schied Schumanns Violinkonzert d-Moll WoO 1 ebenso wie die Violinsonate aMoll WoO 2 von 1853/4 aus der Gesamtausgabe aus, obwohl die Künstlerin sie 1854 noch animiert und »begeistert« mehrfach mit Joachim gespielt hatte {Litzmann 2, S. 304f). Beide Stücke wurden erst im 20. Jahrhundert publiziert. Fünf Celloromanzen vernichtete die Witwe 1893 sogar, damit niemand sie nach ihrem Tod veröffentlichte. »Mir hat das sehr imponiert«, kommentierte Brahms, der selbst gern ausgiebige Autodafés veranstaltete. Abweichend von Clara Schumann verfolgte Brahms in der Schumann-Gesamtausgabe ein mehr historisch orientiertes Konzept und riet deswegen beharrlich immer wieder dazu, auch Varianten und Frühfassungen zu publizieren. Im Fall der ersten Fassung der d-Moll-Sinfonie op. 120 setzte Brahms sich nach monatelangem Disput gegen Clara Schumanns Einwände durch (in: Struck 1984, S. 291ff. und 561f). Die Instruktive Ausgabe von Robert Schumanns Klavierwerken, die Clara Schumann 1882 Breitkopf 8c Härtel vorschlug, setzte andere Präferenzen. Hier brachte sie als Herausgeberin ihren Anspruch auf eine »authentische« Interpretation gezielt zur Geltung. In die hauptsächlich fur Klavierschülerinnen und -schüler gedachte Edition flössen expliziter als in der Gesamtausgabe Clara Schumanns Auffuhrungs-, aber auch ihre jahrelangen Lehrerfahrungen ein. Mit den Instruktionen steuerte sie das Verständnis und bestimmte die Interpretationslinien für Schumanns Klavierwerke weit mehr als in der Gesamtausgabe. Womöglich wollte sie damit einer didaktischen Edition durch andere zuvorkommen, vermutet Claudia de Vries (1996, S. 282ff). So brachte von Bülow in diesen Jahren mehrere Bände mit Stücken von Bach, Beethoven und Scarlatti heraus. Gegen von Bülows Praxis polemisierte Clara Schumann heftig. »Er verunstaltet die Werke durch seine Analysierungen dermaßen, daß man sie kaum mehr erkennt«. Einerseits pochte sie auf das Recht einer verständnisvollen Gestaltungsfreiheit, die sie als Qualität einer künstlerischen Reife ansah, andererseits bekannte sie sich offen zur Zensur: »Ich habe diese Ausgaben meinen Schülern stets verboten«. Sollten Härtels die Instruktive Ausgabe nicht wollen, »so mache ich sie dennoch«. Das müsse sie, »damit wenigstens eine richtige Ausgabe für Schüler vorhanden« sei (in: Litzmann 3, S. 427 und 442). 416
Kaiserreich und Kanon
Über die private Heldenverehrung hinaus dürfte Clara Schumann bei ihren einschlägigen editorischen Entscheidungen davon überzeugt gewesen sein, dass sich die Größe bedeutender Künstler »nur durch künstlerische Gestaltung eines Monuments« und nicht »im Herumstöbern in ihrem Privatleben erfassen« ließe, wie Richard Hamann und Jost Hermand eine zeitgenössische Maxime formulierten (Hamann/Hermand 1965, S. 57). Auch Clara Schumann wollte nicht die Niederungen von Schumanns Alltag dokumentiert wissen, sondern die Sternstunden des Künstlers. In Abgrenzung zum vorherrschenden wissenschaftlichen Positivismus, mit dem unterschiedslos Lebensdokumente gesichert und dargestellt wurden, glühte in der Öffentlichkeit inzwischen ein hypertropher Personenkult. Künstler wie Wagner oder Makart bedienten nicht nur in ihrer Stoff- und Motivwahl, sondern vor allem auch in ihren theatralischen Selbstinszenierungen den Wunsch nach »Meistern«, die über gelehrige Schüler hinaus einer Gemeinde gläubiger Anhängerinnen und Anhängern Orientierung bieten würden. Man pilgerte zu ihnen und scharte sich um sie. Die mit Samtbaretts und Umhängen drapierten Künsder präsentierten sich in ihren mit Kunst und dekorativem Kitsch voll gestopften Häusern und Ateliers wie Granden einer fernen heroischen Epoche. So verkörperten sie leibhaftig eine fantasievolle Mischung aus geträumtem Spätmittelalter und gründerzeitlicher Neorenaissance und schufen um sich herum eine »historische« Atmosphäre. Minister und Staatsdiener, preußische Junker wie bürgerlicher Geldadel trafen sich auf ihren rauschenden Festen. Nachdem sich 1880 allerdings »S[eine] Heiligkeit« aus Bayreuth in Lenbachs Atelier mit der Münchener Schickeria über Bismarck gezankt hatte, hielt der Maler etwas Abstand von den »Wagnerfexen« (Sturm 2003, S. 119). Man schwelgte in Stoffen der Vergangenheit, und je nach persönlicher Uberzeugung wurden damit historische oder mythische Gestalten idealisiert, wie etwa bei Anselm Feuerbach, Hans Makart oder Arnold Böcklin die Figuren der Iphigenie, antike Musen und Allegorien, oder auch gesellschaftskritisch funktionalisiert wie die germanischen Götter in Wagners Ring des Nibelungen. Mit derartiger Kunst vertiefte man vorsätzlich die Gräben zwischen sich - den Intellektuellen der Hochkultur - und dem gemeinen Rest. »Wir sind alle in der einen oder anderen Weise in eine durch das Medium der Kunst angeschaute, stilisierte Vergangenheit verliebt. Das ist Ästhetizismus«, diagnostizierte Hugo von Hofmannsthal den Zauber am Ende des Jahrhunderts (in: Belting 1998, S. 181). Indessen nutzte auch Wagner zur Inszenierung des mythischen Fernwehs selbstverständlich die neueste elektrische Bühnentechnik, um eine möglichst perfekte Illusion vorzeitlicher Welten heraufzubeschwören (Sturm 2003, S. 119ff). Erinnerungskultur
417
Als nationales Prestigeobjekt für eine verklärte Rückwendung in die Vergangenheit wurde auch der Kölner Dom vereinnahmt. Im 19. Jahrhundert war die riesige Kathedrale noch immer eine seit Jahrhunderten brachliegende Baustelle. Der Weiterbau war 1538 eingestellt worden. Lediglich Teile des Kirchenraums wurden genutzt. Inzwischen sammelten Dombaugesellschaften für die Vollendung des Baus. Seit 1842 arbeitete man am Kölner Dom weiter. Die Schumanns waren von der pittoresken Ruine am Rheinufer ebenso beeindruckt wie Brahms. Der Dom sollte nun als »Nationalkirche« die deutsche Einheit besiegeln. Aufgrund seines gotischen Ursprungs wurde er zu einem im Mittelalter begonnenen Gemeinschaftsprojekt des deutschen Volkes umtituliert, das nun, im Kaiserreich, endlich zu einem glücklichen Ende gelangte. Der Dom wurde 1880 fertig. Ein höchst umstrittenes Symbol, in dem sich neogotische und ältere Stilelemente mischten. Vischer war nicht der einzige, der sich dagegen aussprach, aber sicher einer der vehementesten. Jeder Kreuzer, »den wir für [die] galvanische Belebung eines Kunstleichnams ausgeben, wäre besser zu Suppen für die Armen verwendet«, wetterte er. W i e käme man überhaupt dazu, für den »katholischen Kultus« eine Kirche weiter zu bauen, die dann ganz Deutschland repräsentieren sollte? Auch Semper schloß sich diesen Argumenten an, weil er nicht nur die anachronistische Ausführung, sondern den ganzen in der neostilistischen Bauerei sich ausdrückenden Historismus für einen Fehler hielt (in: Sturm 2003, S. 119f). Der Sog der imaginierten Vergangenheit war so stark, weil sich in der gegenwärtigen Gesellschaft des deutschen Reichs offenbar eine gewisse inhaltliche Leere ausbreitete. Die »Flut von Symbolen und Allegorien« sollte das »Fehlen eines inneren geistigen Bandes der Nation« überbrücken, so Hagen Schulze (2007, S. 143). Aus dem Teutoburger Wald, in dem Brahms nach dem Unterricht der Detmolder Prinzessinnen so gern wanderte, ragte nun weit sichtbar das Schwert eines Hermanndenkmals heraus. Allerdings blickte dieser mythische Kämpfer streng nach Westen, und drohte mehr dem feindlichen Frankreich als den Römern. Am Ende des Jahrhunderts schössen überall im deutschen Reich Kaiserstandbilder und Bismarcktürme in die Höhe. Dabei verstellte der ständige Blick auf die Geschichte jede Zukunftsperspektive, wie Vischer kritisierte. Die wenigen, die »das Wesendiche, das Jugendliche« wollten, mussten kapitulieren vor der »Begeisterung für das Abgestorbene« (in: Sturm 2003, S. 119). Auch Clara Schumann blieb ein Stück weit in der Rückschau auf die Vergangenheit gefangen. Allerdings interessierte sie weder die mittelalterliche Geschichte noch die Renaissance sondern vielmehr die Aufbruchsjahre des Vormärz. Daraus bezog sie ihre Kriterien für Fortschritt, nämlich »Frische« 418
Kaiserreich und Kanon
in der Erfindung, »Innigkeit« im Ausdruck und eine »gute«, anspruchsvolle Satztechnik. »Gäbe es doch mehr Neues, das ist eine rechte Entbehrung für mich«, klagte sie seit Ende der 1870er Jahre. »Ich studire so gern Neues, das regt mich so an, verjüngt mich«. Was verstand sie darunter? Aus den erhaltenen Dokumenten ist kaum zu erschließen, in welcher Weise und in welchem Ausmaß sie sich etwa mit der jüngeren Komponistengeneration, mit europäischen oder gar amerikanischen Neuerscheinungen tatsächlich auseinandersetzte. Beeindruckt war sie von Verdis Aida. Sie sah die Oper 1881 und notierte sich: »Respect hat mir die Oper für Verdi eingeflößt. Merkwürdig ist es einen Componisten noch in seinen alten Tagen einen andern Weg einschlagen zu sehen und wie viel Talent verräth er auf diesem!« (in: Litzmann 3, S. 414). Rubinstein achtete sie als Komponisten durchaus, spielte aus der von ihm bekannt gemachten russischen »Schule« (Michail Glinka, Mili Balakirew, Peter Tschaikowski, Cesar Cui, Nikolai Rimski-Korsakow, Anatoli Ljadow) aber nichts. Antonin Dvorak, den Brahms ihr empfahl, gefiel ihr nur mäßig. Auch für Bedrich Smetana erwärmte sie sich nicht. Eugène d'Albert schätzte sie als Nachwuchstalent, Camille Saint-Saëns oder Gabriel Fauré nahm sie nicht ins Programm. Ihre Schülerinnen spielten sie allerdings. Georges Bizet und auch Richard Strauss interessierten sie. »Eurer Strauss« hatte »neulich hier mit einer Symphonie ein großes Succès gehabt - er ist ein höchst begabter Mensch«, schrieb sie Emilie List 1887 nach München. Später bedauerte sie allerdings, dass er sich der »extremen Wagnerschen Richtung angeschlossen« habe, wie ihr Enkel überlieferte ( N Z f M 1917, S. 87). Was sie von Arthur Sullivans Werken hielt, die während ihrer Londoner Auftrittsjahre die dortige Musikszene prägten, ist nicht bekannt. In England nahm sie dafür verschiedene Solo- und Kammermusikwerke von Sterndale Bennett ins Programm. Musik von Edvard Grieg, Christian Sinding oder von den Komponistinnen Ethel Smyth und Agathe Grandahl, die ihre Schülerinnen gelegentlich spielten, oder ihre Frankfurter Nachbarin, der Komponistin Clementine Becker, kamen für ihr eigenes Repertoire offensichtlich nicht in Frage (in: Litzmann 3 passim; Wendler, S. 390). Engelbert Humperdinck war auch nicht ihr Fall. Was Joachim Raff, Bernhard Scholz oder James Kwast, die Kollegen aus der Hochschule, komponierten, stellte sie nicht wirklich zufrieden. Doch spielte sie Scholz' Klavierkonzert a-Moll sowie Werke von Raff auf dem Podium. Auch einzelne Stücke von Woldemar Bargiel und Ernst Rudorff führte sie auf. Den Frankfurter Studenten Hans Pfitzner nahm sie als Komponisten vermutlich gar nicht zur Kenntnis. Da dürfte nicht zuletzt ihre partielle Schwerhörigkeit eine Rolle gespielt haben, die in den letzten Lebensjahren mal schwächer, mal stärker hervortrat. »Lei-
Erinnerungskultur
419
der entgeht mir in den Piano-Stellen stets so viel, daß ich ein mir total neues Werk nicht zu verfolgen vermag, also mir auch kein Urtheil nach einem so unvollkommenen Hören bilden kann« (in: Litzmann 3, S. 486). Inwieweit sie Musik von Hugo Wolf, Gustav Mahler und Alexander von Zemlinsky, die ja immerhin von Brahms begutachtet wurden, oder gar die frühen Stücke der jüngeren französischen Komponisten wie César Franck, Claude Debussy oder Maurice Ravel mitbekam, ist nicht überliefert. Wenn sie überhaupt noch Erstaufführungen spielte, so meist Werke von Brahms, die sie in den Frankfurter Museumskonzerten und in den letzten Jahren dann nur noch privat verbreitete. Sie sei »ganz begeistert« über seine Stücke schrieb sie 1892. Sie »erhellen mein ödes musikalisches Dasein, denn nur am Klavier kann ich Musik genießen« (Schumann-Brahms 2, S. 487). Vermutlich handelte es sich um Kompositionen aus den Opera 118 und 119. Ihre einzelnen Kommentare lassen indessen auch erkennen, dass ihr selbst unter seinen Stücken nicht alles spontan zugänglich war. Während das Intermezzo es-Moll op. 118 Nr. 6 nach Erinnerung ihres Enkels zu den Lieblingsstücken der letzten Jahre zählte, enthalte das Intermezzo E-Dur op. 116 Nr. 5 »schreckliche Stellen«, die sie geändert wünschte. »Spiele es so, wie Du willst, Clara«, habe Brahms geantwortet (in: NZfM, S. 87). Nach ihrem Urteil fehlten den Stücken mitunter abrundende Reprisen, und harmonische Exzentrizitäten schätzte sie, die in ihren eigenen frühen Klavierwerken gern damit provoziert hatte, ganz und gar nicht. Wenn Clara Schumann in den letzten zwei Jahrzehnten mehr auf ihr Leben zurück blickte als nach vorn, so lag darin durchaus eine altersgemäße Perspektive. Die Jahre zwischen ihrem 50- und ihrem 60jährigen Bühnenjubiläum (1878 und 1888) waren angefüllt mit Ehrungen für ihr Lebenswerk als Künstlerin. Eine so lange »Regierungszeit« überbot nur noch der Kaiser: Wilhelm I. feierte 1887 sogar sein 80jähriges Jubiläum. »Wer nach einem Beispiel dessen sucht, was auf Preußisch >Dienst< heißt, der findet es in Kaiser Wilhelms täglichem Leben« (in: Erz und Stein, S. 17). Dieser Spruch könnte auch für Clara Schumann gelten. In der Öffentlichkeit präsentierte sie eine weibliche Variante solcher unbedingten Pflichterfüllung, wie man sie sonst nur von Queen Victoria erwartete. Inzwischen erlebte die Künstlerin ihre eigene Monumentalisierung. Neben den vielen Rezensionen ihrer Auftritte erschienen verstärkt Würdigungen und biografische Widmungsartikel. Und sie selbst las nun Biografíen über Freunde und Weggefährten, wie Otto Goldschmidts zweibändige Biografié über die 1887 verstorbene Jenny Lind. Als Reiselektüre nach England lieh sie 420
Kaiserreich und Kanon
sich im Februar 1888 von Emilie List den gerade publizierten Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt aus. Diese beiden hatte sie nun auch überlebt. Posthum erwärmte sie sich wieder für Liszts daraus hervor scheinender Noblesse, während Wagners Briefe ihre Vorurteile voll bestätigten. »Unbegreiflich ist es mir aber, daß die Frau Wagner die Veröffentlichung zugegeben hat«. In Weimar besichtigte sie 1888 mit ihren Töchtern als Touristin die inzwischen zum Museum umgewandelten Wohn- und Arbeitsräume Goethes, in denen sie den Dichter noch erlebt hatte (Wendler, S. 396; Litzmann 3, S. 508). Zum 70. Geburtstag, der 1889 ehrenvoll in Baden-Baden begangen wurde, schickte der neue Kaiser, jetzt Wilhelm II., eine Verdienstmedaille. Schon zehn Jahre vorher hatte ihr der Bayerische König für ihre Verdienste die »goldene Medaille für Kunst« verliehen (Litzmann 3, S. 302). Den ganzen Tag über kamen Glückwunschtelegramme, von der Kaiserin und von der so genannten »Kaiserin Friedrich«, Queen Victorias Tochter Vicky, die 1856 den deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm geheiratet hatte, sowie von verschiedenen Großherzogs- und Fürstenhäusern. »Die Kisten mit Blumen waren endlos«. Schon seit den 1860er Jahren häuften sich Ehrenmitgliedschaften, auch in internationalen Vereinen und Musikeinrichtungen zwischen Riga und Buenos Aires. »Ich war ganz überwältigt von all dem Wohlwollen und der Liebe«. Sie müsse Antwortkarten drucken lassen, um die Uberfülle von Glückwünschen beantworten zu können. Brahms fehlte. Er feierte eine Woche später mit ihr allein nach. »Als Künstlerin in das Greisenalter zu treten ist auch nicht leicht«, liest man im Tagebuch. »Nur eine Bitte, einen Gedanken hatte ich heute beim Schlafengehen, daß der Himmel mich der Kinder Liebe noch einige Jahre genießen lassen möchte, nicht in Siechthum, sondern mit der Genußfähigkeit, wie sie mein Herz noch hat« (in: Litzmann 3, S. 515ff.; Kat., passim). Die im Kaiserreich entstandenen Porträts von Clara Schumann bebildern ein erhabenes Image. Dass sie eine besondere Ruhe und Würde ausstrahlte, wie auf dem Londoner Künstlerfoto von 1887 (Abb. 20), lag sicher nicht am Alter der Porträtierten allein, sondern es entsprach auch einem Stil der Bildkomposition dieser Zeit. Clara Schumann wählte wie immer nur die besten Adressen, um sich porträtieren zu lassen, für die Werbung die Fotostudios Elliot & Fry, Allgeyer oder Hanfstaengl, für die Gemälde und Büsten den Maler Franz von Lenbach und den Bildhauer Adolf Hildebrand. Lenbach malte Kaiser, Fürsten, Grafen, Diplomaten, Bismarck und - Richard Wagner. Ein LenbachPorträt galt als Zeichen von Rang (Hamann/Hermand 1965, S. 186). Bei ihrer Wahl mischten sich Prestige und persönliches Kunstbekenntnis. Erinnerungskultur
421
Clara Schumanns Kunstgeschmack blieb vor allem der klassizistischen Bildsprache der Düsseldorfer Akademie verhaftet. Nach Wolfgang Leitmeyer basierten deren ästhetische Richtlinien auf drei Prämissen: einer humanistischen, am Ideal der Antike geschulten Bildung, sodann ausgewählten, darstellungswürdigen Stoffen und schließlich einer durch Naturstudien erworbenen Genauigkeit der Zeichnung. Das Ganze sollte von einem poetischen Konzept getragen werden und nicht, wie das Konkurrenzmedium Fotografie, einfach einen Moment der Wirklichkeit abbilden. Kunst sei »verwirklichte Idee«, so Schadow 1854, »fehlt die ideale Vorstellung, so verdient es nicht den Namen eines solchen, fehlt aber die naturgemäße Wirklichkeit, so bleibt es mindestens ein unvollkommenes Kunstwerk« (in: Feuerbach 2002, S. 15). Die von Clara Schumann geschätzten Künstler tradierten diesen Ansatz, wie etwa der von ihr und Brahms verehrte Anselm Feuerbach. Wenn Schumann sich dann 1878 von Franz von Lenbach malen ließ, so zeigt das nicht zuletzt auch ihre öffentliche Reputation. Schon im August 1878 fand die »merkwürdige erste Sitzung« in Lenbachs Atelier statt. Clara Schumann wunderte sich, dass der Maler nur ihr »Gesicht studieren« wollte, bevor er ans Werk ging (Litzmann 3, S. 381). W i e die Gemälde zeigen, konzentrierte sich Lenbach in der Tat hauptsächlich auf ihre Gesichtszüge. Er arbeitete mehrere Varianten heraus. Einmal fasst er den Kopf en face und betonte mehr die dynamischen Züge der knapp Sechzigjährigen, die mit freundlicher Gelassenheit die Betrachter direkt anblickt, ohne ihr Alter zu beschönigen. Ein anderer Entwurf betonte dagegen mehr ihre stolze und vornehme Haltung (Abb. 18). In beiden Varianten dominieren warme Goldund Sepiatöne, die den Bildern eine gewisse altersgemäße Patina verleihen. Da weder die Kleidung noch Schmuck vom Gesichtsausdruck ablenken und außer der Figur keine weiteren Gegenstände zu sehen sind, wirken die Bilder ehrwürdig und erhaben. Öffentliche und private Anteile der Person scheinen darauf verschmolzen. Zwei Jahre später saß sie noch einmal in Lenbachs Münchener Atelier. Möglicherweise war es eines der jetzt entstandenen Porträts, das der Kunstmäzen Conrad Fiedler erwarb. Fiedler kannte die Künstlerin schon aus Berlin. »Am hiesigen Leben ist das beste eigentlich die Musik; wir verkehren viel mit Frau Schumann, deren nähere Bekanntschaft eigentlich das einzige ist, was ich bis jetzt am Aufenthalt in Berlin lohnend gefunden habe«, schrieb er dem Bildhauer Adolf von Hildebrand nach Florenz. Im Dezember 1880 berichtete Fiedler, »ich habe meine Frau mit einer Lenbachschen Skizze von Frau Schumann überrascht«. Er hielt die mit Pastell erhöhte Zeichnung für »viel besser als seine Bilder«. Möglicherweise handelt es sich um das von Thomas 422
Kaiserreich und Kanon
Synofzik 1991 entdeckte Porträt (in: Hildebrand,
S. 247ff.; Porträts, S. 107).
Z u diesem Zeitpunkt kannten sich Clara Schumann und von Hildebrand noch nicht. Bei einem Konzert in M ü n c h e n 1884 konnte von Hildebrand zwar B r a h m s in Augenschein nehmen, Clara Schumann aber nicht. »Denke, die Schumann hat abgeschrieben, ihr A r m ist wieder lahm, das versäume ich nun doch und sehe sie wieder nicht. Sie hat mir heute geschrieben in ihrer umständlichen freundlichen Weise«, so von Hildebrand an seine Frau. D e r fast 30 Jahre jüngere Künstler musste sich erst an die alte D a m e gewöhnen, die er dann im September 1885 in Frankfurt kennen lernte. E r war bei einem Fest der Sommerhoffs, der Familie von Clara Schumanns Tochter Elise eingeladen. Sie habe »leider nur Schumann« gespielt, »was mich doch nicht sehr interessirt«, schrieb er seiner Frau. A u c h ein Konzert mit Stockhausen, der Auszüge aus Schumanns Faust-Szenen
sang, sagte ihm nicht zu.
»Ich hätte lieber Lieder gehört, als Schumannsche Sachen diesen Styls, der mir so fremd und neu ist«. D o c h dann spielte sie »mir sehr schön Sonaten von Beethoven. L e s Adieux war herrlich [...] Unsere N e i g u n g scheint gegenseitig zu sein. I m Frühjahr will sie zum M a r m o r kommen, wer weiß es aber!«. » D a ß Frau Schumann erst im Herbst k o m m t wird Ihnen ärgerlich sein wenn sie nur hübsch am L e b e n bleibt«, so Elisabet von Herzogenberg an von Hildebrand, »ich habe oft ein Angstgefühl daß die liebe Frau stirbt ehe Sie sie gemeißelt haben« (in: Hildebrand, S. 2 8 5 und 291). Solange hatte der Bildhauer nicht gewartet, sondern vielmehr gleich im September 1885 mit dem Gipsentwurf der Büste begonnen. D i e Sitzungen »griffen mich doch sehr an«, so Clara Schumann, »wenngleich ich dem Hildebrand gar zu gern zusehe; er ist so ganz vertieft in seine Arbeit« (in: Litzmann
3, S. 470). Hildebrand fertigte dann eine lebensgroße Porträtbüste
aus M a r m o r , die nicht nur ähnlich, sondern »ein geniales Kunstwerk« sei, wie Clara Schumann ihrer Tochter M a r i e versicherte (Abb. 19). Sein Entwurf im Stil einer idealisierten Neorenaissance blieb allerdings umstritten. »Was ist das für ein Papst?« entsetzte sich Joachim, als er ein Foto davon sah. D i e Frankfurter fanden, dass die Kopfbedeckung aussähe wie die »Plechhaupe eines Kriegsknechts«. Von Herzogenberg urteilte diplomatisch, der M u n d erschiene ihr als das »allergelungendste«, aber »ihre Holdseligkeit, die müssen Sie erst noch hineinzaubern, das Licht das aus den Augen auf das Gesicht strahlt das werden Sie gewiß in irgend einer Weise übersetzen«. D i e Büste wurde 1886 im Kunstverein ausgestellt und erregte allgemeines Aufsehen (in: Hildebrand, S. 291; Wendler, S. 389). D e r Bildhauer war in einem A k t von Zivilisationsflucht nach Italien gezogen. W i e Feuerbach, dem die deutsche Industriegesellschaft zu kalt und
Erinnern ngskultur
423
die germanischen Götter zu roh erschienen, suchte von Hildebrand seine Zuflucht im Süden. Er gehörte zu einer Künstlergeneration, die das Wohlwollen ihrer Mäzene hemmungslos ausnutzte in der festen Uberzeugung, dass der Wert, den sie mit ihren Kunstwerken der Gesellschaft übergaben, den privaten Anspruch auf ein luxuriöses Leben allemal rechtfertigte. Mit den Mitteln seines Mäzens Fiedler kaufte von Hildebrand im Alter von 26 Jahren nahe der Stadt Florenz eine Klosteranlage, in der er in einer idealisierten toskanischen Umgebung weitab von der Realität der Industriegesellschaft als »Meister von San Francesco« schon in jungen Jahren eine »erlesene Adorantengemeinde« um sich scharte. »Wenn man nach San Francesco kam, so war es immer, als würfe man einen Blick ins Goldene Zeitalter«, schrieb eine der vielen Kulturtouristinnen, die sein Anwesen besuchte. Auch die 70jährige Clara Schumann ließ sich 1889 von Hildebrand nach Florenz locken. Wie »empfinde ich es als eine Bereicherung meines Lebens, daß es mir vergönnt war, einen Blick zu thun in Ihre Kunststätte und Ihr schönes Familienleben. Wie ideal alles um Sie [ist] nicht nur durch die herrliche Natur, die Sie umgiebt, sondern durch die Kunst, die Sie üben« (in: Hildebrand, S. 210ff. und 323). Die an den klaren schnörkellosen Linien der italienischen Renaissance orientierte Ästhetik des bekennenden Wagner-Gegners von Hildebrand kam in der eher an gründerzeitlichem Protz orientierten Gesellschaft des deutschen Reichs zunächst nicht gut an. Erst die Bekanntschaft mit Clara Schumann, Joachim und Brahms machte ihn dann auch in Deutschland hoffähig. Hildebrand blieb der Musikszene verbunden, schuf 1898 das Brahms-Denkmal finden Schlosspark von Meiningen und ein Jahr später eine Büste Joachims für die Berliner Musikhochschule (Haas 1984, S. 137ff). Das Genre der Bildnisbüsten erlebte im deutschen Reich eine besondere Blüte. Nach Ina Gayk tragen Büsten einen anderen »öffentlichen Charakter« als gemalte Porträts, da sie gleichsam eine »Stellvertreterfunktion« der Dargestellten einnähmen (in: Max Klinger, S. 62ff). Das neue Großbürgertum stattete seine Häuser damit aus. Ahnlich den Wagners in Wahnfried, wo Besuchern gleich zwei Konterfeis der Hausbesitzer begegneten, so stand auch im Schumann-Haus in Frankfurt die Hildebrand-Büste in den Präsentierräumen. Bronze- und Gipsabgüsse davon kamen in den Handel. Neben der Hildebrand-Büste hingen »drei Bilder der Großmutter«, erinnerte sich ihr Enkel Ferdinand Schumann, nämlich »zwei von Lenbach in der Eßstube, und ein großes Ölbild von Sohn aus der Düsseldorfer Zeit, im Salon« (in: NZflW 1917, S. 95). Zur Ehrung Clara Schumanns platzierte man 1896 am Hochschen Konservatorium eine Bronzebüste der Künstlerin von Friedrich Christoph Hausmann. Meist wurden Männer durch Büsten porträtiert. Dass 424
Kaiserreich und Kanon
Clara Schumann sich so modellieren ließ, spricht für ihre außerordentliche Rolle als musikalische Autorität in der Gründerzeitgesellschaft. Hermann Levis Briefe an Clara Schumann aus dieser Zeit geben einen plastischen Eindruck ihrer Autorität wieder. So schrieb er nach ihrem Auftritt im Münchener Odeon mit Schumanns Klavierkonzert im Dezember 1881, er könne die private Freundin nicht mehr von der Künstlerin unterscheiden, »weil eben jede Aeußerung Ihres Wesens, gleichviel ob Sie Ciavier spielen oder sprechen, oder schweigend-beredt blicken, ein und derselben schönen und reichen Quelle entströmt« (in: Litzmann 3, S. 422).
Träumerei und Paradoxie Romantik-Rezeption und Heldenkonzept »Wählen Sie, was Sie wollen«. Die Gesellschaft hatte sich nach dem Essen in den Musiksaal begeben. Während die Herren aus dem Raucherkabinett herbei eilten, wiegten sich die Damen bereits »auf den Schaukelstühlen und Diwans längs der Wand«. Man hoffte auf einen Auftritt. Stattdessen überreichte ein Diener Hanslick das in Buchform gebundene Register aller spielbaren Titel eines imposanten Orchestrions. Der prominente Kritiker durfte aussuchen und tippte zuerst auf die Ouvertüre zu Aubers Fra Diavolo, »denn die kleine Trommel ist mein Liebling unter den automatischen Instrumenten; sie arbeitet immer mit so ergötzlicher Präzision«. Danach wünschte er sich die erste Arie aus Verdis La Traviata. Der Diener »eilt zu dem Instrumentalofen, heizt ihn mit einem neuen Scheit Musik, und die Arie sprüht heraus«. Die von Hanslick beschriebene großbürgerliche Salon-Szene lässt im kontrastreichen Vokabular schon seine Mischung aus Begeisterung für die technischen Möglichkeiten und gleichzeitig den Widerwillen gegen eine maschinell reproduzierte Kunst spüren. Er weilte 1886 als Gast im Landhaus von Adelina Patti. Die Traviata vor der Patti »von einem Automaten georgelt!« Wie berauschend. Wie unheimlich! Schließlich »faßte mich ein wahrer Heißhunger nach einem Stück, nur einem kleinen Stückchen lebendiger Musik«. Singen wollte die Patti in ihrer Freizeit nicht. So wühlte Hanslick »ganz krampfhaft« in ihren Noten herum und fand endlich Mozarts g-MollSinfonie KV 550. Man war angekommen in der neuen Zeit, und Mozarts Partitur rettete Hanslicks Ferientage im malerischen Swansea-Tal (Hanslick, Aus meinem Leben, S. 377f). Nach Clara Schumanns Meinung hatte er nichts verpasst. Sie hielt die »Zwirnsfaden-Stimme« der Patti, die sie in London Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
425
in Bellinis Somnámbula gehört hatte, für nicht weiter bemerkenswert, fand allerdings die Person umso attraktiver. Daher rechnete sie deren Erfolg mehr ihrer Koketterie als der großen »Geläufigkeit« der Stimme - »diese nicht mal technisch vollendet« - zu (in: Litzmann 3, S. 256). Hanslick schilderte die Patti anschaulich in ihrem prachtvollen Ambiente. Die darstellenden Künstlerinnen waren in den Gründerjahren hoffähig geworden. W i e die legendäre Burgschauspielerin Charlotte Wolter, die gleichzeitig mit Brahms 1862 von Hamburg nach Wien übersiedelt war, so hatte auch die Patti einen Grafen geheiratet. Neu war indessen, dass beide Künstlerinnen ihre atemberaubenden Karrieren als hoch geachtete Mitglieder der ehrenwerten Gesellschaft fortsetzten. Wolters Auftritt als Iphigenie, ihr tiefes Timbre und ihre Deklamationskunst zogen Brahms in Bann und inspirierten die Komposition des Parzengesangs op. 89. Ihren Luxus hatten diese Künstlerinnen durch ihre Kunst selbst verdient. Die exorbitanten Gagen bestaunte man ebenso wie die legendären Juwelen der Patti. Ihr Prunk war öffentlich. Wolter kannte man nicht nur von den opulenten Gemälden Hans Makarts, dessen Muse sie lange Zeit war. In den schon zu Lebzeiten veröffentlichten Büchern, wie der 1887 erschienenen Biografié von Moritz Ehrenfeld, wurde der Reichtum ihrer Wohnungen so farbenprächtig und detailliert geschildert, als beträte man ein Märchenschloss (in: Möhrmann 2000, S. 233ff). Auch Hanslick beschrieb den feudalen Landsitz der Patti als prachtvolles Chateau, in dessen Fluchten er sich fast verirrte. Die Diven verkörperten ein neues Selbstbewusstsein, das dem Lebensgefuhl des Bürgertums in der prosperierenden Gründerzeitgesellschaft entsprach und vom wirtschaftlichen Aufschwung wie von Technikbegeisterung getragen wurde. Sie kultivierten aber auch ein neues Verständnis von Kunst als exklusiv inszenierter Mondänität jenseits der Alltagswirklichkeit. Clara Schumann war darüber erhaben. Sie behielt ihr Understatement sowohl in der Mode als auch bei der Repräsentation von Bürgerlichkeit bei. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Industriegesellschaft rasant. Allein in Prag, Wien und Berlin verdreifachte sich die Bevölkerung innerhalb einer Generation. Die Hälfte der Einwohner bestand aus »Zugewanderten«, vor allem Landflüchtigen, aber auch aus süd- und osteuropäischen Migranten (Csàky 2006, S. 13f). Alle zog es in die großen Städte. Damit veränderte sich das Alltagsleben vollständig. Paris erhielt durch die einschneidende architektonische Neukonzeption Georges-Eugène Haussmanns das heute bekannte Aussehen. In Wien zog das Burgtheater 1874 vom Michaeler Platz in das neue repräsentative Haus am Ring um. Hier veranstal-
426
Kaiserreich und Kanon
tete der vom Intendanten Franz von Dingelstedt engagierte Makart seine bewunderten, luxuriösen Bühnenausstattungen. Und selbst Berlin prunkte mit gründerzeitlich überladenen Fassaden. Das Architekturbüro Ebe & Benda entwarf sowohl die stattlichen Bürgervillen der Familien Strousberg, Borsig und Pringsheim in der Berliner Wilhelmstrasse als auch das so genannte »Palais« des Verlegers Rudolf Mosse am Leipziger Platz (Bertz 2004, S. 85). Die »riesige«, immer noch preußisch-militärisch geprägte frische Metropole wollte »Leben, Luxus, Fröhlichkeit« ausstrahlen, alles, was Hanslick bei seinem ersten Besuch 1855 vermisst hatte. »Welche Ode in diesen langen, langen, breiten Straßen!« Selbst in den Ausflugsgärten hatte sich niemand vergnügt. Da »ruderten einige Handlungskommis langweilig auf dem Teich herum, und mehrere stumme Personen sahen ihnen fröstelnd zu« (Hanslick, Aus meinem Leben, S. 157). Clara Schumann hatte mehrfach versucht, dort heimisch zu werden. Zunächst lebte sie von 1857 bis 1863 mit Unterbrechungen in Berlin, nahe des Potsdamer Platzes, bevor sie das Haus in BadenBaden kaufte. Dann zog sie von 1873 bis 1878 wieder nach Berlin, diesmal in den Tiergarten, neben die Joachims. Trotzdem gelang ihr nicht, sich dort wohl zu fühlen (Hahn, in Kat., S. 102fF). So verzichtete sie schließlich auf eine Präsenz in der neuen Reichshauptstadt und wählte ab 1878 Frankfurt am Main als ständigen Wohnsitz. Das Leben war für die wohlhabende Bürgerschicht bequemer geworden, und nach Jahrzehnten demonstrativer Bescheidenheit zeigte man nun seinen Reichtum. Seit 1878 beleuchteten in Paris elektrische Lampen die Avenue de l'Opéra, eine Prachtstraße, die nun geradewegs auf die nach dem Brand 1875 wieder eröffnete Oper führte. Andere Metropolen zogen schnell nach. Und auch in den heimischen Salons »brauchte man nur an einem Knopf zu drücken«, um alles »mit glänzendem Licht zu erfüllen«. Die ersten mehrgeschossigen Häuser wurden mit elektrischen Aufzügen ausgestattet. Hanslick lernte den Komfort im Pariser Hotel Bellevue schätzen. In Paris testete er 1878 auch »Edisons Phonograph«. Brahms äußerte sich später enthusiastisch darüber. »Es ist wieder, als ob man ein Märchen erlebe«, schrieb er Clara Schumann (Schumann-Brahms 2, S. 397). Noch in Paris hatte Hanslick wach registriert, dass das Telefon, die neueste medientechnische Errungenschaft, die Kommunikation revolutionierte und den noch gar nicht so alten Telegrafen in den Schatten stellte. Schon in den 1860er Jahren war es üblich geworden, Kritiken gleich nach den Aufführungen an die Redaktionen zu kabeln. Nun kamen Nachrichten noch schneller um die Welt (Hanslick, Aus meinem Leben, S. 335f). Für diese »technischen Wunder« begeisterten sich auch die Schumanns. Clara Schumann dürfte in ihrem Haus in der Frankfurter MyliRomantik-Rezeption und Heldenkonzept
427
usstraße, das sie 1878 bezog, als eine der ersten ein Telefon angeschafft haben. Es erleichterte die Alltags- und Konzertorganisation enorm. Allerdings galten deutlich andere Kommunikationsformen als heute. Ein telegrammartiges Telefonat ersetzte als Blitzinformation den (höflicheren) Briefverkehr nicht. Diese Begeisterung für die Technik hatte eine Kehrseite. Im Gründerzeitkapitalismus und der um sich greifenden neuen Habgier vermisste man etwas Wesentliches, nämlich die Menschlichkeit. Anders als in der beginnenden Frühromantik, 100 Jahre zuvor, ließ sie sich aber nicht bei den herrschenden Despoten einklagen. Jetzt, im deutschen Kaiserreich, schufen sich die Besitz- und Bildungsbürger selber eine raue, materialistisch dominierte Ellenbogengesellschaft. Je stärker die deutsche Militärmacht sowie die herrschende Finanz- und Wirtschaftswelt prosperierte und expandierte, desto mehr wuchs der Wunsch nach der »anderen Seite« des Lebens, nach Liebe, Schönheit, Ethos und »Idealität«. Im Rückblick von 1926 beschrieb Friedrich Lienhard die Zeit aus kulturhistorischer Perspektive als »eisernes Jahrhundert«. Eisen, das war der universelle Baustoff der Gründerzeit: Ein »Netz von Eisenbahnschienen und Telegrafendrähten umspannt den Leib der Erde; Maschinen rauchen, Großstädte schwellen an, Massen werden in Bewegung gesetzt. Industrie, Technik, exakte Wissenschaft, soziale Fürsorge leisten Erstaunliches. Es ist das Zeitalter der Massen und Methoden, der Apparate und des Mechanismus« (in: Parr 1992, S. 183). Dieser Eisenrausch schlug sich auch in der Rede vom »eisernen Kanzler« Bismarck nieder, dem es gelungen sei, die Deutschen zu einen. Er repräsentierte die sogenannte realpolitische Seite. Nach Lienhards Modell wurzelte die »andere« Seite dagegen in einer historisch früheren Epoche, nämlich in den Generationen idealistischer »Dichter und Denker«, die den deutschen Einheitsgedanken so beredt besungen und tradiert hatten. Dazwischen hätte Deutschland im »Michelschlaf« gelegen, wie eine polemische Redewendung des 19. Jahrhunderts lautete (in: Parr 1992, S. 61). Die Allegorie sollte im deutschen Reich die Erinnerung an das Potential der bürgerlichen Revolutionen von 1830 und 1848 marginalisieren und die politischen Aktivitäten der Arbeiterschaft ausblenden. So konnte eine direkte Verbindung zwischen den klassisch-idealistischen Dichtern und Denkern um 1800 und dem 1871 gegründeten deutschen Reich konstruiert werden. Das gründerzeitliche Bürgertum verstand sich selbst als »Zivilgesellschaft«, in Abgrenzung von den »Staatsgeschäften«, wie Rolf Parr am Beispiel zeitgenössischer Bismarck-Mythen herausgearbeitet hat (Parr 1992, S. 87ff). Damit korrespondierten die fantastischen Inszenierungen großbürgerlicher Porträts. Man ließ sich als privilegierte Privatpersonen zu Hause im Kreis der 428
Kaiserreich und Kanon
Familie malen, im Salon, auf der Veranda oder im Garten hinter dem Haus gruppiert, in herausgeputzten Freizeit- oder Fantasiegewändern, spielend, lesend, feiernd, mit Kelchen und Blumen in den Händen. Der Historienmaler Anton von Werner verewigte die Pringsheims 1879 sogar in Kostümen der italienischen Renaissance (in: Bertz 2004, S. 85f). Nichts wies in diesen Porträts auf die merkantile, berufliche Seite der betuchten Familien hin, obwohl ihre gründerzeitlichen Salons semiöffentliche Foren bereit stellten, auf denen Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen kamen. Das »Zivile« bildete ein Gegengewicht zu der zupackenden wirtschaftlich und militärisch ausgerichteten »Realpolitik«. Wie sich die Intellektuellen dazu verhalten sollten, war umstritten. Innerhalb der »Zivilgesellschaft« behaupteten die Vertreter der Naturwissenschaften jetzt einen Führungsanspruch im geistes- und kunstgeschichtlich orientierten Humanismus. Hermann von Helmholtz hielt zahlreiche Vorträge zur Popularisierung der Naturwissenschaften, mit denen »die Mehrzahl der Gebildeten [...] fast gar nicht in Berührung gekommen« wäre (in: M . Rieger 2006, S. 30f). Die Kunstschaffenden waren im Hinblick auf den öffentlichen Diskurs nach wie vor gespalten. Anders als Richard Wagner plädierten im Kaiserreich viele für die Teilung der öffentlichen Sphären und pochten wie Theodor Fontane 1871 auf die qualitative Differenz zwischen Kultur und Politik. »Es dürfen die Ideale nicht aufgegeben werden«, so der Dichter, »es muß eine Stelle da sein, wo man das befreiende, das erhebende Wort zu hören vermag«. Daraus entwickelte Fontane auch ästhetische Forderungen. Romane sollten so lebensnah geschrieben sein, dass »wir in den Stunden, die wir einem Buche widmen, das Gefühl haben, unser wirkliches Leben fortzusetzen«. Der Unterschied zwischen Erlebtem und Erdichtetem sollte sich in dem Ausmaß »jener Gefühlsintensität« zeigen, »die die verklärende Aufgabe der Kunst« sei (in: Becker 2003, S. 9f. und 36). Clara Schumann ging sogar dieser Realismus noch zu weit. Im zeitgenössischen Bismarck-Diskurs brachte der so beschworene Antagonismus zwischen Kultur und Politik eigenartige literarische Blüten hervor. So spaltete man in den Erzählungen die Reichsspitze, Kaiser und Kanzler, nach diesem Muster auf und ordnete den Kaiser der kulturellen Seite zu, während Bismarck für die Politik stand. Dass nun ausgerechnet Wilhelm I. die zivile Seite repräsentieren sollte, bedurfte angesichts seiner ausschließlich soldatischen Ausbildung und militärischen Orientierung einer gezielten öffentlichen Umdeutung der Person. Im März 1849 hatte er sich den einschlägigen Spitznamen »Kartätschenprinz« eingehandelt und der Hof expedierte ihn nach seinem rücksichtslosen militärischen Eingreifen in die Demonstrationen auf dem Berliner Schlossplatz vorsichtshalber ins Londoner Exil. Dort
Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
429
befanden sich bereits die gechassten europäischen Staatsoberhäupter Napoleon III. und Fürst Metternich, weshalb der Vatikan besorgt einen Beobachter aussandte, eine Situation, die wiederum die zeitgenössischen Karikaturisten beflügelte (Erz und Stein, S. 23). In den Bismarck-Inszenierungen vertrat der Kaiser dagegen den Mythos deutscher Kultur und Geschichte, während der »eiserne« Kanzler die Gegenwart verkörperte. Im Klartext bedeutete die Konstellation, dass Geistesgeschichte und Kunst weder durch den Kanzler, noch durch den militärbegeisterten Kaiser vertreten wurden. Die ideologisch hoch gelobte Tradition der »Dichter und Denker« spielte im realpolitischen Leben keine nennenswerte Rolle. Stattdessen förderte man in der Reichshauptstadt Berlin die Entwicklung von Technik und Naturwissenschaften. Vor diesem Hintergrund erhielt die jetzt in Deutschland erfolgende Rezeption der musikalischen Romantik ihre Konturen. Im Rückblick der Gründerzeit verklärten sich die 1830er und 40er Jahre zur Idylle mit sentimentalen Zügen, deren Sphäre die Töne von Chopin, Mendelssohn und Schumann versüßten. Sie wurde von den nostalgischen Erinnerungen der noch lebenden Zeitzeugen verstärkt. Auch eine einschlägige, auf eine innige Alt-Wiener Geselligkeit fokussierte Schubert-Rezeption kam jetzt in Schwung. Chopin, dessen Musik Rellstab in den 1830er Jahren aufgrund ihrer allzu modernen Töne für ungenießbar gehalten hatte, galt inzwischen als »Salonkomponist«. Dabei stand »Salon« für einen der sentimentalen Unterhaltung dienenden Ort und nicht mehr für ein geistig anregendes Forum intellektuellen Austauschs. Anders als im Vormärz, als die »romantischen« Künstler als Neuerer die Barrikaden gestürmt hatten, suchte das gründerzeitliche Publikum die von Blumen umgebenen Träumer. Gleichwohl pochte Clara Schumann unerbittlich darauf, dass Chopin nicht sentimental zu spielen sei, sondern exakt und mit Verstand. »Mir fällt immer bei dem Namen Lind der ganze Duft der MendelssohnSchumannschen Blüthezeit in Leipzig ein«, gestand Joachim {Joachim 2, S. 377). Clara Schumann ging es ähnlich. Nach einem privaten Vortragsabend mit Liedern beider Komponisten, den Jenny Lind 1871 gab, notierte sie sich: »Wie durchlebte ich in den Augenblicken ganz die alten wonnigen Gefühle, die ich hatte, als ich [die Lieder] die ersten male hörte!« Zwar sei Linds Stimme »fast fort«, doch empfand Clara Schumann noch das »etwas verschleierte Timbre«, mit dem sie die unbestimmte romantische Sehnsucht ausdrückte, und einen »Liebreiz, eine Innerlichkeit, die unbeschreiblich« seien (in: Litzmann 3, S. 254). Längst hatte eine Mystifizierung ihres Mannes als romantischer Träumer begonnen. Inzwischen hing an dem Haus in der Reitbahngasse, in dem die Schumanns in Dresden gelebt hatten, sogar
430
Kaiserreich und Kanon
eine Gedenktafel. Clara Schumann erwähnte das Ereignis 1871 in einem Brief an Brahms deshalb, weil darauf offenbar die altertümliche Wendung stand, dass Schumann dort »heimste« (Schumann-Brahms 1, S. 646). Robert Schumanns Musik hatte sich durchgesetzt. Das zeigt allein die Aufführungsstatistik Dörffels für das Leipziger Gewandhaus bis 1880 (Dörffel 1980,1, S. 65ff). Selbst wenn nicht alle Werke unumstritten blieben - nicht zuletzt aufgrund ihrer nach wie vor großen technischen Anforderungen - , so setzte doch neben der allgemeinen Ausbreitung seiner Musik im Konzertsaal auch eine fruchtbare Auseinandersetzung mit seinen Kompositionen ein, wie Heinz von Loesch am Beispiel des Konzerts für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 nachgezeichnet hat. Dessen »Inititalzündung« wirkte vor allem in den 1870er Jahren auf Komponierende wie Tschaikowski, Dvorak oder Grieg (Loesch 1998, S. 56ff). Ausgewählte Klavierwerke Schumanns verbreiteten sich nicht bloß in den Konzertsälen und an Hochschulen, sondern sie gehörten nun zum Repertoire häuslichen Musizierens, allen voran das Album für die Jugend op. 68. Und man suchte die Idylle wie in Schumanns Kinderszenen op. 15, dessen siebtes Stück »Träumerei« heißt. Die Träumerei op. 15 Nr. 7 verlor schon im Laufe des 19. Jahrhunderts offenbar beträchtlich an Dynamik, wenn man die in den verschiedenen Ausgaben wiedergegebenen Metronomzahlen als Richtwerte zugrunde legt. Ihr Entschleunigungsprozess setzte sich im 20. Jahrhundert dramatisch fort, so dass die Diskussion über das richtige Vortragstempo der Träumerei tatsächlich bis heute anhält. 150 Jahre nach der Entstehung erschien und erscheint das Tempo der Erstausgabe von 1839 so ungewohnt, dass man eine Zeit lang ernsthaft einen technischen Defekt von Schumanns Metronom annahm. Dieses Gerücht setzte offenbar Clara Schumann selbst mit einer Notiz in der Berliner Musikzeitung 1855 in die Welt, nachdem sie bemerkt hatte, wie unterschiedlich ihre Metronome tickten. Daraufhin begann sie, die Metronomzahlen mit einer »Sekundenuhr« nachzumessen, gab aber den Versuch bald auf. »Wer die Sachen versteht, wird sie richtig nehmen, und an denen, die sie nicht verstehen, liegt nicht viel« (Reich 1991, S. 338; Schumann-Brahms 2, S. 142f). Die im Erstdruck von 1839 angegebene Grundpuls, nämlich ein Viertel gleich 100 Schläge pro Minute, wurde von Clara Schumann knapp 50 Jahre später (1887) auf 80 Schläge herab gesetzt. Beide Zeitangaben bewegten sich noch im Andante-Bcteich. Clara Schumanns Schülerin Fanny Davies, von der eine Einspielung erhalten ist, nahm 1929 etwa ein Tempo von 76 Schlägen. Adelina de Lara, eine weitere Clara Schumann-Schülerin, spielte das Stück in einer Aufnahme von 1951 noch etwas langsamer, nämlich mit etwa 66 Schlägen. Inzwischen scheint die »Träumerei« gleichsam in den Tiefschlaf Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
431
eines Adagios oder gar Lentos gesunken zu sein, so dass nach heutigen Gepflogenheiten schon Clara Schumanns Reduktion des Grundtempos von 100 auf 80 Schläge pro Minute »eilig und harmlos« wirkt, so Alfred Brendel (in: Struck 2002, S. 721). Clara Schumanns Angabe spiegelte vermutlich ihre eigene Auffiihrungspraxis in den 1860er Jahren wider. Sie hat die Geschwindigkeit sicherlich dem Zeitempfinden des späten 19. Jahrhunderts angeglichen. Ihre Tempowahl schien gut zu der insgesamt zu beobachtenden größeren Breite und Behäbigkeit des Bürgerlebens zu passen, wie sie sich etwa an den Interieurs mit ihren ausladenden Fauteuils, den nun wuchtig gedrechselten Flügel- und Tischbeinen oder der üppigen Auskleidung der Wohnräume mit Teppichen und schweren Vorhangstoffen ablesen lässt. Entschleunigung bildete in diesem Lebenskontext eine positive Kategorie und passte zum bürgerlichen Lebensgefuhl der Zeit, nämlich bodenständig und sesshaft zu sein. Doch zeigt selbst ihr abgebremstes Tempo, dass sich die Vorstellung vom romantischen Träumen, die sich an Schumanns Stück exemplifizieren ließ, bei aller GründerzeitNostalgie noch deutlich von unserem heutigen Empfinden unterschied. Träumen enthält Komponenten, die konträr ausgelegt werden können, nämlich einmal positiv als visionär und zum anderen negativ als taumelnden Rausch- oder Trancezustand. Im zeitgenössischen Diskurs standen dafür unter anderem Nietzsches Begriffe apollinisch und dionysisch aus dessen Schrift Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik von 1871 (Macho 2007, S. 322ff). Träumer bewegen sich zwischen realer und imaginärer Welt und schweben frei über den Dingen. Im frühromantischen Konzept von Novalis und Schlegel war das Schweben positiv konnotiert. Man hatte es zur metaphorischen Darstellung des Absoluten eingeführt. Es bildete ein übergeordnetes Drittes über der Vernunft auf der einen und der Spekulation auf der anderen Seite. Der Kern bestand in dem Wechselspiel von »Suchen und nie ganz finden können«, so Friedrich Schlegel, beziehungsweise zwischen »dem Handeln und finden, daß durch kein Handeln das erreicht wird, was wir suchen«, so Novalis, weil das Absolute nur negativ erkannt werden könnte (in: Loock 2007, S. 363). Daraus speisten sich die unendliche Poesie und ihre dominierende literarische Figur, die Ironie. Einen Widerhall des frühromantischen Konzepts spiegelten noch die schwebenden rhythmisch-metrischen Setzungen in den Partituren der jetzt als »Romantiker« geltenden komponierenden Neuerer der 1830er Jahre wie Chopin, Schumann oder Clara Wieck. Aus dieser Perspektive rückte die Träumerei op. 15 Nr. 7 im zügigeren Tempo der Erstausgabe weg vom sentimentalen Seufzen in das Licht eines poetischen Tagtraums. Verkitschen wollte Clara Schumann die Musik ih432
Kaiserreich und Kanon
res Mannes nicht. Der Traum erlaubte als Schweben zwischen Wachen und Schlafen Ausflüge ins Land der Fantasie. Daraus flössen die Erzählungen Von fremden Ländern und Menschen, wie das erste Stück der Kinderszenen (op. 15 Nr. 1) heißt. Statt eines kompensatorischen Wegdämmerns aus dem Alltag böte Schumanns Träumerei die visionäre Utopie einer Idealität, und die war beschwingt, aber nicht »atemlos«. Die Auswertung der Tondokumente der Schülerinnen und Schüler zeigt, dass auch bei anderen Stücken die Tempi teils erheblich langsamer genommen wurden als in der Schumann-Ausgabe vorgesehen. So hielt bei der Romanze fls-Moll op. 28 Nr. 2 keiner das vorgezeichnete Tempo 100, vielmehr reduzierte Ilona Eibenschütz die Schläge auf Tempo 88, Adelina de Lara spielte in Tempo 84 und Carl Friedberg wählte Tempo 66. Dabei spielen für die »gefühlte« Geschwindigkeit nicht allein die abstrakten Messwerte, sondern auch Kategorien wie Dynamik, Agogik und Phrasierung eine wichtige Rolle (Struck 2002, S. 729ff.; de Vries 1996, S. 272ff). Man darf ohne weiteres davon ausgehen, dass Clara Schumann in den 1880er Jahren des 19. Jahrhunderts einen positiv bewerteten, visionären Träumerei-Entwurf tradierte. Der Ansatz unterschied sich einerseits von einem Träumer, der, wie in Gustav Mahlers Musik, einer auf immer verlorenen mythischen Märchenzeit nachtrauert, aber auch von einem »Fantasten« mit Realitätsverlust. Selbst wenn die Künstlerin ihre eigenen Brautjahre nostalgisch überzuckerte, so blieb sie doch eine Zeugin des Vormärz. Ihr immer wieder begeistert beschriebenes dynamisches Spiel dürfte noch bei gedrosseltem Tempo viel von der duftigen Poetik des Schwebenden vermittelt haben, die in den 1830er Jahren den kritischen Zündstoff von Schumanns Ästhetik ausmachte. Wie bei der Interpretation von Chopins Musik so bestand die Künstlerin auch bei den Schumannschen Stücken auf Detailgenauigkeit. Nur wenn sie rhythmisch vollkommen präzis und ohne sentimentale Verzögerung gespielt wurden, konnten sie etwas von Schumanns spezifischem Ausdruck zum Schwingen bringen, wie de Vries beim Interpretationsvergleich der Schülereinspielungen erläutert. Ubereinstimmend berichten die Schülerinnen, dass Clara Schumann Sentimentalität vermeiden wollte. Den Mittelteil der Romanze op. 28 Nr. 1 »hat sich mein Mann energischer vorgestellt, nicht so zart«, hielt sie Mathilde Wendt an. »Clara Schumann was rigorously exacting«, bestätigte auch de Lara ( N Z f M 1 9 1 9 , S. 233; de Vries 1996, S. 258). Dass die »Tonkünstlerin« »nichts mehr und nicht anderes geben will, als was der Componist vorschrieb«, hatte Hanslick als »den eigentlichen goldenen Boden ihres Spiels« charakterisiert. Darin lag ihre »Pietät« (Hanslick, Sämtliche Schriften I, 4, S. 376). Jetzt, im letzten Drittel des Jahrhunderts, dürfte Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
433
ihr Konzept der Träumerei außerdem dazu gedient haben, ihren Mann als idealistischen Helden zu präsentierten. Neben dem gravierenden Motiv, die Geisteskrankheit Schumanns in ein positives Gesamtbild zu integrieren, kam noch ein weiteres hinzu. Es galt, den Träumer von schwärmerischen spiritistischen Bewegungen abzugrenzen (Macho 2007, S. 327; Brachmann 2003, S. 126ff). Melancholie klang milder als Wahnsinn. Der euphemistische Ausdruck für Schumanns Krankheit diente nicht allein zur Beruhigung, sondern auch zum Selbstschutz der Angehörigen, wie Bernhard Appel ausgeführt hat, und er rettete die Reputation des Betroffenen. Melancholie mit Wahn galt traditionell als eine tragische Disposition von Dichtern und Denkern. Sie wurde bei der Wertschätzung Schumanns mit zeitgenössischen Erklärungsmodellen verknüpft, nämlich einmal mit der neuen physiologischen Vorstellung, dass dem Menschen nur ein bestimmtes M a ß an Kraft zur Verfügung stehe und der Künstler seines vorzeitig ausgeschöpft habe, und zum zweiten mit der Aufwertung von Fleiß als bürgerlicher Tugend. Roberts Neigung zu Verstimmungen und Reizbarkeit hatte Clara Schumann schon in den 1840er Jahren auf übermäßiges Arbeiten zurückgeführt (Litzmann 2, S. 126f). Ganz in diesem Sinne beschrieb auch Richarz jetzt seinen prominenten Patienten. Der Raubbau an den eigenen Ressourcen, die Selbstausbeutung im Dienst der Kunst, das alles adelte den Komponisten posthum und machte ihn zum tragisch gestürzten Helden, zum »Märtyrer des Schönen«. Richarz verbreitete 1873 rückblickend die Ansicht, es hätte Schumanns Zustand kein angeborener psychophysischer Defekt zugrunde gelegen, sondern die »allen Heilbemühungen trotzende Krankheit« sei vielmehr durch »ungemessenes, geistiges, zumal künstlerisches Produciren« hervorgerufen worden (in: Endenich, S. 437ff). Ob er den Aufsatz von Richarz gelesen habe, fragte Clara Schumann Brahms. Sie fühle »darin eine Wärme und Zartheit, die ich Richarz nie zugetraut hätte« (in: Schumann-Brahms 2, S. 24). Angesichts der naturwissenschaftlich fundierten Anthropologie des 19. Jahrhundert spielte die Verklärung von Schumanns Ende als Verdüsterung eines Genies bei der Rezeption eine wichtige Rolle. Mit der von den Schumann-Freunden vorgenommenen rhetorischen Verlagerung des Akzents auf Melancholie hatte schon in den 1850er Jahren ein Verfahren der Umdeutung eingesetzt, und es wurde besonders wirkungsvoll von Eduard Bendemann ins Bildmedium übertragen, wie Appel nachgezeichnet hat (Endenich, S. 19f). Bendemann porträtierte den Komponisten 1859 posthum. »Eine wunderschöne Zeichnung vom Robert nach 434
Kaiserreich und Kanon
dem Daguerotyp hat er mir gemacht, jetzt macht er das Meinige als Seitenstück«, so Clara Schumann (in: Porträts, S. 70fF). Als Vorlage diente ihm eines der raren Schumann-Fotos von Völlner, ein Kniestück, das 1850 aufgenommen worden war und den Komponisten mit aufgestütztem Kopf zeigt. Bendemann übernahm diese klassisch melancholische Geste, verstärkte aber den träumerischen Gesichtsausdruck des Porträtierten. Zwischen Foto und Zeichnung lag ein ästhetischer Rangunterschied. An Fotos lobte man zwar die »dokumentarische Treue«, doch zählten sie nach Kalbeck generell nicht zu den Porträts. Sie seien »Augenblicksstudien«, »Notbehelf[e], ein Surrogat. Die Sonne bringt das Entscheidende nicht an den Tag« (IV, S. 425f). Während das Foto mechanisch einen Moment der optischen Wahrnehmung festhielt, zeichnete Bendemann ein imaginäres Porträt, in das über die Vorlage hinaus seine eigene Wahrnehmung und Erinnerung an den Komponisten einfloss. Im »Seitenstück« charakterisierte er Clara Schumann mit einem bereits verklärten Ausdruck. Genau darin lag nach zeitgenössischer Vorstellung der Unterschied zwischen realistischer und idealistischer Kunst. Und um den ging es der Künstlerin. Als sie im August 1880 für eine Auswahl von Schumanns zur Veröffentlichung freizugebenden Jugendbriefe wieder einmal in die Vergangenheit eintauchte und eine Art inneren Dialog mit dem Verstorbenen aufnahm, notierte sie sich: »Ich lese jetzt täglich in unserer Correspondenz, was mich so unsäglich traurig macht«. Denn »ich fühle, indem ich die Briefe lese, mein Herz wieder hoch aufschlagen in heißer Liebe zu ihm, dem edelsten, herrlichsten der Menschen« (in: Litxmann 3, S. 412). Genau dieses Bild sollte tradiert werden. Im Rückblick wurden die schrecklichen Erfahrungen in den Hintergrund gerückt, und sie sollten verblassen zugunsten des Bildes vom poetisch-visionären Träumer. Robert Schumanns Andenken wurde in das Konzept eines positiven idealistischen Helden eingepasst, wie ihn die Künste mit ihren Stoffen aus Mythen und Sagen lieferten. Im nationalen Diskurs des 19. Jahrhunderts fielen die positiv bewerten Eigenschaften mit dem zusammen, was als spezifisch deutsch galt. Folgt man Jürgen Link und Wulf Wülfing, so handelte es sich zunächst um »rein diskursive Strukturen«, die dann auf die Realität übertragen wurden (Link/Wülfing 1991, S. 8). Das heißt, das Bild eines titanisch ringenden Beethoven, das schon Ende der 1820er Jahre kursierte, wurde nicht unmittelbar aus den tatsächlich überlieferten Charakterzügen seiner Person abgeleitet, sondern es beruhte auf einer literarischen Fiktion, die in Abgrenzung etwa zum kulanten Schnellkomponisten Rossini konzipiert wurde, um dann nach eben diesen Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
435
als wünschenswert heraus präparierten Eigenschaft in Beethovens Biografie und Werk zu suchen. Damit war bereits eine Wertung getroffen. Dass beide Komponisten tatsächlich im nationalen Ringen um ästhetische Unterscheidungskriterien von »Kunst und Nicht-Kunst« in diesem Sinne funktionalisiert wurden, hat Bernd Sponheuer freigelegt (1987). In einer Mischung aus historischer Forschung über germanische Frühund Sprachgeschichte, fantasievoller Fiktion wie in der Nibelungen- oder Arwmi«i-Literatur und zeitgenössischer Anthropologie gewann man eine Aufstellung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften, die einen positiven deutschen Helden kennzeichnen sollten. Das Konzept beruhte auf der Vorstellung, dass »jedes Volk [...] nur je eine eigene Kultur entwickeln« könne, so Michael Titzmann. Zwar entstanden im Lauf der Zeit durchaus unterschiedliche Kataloge. Doch blieben manche Positionen auch konstant, wie »redlich, bieder, jedem Zwang trotzend, wortkarg, mild, gutmütig« sowie »tapfer« (für Männer) und »keusch« (für Frauen). Merkmale wie »Treue«, »Tiefe« oder »Gemüt« hatten sogar schon eine lange kulturgeschichtliche Tradition im Diskurs um das Deutsche (Titzmann 1991, S. 120ff). Legt man nun das von Titzmann aus diesen Vorgaben herausgearbeitete Schema eines in zwei Facetten entfalteten »hellen« und »dunklen« Helden an (S. 134ff), so lassen sich die dort zugeordneten Eigenschaften (»optimistisch, hoffnungsvoll, rücksichtslos, jung« auf der einen, »intelligent, tragisch, bleich, männlich« auf der anderen Seite) mühelos in der zeitgenössischen Robert Schumann-Biografik, einschließlich der von Schumann selbst auf sich und seine Mitstreiter verwendeten Darstellungen wieder finden. Danach wandelte sich der optimistische Jüngling, der hoffnungsvoll und rücksichtslos gegen das Alte aufbrach und die Rolle eines Befreiers (von den »Philistern«) übernahm, also der helle, zum tragischen, melancholischen, dunklen »Märtyrer des Schönen«. Gleichzeitig beeinflusste er als eine Führerfigur die nachwachsende Komponistengeneration, der er, exemplifiziert an Brahms, »neue Bahnen« zuwies. Dies könnte so ungefähr Clara Schumanns Wunschbild entsprochen haben. Doch hat die Sache noch einen anderen Clou: Zieht man nämlich die aus literarischen Mythen abstrahierten personalen Werte der Heroen heran wie illusionslose Erkenntnis der Realität, Konstanz von Person und Handeln, Einheit von Image und Person, die Fähigkeit, Katastrophen zu ertragen, Affektbeherrschung und persönliche Autonomie (Titzmann 1991, S. 141ff), so zeigt sich, dass am Ende nicht Robert, sondern - nach zeitgenössischen Kriterien - Clara Schumann die wahre positive Heldin verkörperte. »Frau Schumann[s] eigenthümliche Mischung von echt männlichem Ernst und geistiger Schärfe«, gepaart »mit weiblicher Innigkeit 436
Kaiserreich und Kanon
und Liebenswürdigkeit«, die ein Breslauer Kritiker 1877 in ihrem Klaviertrio op. 17 widergespiegelt sah (in: Kat., S. 316), entsprach nämlich durchaus dem neuen Ideal des deutschen Reichs. Danach gehörten zwei Seelen zum deutschen Heldenkonstrukt. Fokussiert auf Bismarck etwa: »Heldenkraft und Kindersinn«, »Willensmacht und Gemüthstiefe« wie es in der zeitgenössischen Literatur hieß. Den »eisernen« Politiker Bismarck komplementierte der treu sorgende Familienvater, ein Mann mit Herz und Naturliebe, bodenständig und erdverbunden. Die Verschränkung konträrer Eigenschaften bot ein variables Instrument, um komplexe Charaktere zu bezeichnen. Der Mischung lagen nicht zuletzt politische Motive zugrunde. Schließlich sollte der Reichskanzler den Antagonismus von realpolitischer Räson und idealistischem Gefühl, von politisch-militärischer und philosophisch-künstlerischer Tradition in sich vereinen und damit eine reiche Auswahl an Identifikationsmöglichkeiten bieten (in: Parr 1992, S. 91 und 115). Bemerkenswert an diesem Heldenkonzept der Reichsgründung erscheint, dass sonst weiblich und männlich konnotierte Zuschreibungen in einer (männlichen) Person verschränkt wurden. Im Vergleich der beiden prominentesten Dioskuren im nationalen Diskurs, nämlich Goethe und Bismarck, den der Politiker Senfft von Pilsach zog, repräsentierte Goethe das »Reich des Geistes«. Ihm wurde die thermische Metapher »kalt« und die (Mädchen-) Farbe »himmelblau« zugeordnet, während der Autor den Reichskanzler als Urgewalt mit aktiv speiendem Feuer charakterisierte: »Goethe, ein schneeiger Gipfel im blauen Firmament, Bismarck, [...] ein tätiger Vulkan« (in: Parr 1992, S. 102). In diesen neuen Zuordnungen steckte ein Paradigmenwechsel. Bislang hatte Kultur in der Tradition der idealistischen Ästhetik die menschliche und damit eine von positiven Werten besetzte warme, auch weibliche Sphäre vertreten, während Kälte zwar prestigeträchtig für den als männlich geltenden Verstand, den sprichwörtlichen kühlen Kopf, und die Errungenschaften von Technik, aber auch für leblose Maschinen stand. Nach der jetzt herrschenden medizinisch-biologischen Forschung und den daraus abgeleiteten Sexualitätstheorien verknüpfte man das Weibliche mit Passivität und Kälte und stufte es in Anlehnung an Darwins Entwicklungstheorie herunter, während der nun bloß Männern vorbehaltene »Zeugungstrieb« (Möbius) als Zeichen von Tatkraft, Energie, Leidenschaft, Wärme, Leben und Kreativität galt. Die Kreuzung der Metaphern und ihre semantische Vertauschung spiegelten diese neuen Kategorien wider. Obwohl die aus Kunst und Politik verschränkten Titel »Dichterfürst« für Goethe und »Staatskünstler« für Bismarck (Parr 1992, S. 131) eine Gleichrangigkeit suggerieren, vermittelte der Vergleich Romantik-Rezeption und Heldenkonzept
437
zwischen Gletscher und Vulkan eine implizite Abwertung der Kunst- und Geistestradition gegenüber dem Bismarckschen »Blut und Eisen«. Frauen spielten in derartigen Diskursen eine untergeordnete Rolle, mit wenigen Ausnahmen wie der Königin Louise von Preußen. Nicht erst die Zentenarfeiern 1876 brachten sie in Erinnerung. Sie war schon während des ganzen Jahrhunderts sowohl literarisch als auch institutionell durch die in ihrem Namen gestifteten Orden sowie die Luisen-Stiftung, einer Einrichtung zur Mädchenerziehung, in der Öffentlichkeit präsent. Nach der Reichsgründung schwoll die Zahl der ihr gewidmeten Publikationen merklich an. Sie erhielt in den Gründungsmythen des deutschen Reichs nicht nur eine neue Rolle, ihre Geschichte ließ sich auch politisch im Sinne Bismarckscher Interessen nutzen. Dafür zog man zwischen den Befreiungskriegen und dem deutschfranzösischen Krieg eine Linie. Die Königin hatte 1807 Napoleon getroffen, allerdings ohne etwas auszurichten. Obwohl sie mit ihren Forderungen scheiterte, trat sie damals doch als politisch eingreifende Herrscherin auf, die, mit Herz und Krone bewehrt, stellvertretend für ihren Mann handelte. Sie erschien als positive Heldin, die über weiblich und männlich konnotierte Anteile verfugte. Daraus konnte eine Anknüpfung zum »Heldenmut und Kindersinn« Bismarcks konstruiert und zwei ursprünglich getrennte Mythen zusammen gefuhrt werden. Luise, nun orthografisch eingedeutscht, mutierte nicht bloß zur »Siegerin« des Kriegs von 1870/71, vielmehr verkörperte sie, die leibliche Mutter Wilhelms I., nun auch die ideelle Mutter Bismarcks und damit aller Deutschen (Wülfing/Bruns/Parr 1991, S. 112ff). Indessen beeilten sich konservative Historiker, die »preußische Madonna« zu einem zeitgemäßen Frauenzimmer zu marginalisieren. Heinrich von Treitschke traf sicherlich den Nerv seiner patriotischen Mitstreiter, als er in der Festrede zum 100. Geburtstag der Königin am 10. März 1876 die Macht des öffentlichen weiblichen Herrschaftskörpers demontierte und dann einen neuen, gründerzeitlich gefärbten Luisenmythos konstruierte. Reduziert auf die bescheidene Mutter, Gattin und Hausfrau wurde diese Luise dem männerzentrierten Weltbild des jungen deutschen Reichs gerecht. »Männer machen die Geschichte«, stellte von Treitschke klar. Luise sei da keine Ausnahme. Vielmehr sah er den »Prüfstein ihrer Frauenhoheit« gerade darin, dass sie als Handelnde keine Spuren hinterlassen habe. Ihr wahrer Wert sei nämlich immaterieller Natur. Er könne nur »aus dem Widerscheine«, den ihr Bild »in die Herzen der Zeitgenossen warf«, erraten werden. Dieser Wert bestand aus Qualitäten wie »Ernst ihrer Gedanken«, »Tiefe ihres Gefühls« und dem »Zauber einfacher Herzensgüte«, die sie, unsichtbar und körperlos 438
Kaiserreich und Kanon
hinter der Gestalt des Königs, als Erzieherin an ihre Söhne und an das ganze Volk weitergab (in: Wülfing/Bruns/Parr 1991, S. 107ff). Der Louisenmythos beeinflusste auch Clara Schumanns Verhalten. Vor diesem Hintergrund lassen sich ihre Bescheidenheitsgesten nachvollziehen. Damit entsprach sie dem in der Gründerzeit kollektiv akzeptierten Vorbild einer herausragenden deutschen Frau. Allerdings hatte die öffentlich demonstrierte Demut auch Grenzen. Trat sie gemeinsam mit der Sängerin Amalie Joachim auf, so konnte es passieren, dass beide in diesen »Frauenkonzerten« nicht als autonome Persönlichkeiten wahrgenommen wurden, sondern bloß als Sprecherinnen ihrer genialen Männer. Das gefährdete dann doch ihr Künstlerimage. »Clara Schumann und Amalie Joachim würden auch unter den Namen Wieck und Weiß namhafte Künstlerinnen sein, schwerlich aber hätten sie es als solche zu der Beliebtheit gebracht, deren sie jetzt genießen«, behauptete die NZjM 1877 (in: Borchard 2006, S. 529). Wenn Clara Schumann sich in den 1870er und 80er Jahre im deutschen Reich trotzdem so wirkungsmächtig durchsetzte, dann nicht zuletzt aufgrund eines paradoxen Phänomens. Schon vor den Zentenarfeiern für Luise von Preußen hatten sich Autorinnen für die »Mütter großer Männer« begeistert, wie eine Buchreihe Fanny Arndts hieß, die ab 1872 erschien und die sich der Kaiserin Maria Theresia ebenso widmete wie den Müttern von Goethe, Schiller und Bismarck (Wülfing/Bruns/Parr 1991, S. 113ff.; Bruns 1988, S. 309ff). Das Interesse an den die Heroen der Politik- und Geistesgeschichte begleitenden Frauen wurde vor allem von konservativen Vertreterinnen angefacht und gefördert, um den zeitgenössischen Frauenbewegungen der Sozialisten und Sozialdemokraten sowie deren Forderungen nach einem Frauenwahlrecht ein die hierarchischen Geschlechterrollen bewahrendes Bild entgegen zu setzen. Mit ihrer Suche nach herausragenden Gestalten in Vergangenheit und Zeitgeschichte lösten nun ausgerechnet die konservativen Patriotinnen eine frühe Frauenforschung aus. Sie führte zu der keineswegs beabsichtigten Einsicht, dass in der deutschen Geschichte sehr wohl herausragende Frauen existierten, die handelten, statt duldeten und über zupackende Qualitäten verfügten. Die schleichende »semantische >VermännlichungFräuleinsKleinen Morgenwanderer< lehrte sie mich die Akkorde so zu spielen, wie man die Füße beim Gehen hebt« (E. Schumann, S. 167). De Lara forderte Clara Schumann auf, sich die Kreisleriana op. 16 oder die Sinfonischen Etüden op. 13 wie Orchesterwerke vorzustellen und sozusagen »die Bratschen und Celli im zweiten Thema herauszuhören, darüber zu verweilen und sehr ruhig zu bleiben, während wir die Tone jeder Hand deutlich herausarbeiteten«. Für die Humoreske op. 20 gab sie als mentale Hilfe den Tipp, sich die Noten als Begleitung einer inneren Stimme vorzustellen (in: Rieger/ Steegmann 1996, S. 223fF). Das hermeneutische Interesse der Interpretation sollte indessen strikt auf Wahrheit und Seriosität gerichtet sein, das heißt, die Assoziationen mussten aus dem Stück heraus und nicht hinein interpretiert werden. Meist demonstrierte die Schumann ihre Ansicht suggestiv, das heißt direkt am Klavier, also durch Vor- und Nachspielen. Gerade das intensive Kunstverständnis lag der Künstlerin am Herzen. Sie investierte viel Zeit, um ihren Schützlingen ein »beseeltes« Spiel zu vermitteln, etwas, das sie manchmal vor allem bei ihren nichtdeutschen Schülerinnen und Schülern vermisste. »Spielte vortrefflich!« hieß es zufrieden nach einem Vortrag von Schumanns Novelletten op. 21 durch Adine Rückert, »merkwürdig ist es, daß sie als Französin Schumann besonders gut spielt, obgleich sie leider gar nicht musikalisch ist, sie hat gewisse virtuose Routine«. Dabei hatte Rückert schon in London bei Eugenie Schumann studiert. Sie blieb bis zu Clara Schumanns Tod in Frankfurt, ging dann nach England und wirkte dort als Pianistin (in: Vorspielbüchlein, S. 103 und 130). Auch Leonard Borwick litt, wie seine Mitstudentin Mathilde Verne überlieferte, an einem »typisch englischen Fehler«. Angeblich fehlten »Wärme und Temperament«. Die Schumann wollte den von seinen Eltern begleiteten Schüler zunächst abweisen, beriet sich dann aber mit Julius Stockhausen. Der schätzte ihn als »musikalisch« genug ein und hatte offenbar Recht. Borwick, der in Wien Brahms' erstes Klavierkonzert op. 15 aufführte, wurde einer ihrer berühmtesten Schüler, um dessen Reputation die Schumann ernstlich mit Brahms zankte. Nach seinem stürmisch gefeierten Deutschland-Debüt rief Marie Schumann ihm offenbar im Konzertsaal laut zu: »Gut gemacht, England!« (in: Rieger/Steegmann 1996, S. 167). Wie Clara Schumanns Frankfurter Vorspielbüchlein belegt, brachten die Studierenden auch eigene Musik mit, die vom Schumannschen Kanon ab472
Generationen
wich. So bot ihr Schüler Holdom White im Dezember 1893 bei einem Klassenvorspiel in der Myliusstraße Liszts Rhapsodie espagnole, »noch nicht fertig studiert«, wie die Lehrerin schriftlich streng kommentierte, »übrigens ein schauerliches Stück, das er selbst gewählt«. Die anderen Nummern, Chopins fis-Moll-Polonaise op. 44 und Henselts As-Dur-Etüde, fand sie »sehr gut gespielt« (in: Vorspielbüchlein, S. 89). Auch Marie Olson, eine aus Hull stammende Engländerin, die seit 1886 bei Clara Schumann studierte, trug bei ihrer Mitwirkung am Vorspielabend im Januar 1896 Liszt vor, und zwar die Polonaise E-Dur. »Vortrefflich gespielt, mit Temperament und voller technischer Beherrschung«, so der Kommentar der »Meisterin« (in: Vorspielbüchlein, S. 117). Olson hatte bereits eine eigene Karriere begonnen. Clara Schumann hielt sie für eine ihre besten Schülerinnen. Sie konzertierte viel in Skandinavien und blies musikalisch frischen Nordwind in das Frankfurter Konzert- und das Schumannsche Schülerrepertoire. Neben Christian Sindings 1893 entstandenem Klaviertrio op. 23, dessen Dissonanzen die Großmutter verletzten, wie sich der Enkel erinnerte (in: NZflVl 1917, S. 80), spielte sie »Drei Stücke« (möglicherweise die Klavierstykker op. 25 von 1890) der Komponistin Agathe Backer Grandahl, einer Schülerin von von Bülow und Liszt, »schwungvoll und wie immer technisch unfehlbar«, so die Schumann. Besonderen Erfolg hatte Olson allerdings mit Anton Rubinsteins viertem Klavierkonzert d-Moll op. 70. Sie habe »famos« gespielt, »riß Alle hin, was mich sehr freute, denn sie verdiente es«. Die »Meisterin« spielte mit ihr Brahms' Haydn-Variationen op. 56b (in: Vorspielbüchlein, S. 97 und 128ff). Bis heute ist nicht erforscht, inwieweit Olson eine skandinavische Schumann-Tradition beeinflusst hat. Zumindest weiß man, dass auch Marie Wieck in dieser Zeit öfters Tourneen durch Skandinavien unternahm. Ob sie sich kannten oder trafen, ist nicht bekannt. Das Vorspielbüchlein hatte nach Aussagen des Enkels Ferdinand eine diskrete Funktion. So konnten die Schülerauftritte evaluiert werden, ohne vor den Gästen einen Kommentar abzugeben. Schließlich galten die Vortragsabende, »wo sie Alle dabei sind«, nicht allein den Studierenden. Die sollten zwar Konzerterfahrungen machen und lernen, ihre Ergebnisse vor einem Publikum zu präsentieren. Und am »Schluß spiele ich Ihnen immer das Eine oder Andere von den Stücken, die sie studieren wollen. Es thut ganz gut, sie lernen sich concentriren und beherrschen«, so Clara Schumann (in: Vorspielbüchlein, S. 20). Doch zielten die privat veranstalteten Konzerte, bei denen neben Klavier viel Kammermusik gespielt wurde, auch auf Transparenz und Vermittlung. Werbung war als NebenefFekt willkommen. Unter den Die internationale Lehrerin
473
persönlich geladenen Gästen befanden sich nämlich nicht bloß Kolleginnen wie die Komponistin Clementine Becker und weitere Musikkenner, sondern auch einflussreiche und zahlungskräftige Frankfurter Bürger, wie der Bankier Ladenburg, die Baronin Rothschild oder die Familie Oppenheim. Florence Rothschild und Marie Oppenheim waren Schumann-Schülerinnen. Schließlich brauchte man immer wieder Mäzene oder Paten (Vorspielbüchlein., passim). Darüber hinaus veranstaltete Clara Schumann offenbar auch kleine interne Klassenwettbewerbe. Mathilde Verne schilderte als Erinnerung ihrer Mitstudentin Lily Goldschmidt ein Preisspiel, bei dem alle Schülerinnen und Schüler dieselbe Scarlatti-Sonate vorführten. Die »Meisterin« hörte hinter einem Paravant zu. Dann prämierte sie die beste Interpretation. Goldschmidt gewann ein kleines silbernes Kreuz (in: Rieger/Steegmann 1996, S. 169f). Nach Mathilde Wendt gestattete die Lehrerin gelegentlich auch interpretatorische Freiheiten. So korrigierte sie Wendts Auffassung der Romanze op. 28, kommentierte dann aber: »bleiben Sie dabei, wie es Ihrer Individualität entspricht« (in: NZfM 1919, S. 233). Inzwischen sind über 70 Schülerinnen und Schüler von Clara Schumann namentlich bekannt und teilweise auch zumindest rudimentär biografisch erschlossen (Wenzel 2007; Klassen 2008). Auch hier bestätigt sich das Verhältnis von Dreiviertel Frauen gegenüber einem Viertel Männern, wie seinerzeit im Frankfurter Konservatorium. Eine genauere Erforschung der Nachwirkung von Clara Schumanns Unterricht hat allerdings erst begonnen (de Vries 1996, S. 383ff.; R. Hofmann, in: Vorspielbüchlein, S. 123ff.; Wenzel 2007, passim). Einige Schülerinnen und Schüler kamen nur, um sich als Solisten sozusagen einen professionellen »Schliff« zu holen und die spezifische, »authentische« Clara Schumann-Interpretation der Werke von Beethoven, Schumann, Mendelssohn Bartholdy und Brahms zu lernen. Manche wie Eugenie Schumann, Ilona Eibenschütz oder Adelina de Lara hatten dabei das Glück, auch von Brahms gelegentlich eine Stunde zum Einstudieren seiner Werke zu bekommen, wenn er sich in Frankfurt aufhielt. Franklin Taylor hatte in Leipzig noch bei Moscheies studiert. Er absolvierte in Paris einen Kurs bei der Schumann und wirkte am 1882 gegründeten Londoner Royal College of Music, wo er offenbar das von Clara Schumann Gelernte weiter gab. Uber ihn kamen die Schwestern Mathilde Verne und Mary Wurm nach Frankfurt. Schülerinnen wie Sabinina, Amina Goodwin oder Margarete Stern studierten ebenfalls nicht allein bei der Schumann, sondern auch bei Liszt (de Vries 1996, S. 383ff). Neben Stern schickte Heinrich Ehrlich, der zunächst bei Thalberg studiert und sich dann offenbar in 474
Generationen
Berlin bei Clara Schumann weiter gebildet hatte, später besonders begabte Schülerinnen wie Josephine Parson zu ihr. Auch Fanny Davies hatte schon in Leipzig studiert, bevor sie nach Frankfurt zu Clara Schumann kam. Die führte ihre Schülerin dann erfolgreich in London ein, wo Davies im Crystal Palace mit Beethovens viertem Klavierkonzert op. 58 debütierte (de Vries 1996, S. 384). Schon Marie Wieckjulie von Asten und Nanette Falk hatten von gemeinsamen Konzert-Auftritten mit der Künstlerin profitiert. Diesen älteren Studierenden stand eine Reihe von »Wunderkindern« gegenüber. Sie kamen oft auf Empfehlung zu Clara Schumann, um so früh wie möglich eine professionelle Ausbildung zu erhalten. Damit war die Hoffnung verbunden, die gleiche glänzende Karriere wie ihre »Meisterin« zu machen. Manche der Schüler-Biografien lesen sich allerdings wie Skizzen zu einem sozialkritischen Roman von Dickens: Adelina Preston trat als Sechsjährige öffentlich auf und nahm schon damals als Künstler- den Geburtsnamen ihrer Mutter de Lara an. Sie verdiente mit zehn Jahren den Lebensunterhalt für die Familie, indem sie in Galerien und im Wachsfigurenkabinett Klavier spielte. Als ihr Vater, ein arbeitsloser Kupferstecher, und eine Woche später ihre Mutter starben, war sie keine elf Jahre alt. Den Druck, nun für die kleineren Geschwister sorgen zu müssen, hielt ihre 15jährige älteste Schwester nicht aus. Sie ertränkte sich. Adelina verlor damit innerhalb von zwei Wochen ihre wichtigsten Bezugspersonen. Sie hielt sich weiterhin mit Klavierspielen am Leben. Zwei Jahre später hörte die Schumann-Schülerin Fanny Davies das Mädchen spielen und beschloss, de Lara professionell zu unterrichten. Man fand private Mäzene zur Übernahme der Ausbildungskosten. Davies bereitete Adelina intensiv auf eine Präsentation bei Clara Schumann vor. Voller Angst harrte das Mädchen dem Termin entgegen. »Ich sah sie, eine königliche, in Schwarz gekleidete Figur, mit einem schwarzen Spitzentuch über ihrem silbernen Haar«, und spielte. Als sie merkte, »wie Clara Schumann mich anlächelte«, wusste sie: Sie hatte gewonnen. De Lara lernte im Eiltempo deutsch und schrieb sich mit 14 Jahren am Frankfurter Konservatorium ein. Bei ihrer Ankunft in der Myliusstraße half ihr Ilona Eibenschütz, eine zwei Jahre ältere Mitschülerin über die Befangenheit hinweg. Eibenschütz hatte ebenfalls (wie auch Nathalie Janotha) als »Wunderkind« begonnen. Sie kannte die Mühen, das Kinderimage abzulegen und sich zur professionellen Musikerin zu bilden und dürfte darüber hinaus auch das Heimweh der noch sehr jungen Schülerin mitempfunden haben. Damals gehörte Eibenschütz zu den illustresten Schülerinnen Clara Schumanns. Sie startete eine internationale Karriere und profilierte sich vor allem als Brahms-Interpretin (in: Rieger/Steegmann 1996, S. 214ff).
Die internationale Lehrerin
475
Wie sehr sich Clara und Marie Schumann für diese Mädchen verantwortlich fühlten, schilderte auch Mathilde Verne. Sie hatte ebenfalls früh ihre Mutter verloren. Verne war das vierte von zehn Kindern. Zwar stellte sie sich in London erfolgreich der Schumann vor, konnte sich aber eine so exklusive Ausbildung im Ausland gar nicht leisten. Offensichtlich wurden Mittel und Wege gefunden, sie zu fördern. Mit 18 Jahren ging Verne nach Frankfurt. Die Schumann bot ihr an, parallel zum Studium ihre Enkelin Julie zu unterrichten, förderte Auftritte ihrer Schülerin und besorgte ihr notfalls die passende Ausstattung. »Du sollst die Papillons spielen«, so die Schumann, »und du wirst auch dazu ein neues Kleid bekommen«. Marie Schumann schickte sie zur Schneiderin. Verne schrieb rückblickend, sie habe in Frankfurt »in einer ständigen Wolke der Anbetung« ihrer verehrten Lehrerin gelebt (in: Rieger/Steegmann 1996, S. 168f). Heute zählen Davies, Eibenschütz, de Lara und Friedberg zu den bekanntesten Schülerinnen und Schülern Clara Schumanns. Zu dieser Prominenz hat vor allem beigetragen, dass 1985 und 1986 Schallplatten mit historischen Aufnahmen von ihnen heraus kamen. Manche der Einspielungen entstanden erst in den späten 1940er und 50er Jahren, als in England und Amerika ein neues Interesse an Clara Schumann einsetzte. Da waren die Schützlinge inzwischen selbst im Alter ihrer damaligen Lehrerin. Nach »fünfzig Jahre traf ich wieder mit Ilona Eibenschütz zusammen«, so de Lara. Ohne Probe führten sie die Beethoven-Variationen op. 35 für zwei Klaviere von SaintSaens auf, die sie »zuletzt 1891 in unseren Studientagen gespielt« hatten. Es klappte! (in: Rieger/Steegmann 1996, S. 234). Tatsächlich waren Davies, Janotha, Eibenschütz, de Lara, Friedberg und Borwick schon zu Lebzeiten Clara Schumanns berühmte Virtuosen, die die »Meisterin« mit Stolz ausschwärmen sah. Nachdem Borwick in der Abschlussprüfung Saint-Saens' Klavierkonzert op. 22 hinreißend gespielt hatte, notierte sie sich: »Ich glaube nicht, daß Einer es ihm nachmacht, so ein schweres Concert zum ersten Mal öffentlich so zu spielen« (in: Litzmann 3, S. 525). Auch das Frankfurter Konservatorium schmückte sich mit den Erfolgen seiner Absolventen »ersten Ranges«, deren Triumphe in der Presse gefeiert wurden (Brunner, S. 276f.; Cahn 1979, S. 114). Claudia de Vries hat 1996 die Tondokumente unter anderem im Sinne einer pianistischen »Familienähnlichkeit« ausgewertet (de Vries 1996, S. 254ff). Was konnten die Schülerinnen und Schüler bei Clara Schumann lernen? Rhythmische Präzision, Detailgenauigkeit und ein sehr facettenreiches, farbiges Klavierspiel, wie es etwa in der so genannten »impressionistischen« Klaviermusik, 476
Generationen
aber auch zur Schattierung der Anschlagsnuancen in den Klavierstücken der zweiten Wiener Schule gebraucht wurde. Sodann hatte Clara Schumann darauf gesetzt, ihren Studierenden (wie den eigenen Kindern und Enkeln) eine unbedingte künstlerische Ethik einzuimpfen, die sie auf ein hohes Kunstideal verpflichtete. Wieviel davon dann über die Pianistengenerationen weiter transportiert worden ist, lässt sich kaum erfassen. Immerhin beschritt de Vries einen konstruktiven Weg, indem sie Schwerpunkte der durch Alwin Wieck tradierten Methodik an den raren Tondokumenten der Schumann-Schüler prüfte. Nur in Ansätzen kann man bei derzeitigem Wissensstand die Traditionswege der nachfolgenden Pianistengenerationen nachzeichnen. Nach Clara Schumanns Ausscheiden aus dem Lehrerkollegium bemühte man sich in Frankfurt, die Klavierausbildung in ihrem Sinne fortzusetzen und engagierte, trotz der drohenden Gefahr einer künstlerischen Inzucht, verschiedene »Zöglinge« der Schumann, darunter Janotha, Friedberg, Rothschild-Bassermann, Lina Mayer und Lazzaro Uzielli. Letzterer »vermittelte einer jüngeren Generation von Pianisten und Klavierpädagogen in Deutschland wesentliche Elemente der Methodik und des Interpretationsstils seiner Lehrerin«, so de Vries (1996, S. 394). Er blieb bis 1907 in Frankfurt und wechselte dann nach Köln. Seine Schüler Fritz Malata, Alfred Hoehn und Bernhard Sekles gehörten bis in die 1930er Jahre dann selbst zu den Dozenten des Frankfurter Konservatoriums. Auch Mayer und Rothschild-Bassermann blieben in Frankfurt. Sekles, ab 1924 Rektor, richtete 1928 sogar eine Jazzklasse ein, die 1933 dann gleich wieder geschlossen wurde. Er unterrichtete Theorie und Komposition. Heute ist er als erster Lehrer Theodor W. Adornos bekannt. Aus der »Ehrentafel« der Ehemaligen wurden nach 1933 Eibenschütz, Friedberg und Sekles aus rassistischen Gründen ausradiert (Cahn 1979, S. 317). Eibenschütz, die ursprünglich aus Ungarn stammte und ihre Kinderkarriere in Wien begonnen hatte, lebte seit Jahrzehnten in England. Schon nach ihrer Heirat 1902 hatte sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Friedberg wechselte Anfang des 20. Jahrhunderts, wie nach ihm Uzielli, von Frankfurt zunächst an das Kölner Konservatorium und ging dann 1916 an das Institute of Musical Art in New York. In Baltimore, am Peabody Institute, unterrichtete schon seit 1875 die Schumann-Schülerin Nanette FalkAuerbach. Über ihr weiteres Wirken liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor (de Vries 1996, S. 386ff.; Synofzik/Voigt 2006, S. 16 und 161). Zu den frühesten Schülerinnen, die selbst Karriere machten und ihr Wissen im Unterricht weiter gaben, dürfte Henriette Reichmann gehört haben. Die internationale Lehrerin
477
Sie war genauso alt wie ihre Lehrerin, die sie 1839 in Stuttgart kennen lernte. Reichmann begleitete die allein reisende Clara Wieck auf der Tournee nach Paris. Die Wieck erteilte ihr im Gegenzug dafür Unterricht. Beide wurden Lebensfreundinnen. Reichmann konzertierte in den 1840er Jahren in Deutschland und übersiedelte dann nach England. Sie lebte und wirkte als Musikerin in Hull (Synofzik/Voigt 2006, S. 160). In England wurden Fanny Davies und Janotha schon zu Lebzeiten von der Presse als aussichtsreichste Nachfolgerinnen Clara Schumanns auf dem Podium gehandelt. Seit 1892 arbeitete auch Eugenie Schumann dort. Verne unterrichtete zunächst wie Taylor am Royal Institute of Music und gründete 1909 in London ein eigenes Klavierinstitut, an dem auch de Lara eine Zeitlang Arbeit fand. Ob und was sie mit den bei de Vries zitierten »sektiererischen« Tendenzen der Clara Schumann-Schülerinnen zu tun hatten, von denen sich Borwick absetzte, bleibt undeutlich. Immerhin scheint bis in die 1950er Jahre eine englische Clara Schumann-Society existiert zu haben, für die de Lara und der Adelina Recording Trust Musikeinspielungen produzierten. Nach Silke Wenzel hat sich inzwischen de Laras Urenkel der Aufarbeitung der Familiengeschichte angenommen und eine entsprechende Website eingerichtet (de Vries 1996, S. 383; Wenzel 2007, passim). So vorbildlich und modern Clara Schumanns Klaviertechnik aufgrund ihrer Flexibilität auch gewesen sein mochte, so wurde die Künstlerin doch auch schon zu Lebzeiten immer wieder angegriffen. Im Zentrum der Kritik stand allerdings weniger die von ihr gelehrte Technik als vor allem die Erstarrung ihres Repertoires und die Macht, die sie damit auf den herrschenden Geschmack ausübte. In ihren letzten Lebensjahren zählte Clara Schumann mit ihrer »klassischen« Auffassung wie Brahms und Joachim zu den unverbesserlich Konservativen. »Die Trias: Clara - Brahms — Joachim bildet eine Phalanx gegen alles Unlautere, Unschöne in der Kunst, an der sich noch manche Heißsporne, Philister und Zukünftler - die Köpfe einrennen werden«, schrieb Hermann Levi bereits 1865 an Clara Schumann (in: Litzmann 3, S. 186). Er sollte Recht behalten. Das Trio bestätigte sich nicht nur immer wieder wechselseitig in seinen hehren Kunstansichten, jeder von ihnen besetzte auch wichtige Funktionen in verschiedenen musikalischen Institutionen des späten 19. Jahrhunderts. Mit ästhetisch begründeten Entscheidungen machten sie Politik und beeinflussten Stellenbesetzungen ebenso wie die Nachwuchsförderung, als Konzertierende, Veranstalter, Lehrer und Gutachter. Clara Schumann saß in Frankfurt wie Joachim in Berlin in den Eingangs- und Abschlussprüfungen der Musikhochschule. Brahms galt nach
478
Generationen
dem Tod von Wagner und Liszt als unumstößlich herrschende musikalische Autorität. Alle drei waren Preisrichter bei der Vergabe von Beethoven-, Mendelssohn- oder Mozart-Stipendien. Brahms begutachtete außerdem die Vergabe von Künstlerstipendien des österreichischen Ministeriums fiir Kultus und Unterricht und bewertete unter anderem die Preisausschreiben des Wiener Tonkünstlervereins und des Florentiner Quartettvereins. Es haben »nur die Kühnsten gewagt«, sich überhaupt zu bewerben, nachdem sie gewahr wurden, wer in der Kommission saß, so informierte der Primarius des Florentiner Quartetts, Jean Becker, seinen Mitgutachter Brahms. Alexander von Zemlinsky, der 1896 einen Preis für sein Trio für Klarinette, Violine und Klavier op. 3 gewann, schilderte anschaulich: »Mit Brahms zu reden war keine einfache Sache. Frage und Antwort war kurz, schroff, scheinbar kalt und oft sehr ironisch« (in: Behr 2007, S. 201). In einem Punkt war Brahms allerdings zu treffen, wenn nämlich die jungen Komponisten ihn daran erinnerten, dass er selbst als Zwanzigjähriger mit Wohlwollen von den Schumanns empfangen und angehört worden war. Verfolgt man die von Johannes Behr veröffentlichten Berichte der Nachwuchskandidaten, die mutig genug waren, ihre Kompositionen Brahms überhaupt vorzulegen, so schält sich heraus, dass der einschüchternde »Meister« besonders auf gediegene satztechnische Arbeit Wert legte, während ihm Ideenreichtum selten zu imponieren schien. So gefielen ihm etwa Iwan Knorrs kontrapunktischen Fakturen, und er empfahl ihn an die Frankfurter Hochschule, wo Knorr tatsächlich als Theorielehrer engagiert wurde. Er sei geneigt, »passable Werke zu überschätzen (im ersten Augenblick) - man sehnt sich gar so sehr nach Erfreulichem!« bekannte Brahms selbstkritisch Simrock gegenüber (in: Behr 2007, S. 199). Von den damals Ausgepreisten ist heute nur noch Zemlinsky bekannt, während fantastische Feuerköpfe wie Mahler, Wolf oder Hans Rott vergeblich darum warben, Brahms' Anerkennung zu gewinnen. Mahler gelang das nur als Mozart-Dirigent, nicht aber als Komponist. Nach dem Tod ihrer Mutter im M a i 1896 hielt Marie Schumann nichts mehr in Frankfurt. Kurz nach der Beisetzung begann sie, den Hausstand aufzulösen. Ihre Schwester Elise Sommerhoff hatte eine eigene Familie, Ludwig Schumann verdämmerte in Colditz, und Eugenie Schumann arbeitete in England. Ein Jahr später zog Marie in die Schweiz und lebte nach Angaben von Renate Hofmann dort mit ihrer Düsseldorfer Freundin Maria Maassen (R. Hofmann 2002, S. 300). In Frankfurt war sie eine für die Arbeit ihrer
Die internationale Lehrerin
479
Mutter unverzichtbare Klavierlehrerin gewesen, von der die meisten Schülerinnen und Schüler offenbar enorm profitierten. Deren Äußerungen lassen vermuten, dass Marie Schumann über mehr und andere Kompetenzen verfugt haben musste, als von heute aus zu erkennen ist. Als sie Frankfurt verließ, war Marie Schumann 55 Jahre alt. Ob sie sich als Lehrerin zur Ruhe setzte oder das pianistische Erbe weiter trug, ist derzeit unbekannt. Ihre Geschichte ist nicht erforscht. Marie Schumann verbarg ihre privaten Belange geschickt vor der Öffentlichkeit, indem sie auch in den erhaltenen Lebensdokumenten stets als gestrenge Erfullungsgehilfin ihrer Mutter auftrat. Ob sie tatsächlich kein eigenes Leben hatte oder ob es erst nach dem Tod der Mutter begann und wie es aussah, ist nicht zu entscheiden. Sicher ist aber, dass sie nicht zu den passiven Dulderinnen gehörte, wie das öffentliche Bild der im Hintergrund wirkenden Tochter vorgab. Vielmehr galt ihre überlegene Autorität offenbar ungebrochen bis zu ihrem Tod 1929. Nicht zufallig dürfte Eugenie Schumann erst danach in ihrem Buch Robert Schumann. Ein Lebensbild, meines Vaters einiges von dem veröffentlicht haben, was sie aus den Erzählungen ihrer großen Schwestern wusste. Marie Schumann verwaltete und steuerte das materielle und das symbolische Erbe der Familie so gründlich, dass viele der heute kursierenden Informationen über Clara und Robert Schumann vor allem aus einer von Marie Schumann gelenkten Perspektive bekannt sind.
Nachleben Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert Zunächst habe er abgelehnt, so der Literaturwissenschaftler Berthold Litzmann, »da ich mich musikalisch-technisch den besonderen Anforderungen, die die Biographie einer ausübenden Künstlerin stellt, nicht gewachsen fühlte« (Litzmann 1, S. III). Marie Schumanns Suche nach einem Autor, der über das Leben ihrer Mutter schreiben sollte, verzögerte sich, nachdem die Alternative, Julius Allgeyer, der Biograf Anselm Feuerbachs, während der Vorarbeiten im Jahr 1900 starb. Litzmanns Vorschlag, sie solle selbst eine Art erzählter Chronik aus Brief- und Tagebuchauszügen schreiben nach dem Vorbild von Sebastian Hensels Die Familie Mendelssohn, kam für Marie Schumann nicht in Frage. Als Litzmann im zweiten Anlauf 1901 den Auftrag dann doch annahm, befand er sich in einer akuten Lebenskrise. Auf sich gestellt mit zwei her480
Generationen
anwachsenden Kindern, versank er in tiefen Depressionen. Davor rettet ihn auch das Professorenamt an der Bonner Friedrich Wilhelm-Universität nicht. Obwohl er glaubte, dass ihm das Buch innerhalb der Wissenschaftszunft keine weiteren Ehren einbringen werde, nicht zuletzt, weil er die musikalischkünstlerische Kompetenz seiner Kollegen überaus gering einschätzte, nahm er doch die Vorbereitungen begeistert auf. »Mitten in den dunkelsten Zeiten meines Lebens war mir die Arbeit an der Biographie Clara Schumanns ein Erlöser und Befreier von schier unerträglichen Gedanken« (Erinnerungen, S. 389). Allgeyer war chronologisch bis 1840 gekommen, und Litzmann arbeitete Teile aus dessen Vorlage ein beziehungsweise um. Marie Schumann richtete ihm in ihrem Haus in Interlaken einen Arbeitsplatz ein, mit Blick auf das Jungfraumassiv, wie der Autor genüsslich unterstrich. Sieben Jahre lang, zwischen 1901 und 1908, verbrachte Litzmann seine Sommerferien dort. Solange er da saß und sich mit den Lebensdokumenten der Künstlerin befasste, verblassten die in Bonn zurück gelassenen Sorgen. »Ich horchte nur auf die Stimme der lieben Frau, die mir von ihrem Leben erzählte, soviel und so, als ob ich mit dabei gewesen, daß Fräulein Marie mich oft zweifelnd, staunend, wenn ich aus dem Geschriebenen vorlas, gefragt hatte: >Ja, woher wissen Sie denn das?< Worauf ich nur antworten konnte: >Von Ihrer Mutter!«< Für die Schumanntöchter stand außer Zweifel, dass das Nachleben ihrer Mutter durch eine Biografie geehrt und gesichert werden sollte. Schließlich war Clara Schumann eine national wie international berühmte Persönlichkeit. Sie konnte nicht einfach sang- und klanglos ins Vergessen sinken. Ihre Würdigung fiel in eine Zeit, in der man sich intensiv mit der Stellung von Frauen und besonders mit »großen« Frauen befasste und zwar sowohl auf fortschrittlicher als auch auf konservativer Seite. Am politisch linken Rand agierten sozialistische Frauenrechtlerinnen, die prinzipielle Gleichberechtigung in Ausbildung und Beruf sowie ein Frauen-Wahlrecht forderten. Sie sprachen von »Frauenemancipation«, eine Vokabel, die Konservative nur als Schimpfwort nutzten. August Bebels grundlegende Schrift Die Frau und der Sozialismus kam 1895 in 25. und 1910 in 51. Auflage heraus. Die bürgerlichen Bewegungen organisierten sich seit 1894 im Bund Deutscher Frauenvereine. Am rechten Rand positionierte sich der 1895 gegründete Kleeblattbund, ein Bismarck-Thurm der deutschen Frauen. Er publizierte neben einem Bismarck-Frauen-Kalender seit 1903 auch ein Bismarck-Jahrbuch fiir Frauen mit Lebensläufen von bewundernswürdigen Beispielen aus der Geschichte. Diese imaginäre weibliche Genealogie deutscher Frauendarstellungen gipfelte im Louisen-Mythos, der über die Kaiser- und Bismarckmutter bis in die eigene Gegenwart fortgeschrieben wurde (Bruns 1988, S. 314ff). Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
481
Das Interesse an »großen« Frauen führte beim konservativen Kleeblattbund zur Aufwertung von Frauen insgesamt. Sogar die traditionell für Klarheit und (männlichen) Verstand angewandte Sonnenmetapher wechselte ihre Bedeutung: Nun bildeten Frauen und Mütter das lichte, Wärme spendende sonnige Zentrum, wenn auch nicht der Gesellschaft, so doch der Familie (Vinken 2007, S. 182). Mit seiner Verbreitung heroischer Frauenbiografien setzte sich der Kleeblattbund gewissermaßen zwischen die ideologischen Positionen konservativer und sozialistischer Weiblichkeitskonzepte, indem sie einerseits die Wirkungsmächtigkeit und andererseits die Unterordnung von Frauen betonten. Die Redakteurinnen behielten dabei ihr politisches Ziel unverrückt in den Augen, nämlich das Weibliche mit Komponenten zu verknüpfen, die typisch für die deutsche Frau sein sollten, wie innig, häuslich und gemütlich. Diese Weiblichkeit galt insgesamt für ein unvergängliches, über der Geschichte stehendes Prinzip des Guten und des Humanen, das frei nach Goethe zum »Ewig-Weiblichen« verallgemeinert wurde. Es lebte nämlich »auch im Manne, es ist in Christus ein unverkennbarer Zug, in Buddha, in Plato, Schiller, Fröbel und zahllosen anderen Menschenfreunden«, konnte man 1911 im Bismarck-Jahrbuch lesen (in: Bruns 1988, S. 315ff). Der Bismarck-Anhänger Litzmann dürfte mit der Heroisierung herausragender Frauengestalten, wie der Kleeblattbund sie trieb, grundsätzlich sympathisiert haben. Das vom Kleeblattbund an »großen« Frauen exemplifizierte, idealisierte und auf Männer übertragbare Weiblichkeitskonzept ließ sich - mit Einschränkungen - sogar ideengeschichtlich mit dem älteren (politisch allerdings liberaleren) kulturtheoretischen Ansatz des Germanisten Wilhelm Scherer kombinieren. Scherer, bei dem Litzmann Ende der 1870er Jahre neuere deutsche Philologie studiert hatte, operierte mit einem vom biologischen Geschlecht abstrahierten, symbolischen Weiblichkeits- beziehungsweise Männlichkeitsbegriff, kehrte indessen die konservativen Zuordnungen »Frau/Natur« und »Mann/Kultur«, in seiner Theorie um, derzufolge sich über die Jahrhunderte eine Wellenbewegung literarischer Höhe- und Tiefpunkte beobachten lasse. Die Qualitätsmerkmale der Wellengipfel waren nach Scherer »Form,Toleranz, frauenhaft«, die der Wellentäler »Formlosigkeit, Intoleranz, männisch«. Mit »Form« sollte über die kunstvoll gestaltete Sprache hinaus die Zivilisation insgesamt, mit »Toleranz« das »literarische und außerliterarische Verhalten gegenüber Andersmeinenden und vor allem gegenüber Juden« gefasst werden, während »frauenhaft« als Topos einer sittlich fundierten Humanität eingesetzt und als »nationale Ethik« begriffen wurde (Weimar 2003, S. 468f). Scherers Theorie korrespondierte deutlich mit den gründerzeitlichen Konzepten von Zivilgesellschaft und Militärismus. 482
Generationen
Beide Konstruktionen von Weiblichkeit, die kulturtheoretische Scherers und die charakterlich überhöhte der »Ausnahmefrauen« des Kleeblattbunds, vereinte Litzmann in seiner Clara Schumann-Biografie. Litzmanns Erzählung grundierten im Hinblick auf das öffentliche Wirken seiner Hauptfigur zwei unterschiedliche Handlungsmotive, die er aus der Selbstdarstellung der Künstlerin übernahm, nämlich einmal die unbedingte ethische Pflicht zur Verbreitung »guter« Musik und zum zweiten die schicksalhafte Notwendigkeit, die Familie ernähren zu müssen. Diese von Clara Schumann bereits vorgegebene doppelte Motivation ihrer öffentlichen Auftritte wurde schon zu Lebzeiten durch das von ihr praktizierte Konzept einer »geistigen« wie »biologischen Mutterschaft« gestützt (Peters-Otto, in: Sandkühler/Schmidt 1988, S. 341f). Dem entsprachen auch die Bildprogramme der Clara Schumann-Porträts, auf denen nach 1856 ein als Haube und Trauerflor dienender schwarzer Schleier - der ikonografische Topos für die familiäre Funktion der Künstlerin - stets präsent war. Damit versöhnte sie in den Selbstdarstellungen den Widerspruch zwischen Karriere- und Hausfrau. Bei Litzmann erscheint die Künstlerin als ein komplexer Charakter aus »gefühlswarmem« Idealismus und realistischer Bodenhaftung, sozusagen eine Kreuzung von louisenhaften und bismarckschen Anteilen. Litzmanns Weiblichkeitskonzept hebt sich damit deutlich von den sich auf Darwin berufenden medizinisch-naturwissenschaftlichen Mustern eines Rudolf Virchow, Alfred Hegar, Paul Möbius oder Heinrich von Treitschke ab, nach denen Frauen besinnungslos dem Auf und Ab ihrer Natur unterworfen seien, während Männer mit klar ordnender Geisteskraft die Welt überblicken und beherrschen (Laqueur 1992, S. 21 Off.; Breidenstein 1996, S. 220ff). Damit bot Litzmanns Künstlerinnenbild eine so breite Palette unterschiedlicher Eigenschaften und Identifikationsmöglichkeiten, dass sowohl fortschrittlich als auch traditionell orientierte Weiblichkeitskonzepte an seine Biografie angeknüpft werden konnten. Litzmanns dreibändiges Werk, Clara Schumann. Ein Künstlerleben. Nach Tagebüchern und Briefen, orientiert sich an den Prinzipien einer biografischen Monografie, in die sowohl Quellen (wie Tagebuchauszüge und Briefe) als auch - zumindest ansatzweise - Materialien zur Quellenkritik (wie zeitgenössische Stimmen) und eigene Kommentare eingegangen sind und die auf belletristische Ausschmückungen weitgehend verzichtet. Für diese in der Germanistik seit den 1870er Jahren weit verbreitete literarhistorische Gattung war er bereits bekannt, als Marie Schumann sich an ihn wandte. Litzmanns biografische Methode ermöglichte die Ausbreitung einer Fülle gesicherter Fakten und Lebensdokumente, ohne positivistische Trockenheit, weil die Quellen in einen Gestus lebhaften Erzählens eingebunden werden Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
483
sollten. Der Stil folgte nach Scherers Vorbild Prämissen einer historischpsychologischen Rekonstruktion des Lebens beziehungsweise des Schaffensvorgangs und sollte durchaus unmittelbares Nacherleben ermöglichen. Allerdings verzichtete Litzmann auf »eigene Sonderforschungen« wie Max Unger in einer Besprechung kritisch anmerkte, das heißt er arbeitete ohne eine Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Schumann-Literatur und vertraute vor allem im dritten Band ganz auf die Aussagekraft der Lebensdokumente, die er sehr sparsam kommentierte. Sein Einfluss äußerte sich indirekt durch die Auswahl und Zusammenstellung der Zitate (Weimar 2003, S. 459ff.; Unger in: NZfM 1919, S. 234f). Schon in den 1880er Jahren war Litzmann von Scherer ermutigt worden, diesen in seiner Dissertation und der Habilitation begonnenen historiographischen Ansatz methodisch auszuweiten. Als Universitätslehrer legte der Literaturwissenschaftler Litzmann dann großen Wert auf Unmittelbarkeit und emotionale Empathie und praktizierte ungewöhnliche Unterrichtsformen. So zogen Professor und Studierende in Jena hinaus in die Landschaft und folgten den Spazierwegen Schillers, um durch sinnliches Nacherlerben einen Zugang zu dessen Dichtung zu finden. Die Methode brachte Litzmann den Titel »popularisierender Wanderprediger« ein (Weimar 2003, S. 481; Erinnerungen, S. 277ff). Er verteidigte dagegen seine Popularisierungen als die dem Staat und der Gesellschaft geschuldete Aufgabe, literarisches Wissen über den »verhältnismäßig kleinen Kreis der akademischen Hörer« hinaus zu vermitteln. Darin glich sein Ansatz dem Sendungsbewusstsein Clara Schumanns. Die Arbeit an der Clara Schumann-Biografie war nicht zuletzt durch übereinstimmende lokale und lebensgeschichtliche Erfahrungen motiviert. Sie sensibilisierten das innere Engagement des Autors, wie er bekannte, und beeinflussten die Intensität der Darstellung. Vor allen den zweiten Band, »Ehejahre«, prägten nach Ansicht des Autors die »eigentümlichen Parallelerscheinungen zu meinem eigensten Erleben«, nämlich die lang anhaltenden Sorgen und Depressionen des mit seinen Kindern allein gelassenen Elternteils, die »düsteren Angstvorstellungen schlafloser Nächte« und die eigene Suizidgefährdung während Litzmanns Bonner Jahre. Endenich lag vor seiner Haustür. Dazu trat die von Litzmann positiv erlebte Erfahrung, dass der Rückzug in die künstlerische Sphäre literarischer Produktion zu einem Überlebensmodus wurde (Erinnerungen, S. 376f. und 390). Womöglich fiel aus diesem Grund die Kritik des Biografen an der in ihre Musikwelt flüchtenden Mutter Clara Schumann so moderat und einfühlsam aus. Eine zurückhaltende moralische Bewertung zählte darüber hinaus aber auch zu 484
Generationen
den von Scherer gelehrten allgemeinen wissenschaftlichen Basistugenden. Die besondere Sympathie des Autors Litzmann zur biografischen Person beruhte zudem auf ihrer persönlichen Bekanntschaft. Sie dürfte bei Marie Schumanns Wahl ein entscheidendes Motiv gewesen sein. Litzmann hatte Clara Schumann im Dezember 1864 als Siebenjähriger zum ersten Mal im Haus seiner Eltern in Kiel gesehen und sie als ebenso respektvolle künstlerische Autorität wie als charmanten Gast erlebt. In den 1870er Jahren kam die Schumann mehrmals zur Heilung ihrer Armbeschwerden nach Kiel. Während der Behandlungswochen bei Friedrich von Esmarch spielte sie im Haus der Litzmanns Klavier, weil sich dort ein passables Instrument befand. So knüpfte man freundschaftliche Kontakte. An den in Kiel veranstalteten musikalischen Soireen der Schumann nahm die Familie Litzmann lebhaften Anteil. Als junger Student hörte der Sohn dann an der Seite Clara Schumanns mit heißen Ohren den Leipziger Proben zur dortigen Erstaufführung von Brahms' c-Moll Sinfonie op. 68 zu, die der Komponist selbst leitete. In seiner 1923 veröffentlichen Rückschau, Im alten Deutschland, Erinnerungen eines Sechzigjährigen, gedachte er auch einer ledernen Kollegmappe, die ihm die Künstlerin mit einem »liebenswürdigen, schalkhaften Lächeln [...], das ich immer noch vor mir sehe«, schenkte, nachdem sie seinen zerfledderten Wachstuchbeutel gemustert hatte {Erinnerungen, S. 163f). Konzeptionell folgt die umfangreiche, knapp eintausendfünfhundert Seiten umfassende Darstellung dem Dreischritt Kindheit und Lehrzeit (»Mädchenjahre«, Band 1), Eintritt in die höhere Sphäre der Kunst und Konsolidierung (»Ehejahre«, Band 2) sowie Ausbreitung der Kunst in die Welt (»Clara Schumann und ihre Freunde«, Band 3). So stellte Litzmann sein Werk in die Tradition großer Künstlerbiografien des 19. Jahrhunderts, wie Philipp Spittas Johann Sebastian Bach (1873), deren inhaltliche Schwerpunkte sich von den historisch-weltlichen Anfangen auf das künsderische Wirken verlagern. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, dass als Werk Clara Schumanns nicht ihre Kompositionen, sondern ihr Wirken als Pianistin in den Mittelpunkt rückte. Gerade der dritte Band, der mit einem Zeitraum von 40 Jahren den größten Teil von Clara Schumanns Leben und die Hauptzeit ihres internationalen Wirkens umfasst, konzentrierte sich auf die Verbreitung der musikalischen Botschaft. Politik und Geschichte blitzen nur gelegentlich auf. Ahnlich wie bei Spittas Bach lebt die Protagonistin hauptsächlich im Dienst der Kunst. Eine der wenigen zeitgeschichtlichen Anekdoten, die er in den Band aufnahm, nämlich die Begegnung zwischen der Schumann und Queen Victoria, hatte Litzmann schon als Kind im Kieler Elternhaus gehört (.Erinnerungen, S. 164).
Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
485
Litzmanns Schumann-Biografie erschien ab 1902 in mehreren, teils überarbeiteten Auflagen. Vergleicht man deren Anzahl, so scheint das Interesse an den ersten beiden (»Mädchen«- und »Ehejahre«) deutlich größer gewesen zu sein, als am dritten Band. Die Verteilung des Stoffs führte zu einer bemerkenswerten Asymmetrie. Während die ersten 36 Jahre in zwei Bänden ausgebreitet wurden, raffte Litzmann die weiteren 40 Lebensjahre in einem dritten zusammen, so als sei nach Robert Schumanns Tod nichts entscheidendes mehr passiert. Dadurch fokussierte er das gesamte Leben der Künstlerin auf die gemeinsam mit Robert Schumann verbrachten Jahre. Dieser Aufteilung liegt die Vorstellung zugrunde, dass erst die Begegnung mit Schumann die Protagonistin zur Einsicht in die höhere Kunst gebracht und sie aus dieser Richtung heraus ihren Sendungsweg durch die Konzertsäle angetreten habe - eine inzwischen widerlegte Sichtweise, die allerdings heute immer noch populär ist. Vor allem in dem 40 Jahre (1856-1896) umfassenden dritten Band fällt auf, dass sich die zitierten Passagen aus Tagebüchern und Briefen im wesentlich auf zwei Themen reduzieren, nämlich die Vermittlung von Robert Schumanns Kompositionen und die körperliche Kondition der Virtuosin. Auf diese Weise entsteht der Eindruck, als sei sie in der zweiten Hälfte ihres Lebens nahezu ausschließlich als Nachlassverwalterin durch die Welt gereist, um Schumanns Werke (und ein bisschen von Brahms) zu verkünden, während ganz Europa im Auf- und Umbau begriffen war. Diese Einengung beruhte vermutlich darauf, dass der Biograf aus den Tagebüchern nur zitieren durfte, was Marie Schumann billigte, um ein bestimmtes Bild der Künstlerin als Witwe Robert Schumanns zu fördern. In Teilen dürfte ein derartiger Fokus mit Clara Schumanns eigener Image-Konstruktion übereinstimmen. Trotz der proportionalen Verzerrung übernahmen viele spätere Clara Schumann-Darstellungen dann weitgehend ungefragt Litzmanns Vorbild. Die drei Bände zählen zusammen mit dem 1927 im Auftrag Marie Schumanns ebenfalls von Litzmann herausgegebenen Briefwechsel zwischen Clara Schumann und Johannes Brahms längst selbst zu den wichtigsten Quellentexten der Clara und Robert Schumann-Forschung, weil sie immerhin Auszüge aus den von Marie Schumann vernichteten autobiografischen Dokumenten ihrer Mutter zitieren beziehungsweise zusammenfassen. Litzmann stand in Interlaken zwar eine Fülle von Materialien zur Verfugung, Tagebücher, Briefe, Programmzettel, Zeitungsartikel, Urkunden und Würdigung. Sie durften aber nicht mitgenommen oder kopiert, sondern mussten vor Ort eingearbeitet werden. Alle daraus entnommenen Informationen kontrollierte und zensierte die Gralshüterin schon in der Entstehungsphase 486
Generationen
der drei Bände. Abends las Litzmann seiner Auftraggeberin die Ergebnisse der literarischen Tagesproduktion vor. Mit dieser umfangreichen Biografie wurde die Grundlage für ein Weiterleben der Künstlerin im 20. Jahrhundert gelegt, einmal aufgrund ihres Quellenstatus, darüber hinaus aber auch, weil Litzmann die bislang umfassendste Würdigung von Clara Schumanns »Künstlerleben« geschrieben hat. Bis in die 1920er Jahre hinein war die Künstlerin Clara Schumann noch allgemein im öffentlichen Bewusstsein präsent. Neben einer Fülle von Gedenkaufsätzen und lexikalischen Artikeln wie den von Carl Krebs für die Allgemeine deutsche Biografie hatte Richard Hohenemser 1906 einen gesonderten Beitrag über Clara Schumann ah Komponistin veröffentlicht (Hohenemser 1905/06, S. 113ff). Auch in der von Hanns von Zobeltitz herausgegeben Reihe Frauenleben. Eine Sammlung von Lebensbeschreibungen hervorragender Frauen kam, umgeben von Königin Luise und der Schauspielerin und Theaterintendantin Corona Schröter, 1910 ein von Wilhelm Kleefeld verfasster Band über Clara Schumann heraus. In London erschien 1912 Florence Mays The girlhood of Clara Schumann: Clara Wieck and Her Time, zeitgleich mit Marie Wiecks deutschem Buch Aus dem Kreise Wieck-Schumann. Zum 100. Geburtstag 1919 veranstaltete die Frankfurter Musikhochschule eine Gedächtnisfeier (Cahn 1979, S. 231), und in Zwickau fand eine erste Clara-Schumann-Gedenkausstellung statt. Sie sollte »den Beschauern« die Bedeutung der Künstlerin als »Pianistin, Komponistin, Bearbeiterin und Herausgeberin« nahe bringen. Erstdrucke ihrer Kompositionen, verschiedene Bearbeitungen, die Bände der SchumannAusgabe, aber auch Programmzettel, Rezensionen und Literatur über sie waren zu sehen. Darüber hinaus wollte das Museum die »geliebte Braut und Gattin«, die bewunderte »deutsche Frau und Künstlerin« sowie »die heldenhafte Kämpferin für ihre Familie und für Wahrheit und Schönheit vor das geistige Auge« stellen, wie Martin Kreisig in der NZfM formuliert. Briefe, Schmuck, ihr erster Flügel, ihr Handabguss und persönliche Utensilien waren ausgestellt (NZfM 1919, S. 229f). Die Zeitung widmete der Künstlerin eine eigene Nummer. Zugleich sorgten die verstreut publizierten Erinnerungen ihrer Schülerinnen und Schüler für ein literarisches Nachleben. Zur Popularisierung eines einschlägigen, familiär ausgerichteten Clara Schumann-Bilds trugen dann Eugenie Schumanns Erinnerungen (1925) und Das Lebensbild meines Vaters Robert Schumann (1931) bei. Die hier angelegten hagiographischen Tendenzen evozierten gleichzeitig auch heftige Gegenreaktionen (Klassen 1990, S. 4ff). Umstritten war Clara Schumann schon zu Lebzeiten, vor allem im Lager der Wagnerianer, aber auch bei von Bülow und allen, die ihre massiv verteiDie Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
487
digte Position als Garantin für »Klassizität« scheinheilig fanden beziehungsweise sich weigerten, ihr als Frau so umfassende musikpolitische Entscheidungskompetenzen zuzugestehen. Die rhetorische Demontage ihrer Macht äußerte sich in heftiger Kritik (auch von Wohlgesonnenen) an ihrem musikalischen und geistigen Urteilsvermögen sowie einer Marginalisierung und Entwertung ihrer Person. Sachlich bezog sich die Kritik vor allem darauf, dass es einer so »eminenten Begabung« wie ihr nicht gelang, die künstlerischen Potentiale in der Musik von Wagner oder Liszt anzuerkennen (Witt, NZflM 1919, S. 230). Auch bei den Erben regte sich Widerstand gegen die allmächtige Großmutter. Der Enkel Alfred Schumann inszenierte eine öffentlich ausgetragene familiäre Demontage, als er 1926 unter dem Pseudonym Titus Frazeni einen parodistischen »Bastardroman« (Matthias Wendt) auf die mit Litzmanns Darstellung übereinstimmenden Erinnerungen seiner Tante Eugenie Schumann publizierte. Dabei spießte er vor allem die engelrein gewaschenen Darstellungen des Verhältnisses zwischen Clara Schumann und Brahms auf mit der Pointe, dass Felix Schumann ein Sohn von Brahms gewesen sei. Spannungen zwischen den Halbschwestern Marie Wieck und Clara Schumann bezüglich der offiziellen Lesart ihrer Familiengeschichte gab es bereits zu Lebzeiten. Sie sickerten auch in den von Litzmann nur sehr sparsam zitierten Notizen durch. Mit ihren Nichten Marie und Eugenie Schumann schien Marie Wieck nicht besser zurecht zu kommen. Der Enkel Ferdinand Schumann hatte wiederum Anlass, mit seiner Tante Marie Schumann zu hadern. Die strich ihm nämlich die Studienmittel aus dem großmütterlichen Erbe, so dass er zu seinem ursprünglichen Beruf als Apotheker zurückkehren musste. Seine Tanten Marie und Eugenie beschrieb er im Rückblick als halsstarrig und hochmütig, während er die Großmutter insgesamt doch respektvoll ehrte (1954 passim). Wie massiv Clara Schumanns einschlägige kulturpolitische Sendung nachwirkte, zeigt eine Äußerung Ferruccio Busonis, die sein Schüler Gottfried Galston überlieferte: Diese »verdammte Bande, von der das >Musikalisch-sein< stammt«, so Busoni, »diese Clara Schumann, der Joachim und der Brahms. Welches Unheil haben sie in Deutschland angerichtet. Was für eine Stickluft haben sie verbreitet. Mit ihrer Duckmäuserei, Mesquinerie, Gehässigkeit, und ihren jesuitischen Heucheleien. Ich hasse dieses Pack« (23. Mai 1924). Da war Clara Schumann schon 28, Brahms 27 und Joachim 17 Jahre tot. Doch lässt Busonis heftiger Ausfall ahnen, welchen Einfluss und welche kulturelle Dominanz diese drei einmal ausübten. Das Trio stand symbolisch für eine verkrustete institutionalisierte Kunst, die das Erbe der deutschen Musik für sich beanspruchte und als Machtinstrument vereinnahmte. 488
Generationen
Diese Kunst manifestierte sich in einem bildungsbürgerlichen, elitären und exklusiven Werkkanon. Ihn hatte das Trio tatkräftig etabliert und dabei seine Auswahl als quasi objektiv, aus den Belangen des Künstlerischen heraus, gerechtfertigt. Auch an der Kodierung der medialen Repräsentationsform, der »klassischen« Konzertveranstaltung als symbolischer Form von kulturellem Gedächtnis, war das Trio entscheidend beteiligt, indem es behauptete, damit das »Schöne« und »Wahre« höchster Kunst zu tradieren. Während die jungen Avantgarden schon vor der Jahrhundertwende gegen eine derartig Verzerrung und einseitige Funktionalisierung von Kunst randalierten, verteidigte Hans Pfitzner sie mit seinen Schmähschriften Futuristengefahr (1917) und Die neue Aesthetik der musikalische Impotenz (1920), in denen er Busoni und dessen zukunftsweisende Ideen frontal angriff, und das ausgerechnet in einer aggressiven fäkal-sexualisierten Ausdrucksweise. Sie stand in krassem Widerspruch zum »hohen« Kunstideal des 19. Jahrhunderts, das Pfitzner für sich reklamierte. In den ästhetischen Grabenkämpfen der Anti-Moderne gegen die Zweite Wiener Schule, die den Hintergrund für diese Ausfälle bildeten, wollte sich Pfitzner als radikaler Anwalt einer deutschen romantischen Tradition profilieren (Widmaier 2005, S. 83ff). Und dafür stand das Trio Clara Schumann-Brahms-Joachim. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde vor allem durch zwei Weltkriege geprägt. Diese massiven Einschnitte beeinflussten auch die veränderten Weiblichkeitskonzepte, die die weitere Clara Schumann-Literatur widerspiegelt. Ihre herausragende Bedeutung in England, dem »Kriegsgegner«, rückte in den Hintergrund. Nach einer kämpferischen Phase während des Ersten Weltkriegs, in der sogar der konservative Kleeblattbund »strickende Walküren« forderte, die an der Heimatfront kämpften, »den Konkurrenzkampf mit dem Manne« aufnahmen und ihre Männer bei der Arbeit ersetzten, ging 1919 das sowohl von den Bismarck-Anhängerinnen als auch von den Sozialistinnen zur Jahrhundertwende hoffnungsvoll propagierte »Zeitalter der Frauen« definitiv zu Ende. Die heroischen Posen verschwanden aus der Frauenliteratur. In den 1920er Jahren wünschte man nicht nur in konservativen Kreisen als Vorbilder ganz gewöhnliche Mädchen, die Herd und Bett warm hielten, und keine herausragenden »Ausnahmefrauen«. Es gelte »die nationale Kleinarbeit in der Pflege deutschen Wesens, deutscher Tugenden, deutscher Frauen« als das »Dringlichste«, liest man 1922 im Bismarck-]ahrbuch (in: Bruns 1988, S. 320ff). Frauen sollten zu Hause bleiben und die Geburtenrate erhöhen. Jetzt richtete sich die kollektive Aufmerksamkeit sowohl rechter als auch linker Parteien verstärkt auf die Mütter und Erzieherinnen Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
489
der Jugend, als naturgemäße Aufgabe von Frauen, und das neue deutsche Heldinnenideal bestimmte ein biologisch-rassistisch fundiertes Mutterwesen (Vinken 2007, S. 198ff). Hier konnten andere mehr punkten als Clara Schumann mit ihrer intellektuellen Strenge und der patriarchalischen Macht. Für die neuen Avantgardistinnen taugte sie aber erst recht nicht zum Vorbild, trotz ihrer selbstbewussten Kunstausübung auf einem männlich dominierten Terrain, weil die Schumann zum Establishment einer autoritär verteidigten »Hochkultur« gehörte, die zerschlagen werden sollte. Der Despotismus, mit dem schon von Bülow seinem Publikum die Kunst einzuhämmern gedachte, schreckte fortschrittliche Interessenten nur noch ab. Moderne Frauen stylten sich androgyn, trugen Kurzhaarschnitte, Anzüge und entrümpelten die »weibliche« Mode gründlich. Die jungen Künstlerinnen besuchten mit ihren Liebhabern Boxkämpfe im Sportpalast und tanzten Foxtrott. Mit diesem Ideal war Clara Schumann nicht kompatibel. In den wenigen Publikationen der Zeit verblasste Clara Schumanns künstlerische Bedeutung und trat ganz in den Hintergrund zugunsten einer beflügelnden Muse für Robert Schumann und Brahms und ihrer Mutterfunktion. Dieses in populären Darstellungen schon früher dominierende Bild behauptet in der Belletristik eine schier unverwüstliche Attraktion und wurde tatsächlich noch über die 1970er Jahre hinaus nicht nennenswert revidiert, wie allein die verschiedenen Auflagen von Karla Höckers Buch Clara Schumann seit 1938 zeigen. Es ist immer noch auf dem Markt, heute allerdings als Jugendbuch. Um als Mutter gewinnen zu können, bedurfte es allerdings einiger Korrekturen. Die selbständigen, wirkungsmächtigen Seiten der Clara Schumann wurden in den Darstellungen weggelassen und stattdessen das Schicksalhafte, das zum Handeln zwang, in ihrer Biografie betont. Einzelne Aufsätze, wie Adolph Meurers Beitrag »Clara Schumanns eigenschöpferisches Werk« (in: NZfM 1939, S. 142-144) korrigierten dieses einseitige Bild nicht. Von dem inneren Zwiespalt der Künstlerin, die ihre professionelle Berufung auf der einen und die emotionalen Bedürfnisse nach häuslicher Idylle auf der anderen Seite ausleben wollte, blieb nur der häusliche Aspekt positiv bewertet, während die aktiv handelnde Seite zur schicksalhaften Notwendigkeit erklärt und damit abgehakt wurde. Mit dem Film als neuem Verbreitungsmedium veränderten sich die Darstellungsformate grundlegend. Filme brachten einen größeren Popularisierungsschub als Bücher. Es wurden auch andere Zielgruppen angesprochen. Inhaltlich blieb die Clara Schumann-Darstellung indessen einem bürgerlich konventionellen Frauenbild verhaftet. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs wurden indes wieder »starke« und tapfere weibliche Vorbilder ge490
Generationen
braucht. So produzierte die Ufa 1944 den ersten Schumann-Film, Träumerei, mit Hilde Krahl und Mathias Wiemann als >Traumpaar< der Romantik. Der Stoff wurde zur Propaganda umgeschmiedet. In einer Zeit, in der die eigene Lebenswelt auf allen Ebenen zusammenbrach, sollte man sich im Kino aus dem Kriegsalltag entfuhren lassen und in die biedermeierliche gute alte Zeit zurückreisen. Dort erwartete die Zuschauer dann eine schicksalsgeprüfte Frau und tüchtige, rastlos schaffende Mutti, die ihre blonde Kinderschar auch ohne Mann noch munter und handfest durch die Katastrophe führte. Zarah Leander sollte ursprünglich die Hauptrolle spielen. Sie war aber inzwischen aus Deutschland geflüchtet (Wendt 2008). Von diesem Frauenbild unterschied sich auch der 1947 in den USA gedrehte Spielfilm The Song of Love mit Kathleen Hepburn und Paul Henried als Schumann-Paar nicht wesentlich wie Beatrix Borchard herausgearbeitet hat (2008). In das Drehbuch könnten Anregungen aus John Burks 1940 in New York erschienenem Buch Clara Schumann. A Romantic Biography eingegangen sein. W i e schon in den 1920er Jahren, so wuchs auch in den Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkriegs das Bedürfnis nach literarischen Stoffen mit familiären Idyllen, in denen treusorgende Hausfrauen walteten. Dieses Genre bedienten mehrere Beiträge über Clara und Robert Schumann sowie Clara Schumann und Brahms (Klassen 1990, S. 4ff.;Twiehaus 1999, S. 234fF). Peter Schamonis Film Frühlingssymphonie brachte dann 1983 mit Nastassja Kinski als Clara Wieck und Herbert Grönemeyer als Robert Schumann eine moderne »Love Story« mit dokumentarischen Elementen in einem musealen Ambiente und in historischen Kostümen auf die Leinwand. Schamoni konzentrierte sich auf die Teenagerjahre der Künstlerin und rückte die Geschichte näher an eine heute verständliche emotionale visuelle Sprache heran, während die Hauptpersonen etwas befremdlich Texte aus den schriftlich überlieferten Wieck-Schumann-Dokumenten zitieren. Mit seinen attraktiven Hauptdarstellern bot der Film zumindest emotional eine aktualisierte Projektionsfläche fiir junge Menschen im Alter der Figuren. Das Bildnis dieser jungen Frau, der 18jährigen Clara Wieck, wurde auch von der Deutschen Bundespost und -bank bevorzugt. Knapp 150 Jahre nach ihrer Entstehung diente die Lithographie von Staub als Vorlage für ein 1986 ediertes Wertzeichen der Serie »Frauen deutscher Geschichte«. Auch bei dem 1990 neu gestalteten Hundertmarkschein der Deutschen Bundesbank griff man auf Staubs Porträt zurück (Busch-Salmen, S. 809ff). Die Künstlerin Clara Schumann wurde erst durch die von den Frauenbewegungen der 1960er und 70er Jahre ausgelösten kritischen Forschungen Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
491
wieder entdeckt und neu bewertet. Ob und inwieweit dabei die in England und den USA bis Anfang der 1950er Jahre noch lebendige Clara SchumannTradition, vertreten durch die englische Clara-Schumann-Society oder den Adelina Recording Trust, eine Rolle spielten, ist nicht ermittelt. Ein Teil der heute erhaltenen Einspielungen von Clara Schumann-Schülerinnen und Schülern wird im Britischen Rundfunkarchiv aufbewahrt. Durch einen Enkel lernte Thomas Michael, der die Sammlung der Tondokumente initiiert hatte, in London die Pianistin Adelina de Lara kennen und beschloss, ihr Spiel zu dokumentieren. De Lara war 1950 die letzte noch konzertierende Clara Schumann-Schülerin. Sie hatte 1945 in der Zeitschrift Music & Letters (S. 143ff.) einen Artikel über den Unterricht ihrer Lehrerin und zehn Jahre später ihre Memoiren veröffentlicht (Finale, London 1955). Anfang der 1950er Jahre nahm Michael mehrere Vorführungen von ihr auf. In dieser Zeit entstand auch ein Kurzfilm mit ihr und über sie, der in den USA vertrieben wurde (de Vries 1996, S. 255f.; Moore 1991, S. 39ff). Ein Teil der im Londoner BBC-Archiv gesammelten Tondokumente von de Lara, Davies und Eibenschütz wurde dann 1985 in der Sammlung Pupils of Clara Schumann auf Langspielplatten publiziert. Die von feministischen Forscherinnen erhobenen Untersuchungen basierten auf der Grundlage gewandelter Geschichts- und Kulturtheorien, durch die Fragen aufgeworfen wurden wie: Bedeutet Geschichte »Männergeschichte«? Haben Frauen keine eigene? Dabei leisteten Pamela Susskind, Eva Rieger und Eva Weissweiler Pionierarbeit. Ins Zentrum rückten besonders Fragen nach den schöpferischen Potentialen von Frauen, nach ihrer verschütteten Geschichte und den strukturellen Einschränkungen beziehungsweise nach dem, was die Arbeit von Künstlerinnen verhinderte. Hier wurde mit einem die patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen grundsätzlich in Frage stellenden Ansatz operiert. Die Dekonstruktion von männlicher Geschichte bezog auch die Herrschaftsverhältnisse innerhalb von Paaren wie Clara und Robert Schumann ein. Zunächst musste allerdings jede Menge »archäologischer« Such- und Archivarbeiten geleistet werden, um weitere Materialien (Texte, Kompositionen, Lebenszeugnisse) freizulegen, als die bislang vorliegenden Biografíen und Briefausgaben zugänglich machten. Und manches rückte überhaupt zum ersten Mal in den Fokus wissenschaftlichen Interesses. Allerdings taugte die historische Figur Clara Schumann mit ihrer Komplexität und der widersprüchlichen Ausstrahlung weder zur bürgerlichen noch zur feministischen Heldin. Publikationen wie Eva Weissweilers Clara Schumann. Eine Biografié (1990) oder Dieter Kühns Roman Clara Schumann, Klavier. Ein Lebensbuch 492
Generationen
(1996) widmeten sich hauptsächlich der Demontage eines überhöhten bildungsbürgerlichen, von selbsdoser Aufopferungsbereitschaft geprägten Frauenbilds. Nach jahrzehntelang aufgetragener heroischer Tünche interessierte nun vor allem die vertuschte und verschwiegene Gegenseite, die Biografie des Scheiterns, die Macht und Ohnmacht der Künstlerin, die »gute« und die »böse« Mutter, samt ihrer beruflichen Perspektiven zwischen Aufbruch und Anpassung. Die Arbeiten entstanden aus einer gendergeleiteten Perspektive vor dem Hintergrund einer allgemeinen Diskussion über Selbst- und Fremdbilder beziehungsweise Autonomie und Fremdbestimmung. Auf einer anderen Ebene dekonstruierten zwei deutschsprachige Theaterstücke den Clara Schumann-Mythos, nämlich Elfriede Jelineks Clara S. Eine musikalische Tragödie, 1982 uraufgeführt, und Dieter Kühns Familientreffen von 1988. In beiden Werken steht nicht die historische Person im Vordergrund, sondern eine von ihr inspirierte Fiktion. Bei Kühn zankt die Mutter in skurrilen Dialogen mit ihren erwachsenen Kindern herum, die ihrerseits giftig mit ihr abrechnen und so das in den autobiografischen und biografischen Quellen der Schumanns beschworene Idyll gründlich zerstören. In Jelineks Anordnung treffen Clara Schumann und Gabriele d'Annunzio aufeinander. Im Zentrum stehen Theaterfiguren, die als Zeichen ihrer Fremdbestimmung durch Zitate konstruiert werden. Dazu verwendet die Autorin unter anderem Brief- und Tagebuchmaterialien von Clara und Robert Schumann, Auszüge aus Romanen und Briefen d'Annunzios, aber auch aus dem Tagebuch von dessen Haushälterin (Doli, in: Twiehaus 1999, S. 239f). In der Rezeption von Jelineks Stück spielte Robert Schumanns Gedicht Traumbild am 9ten Abends. An C. W. von 1838 eine Zeitlang eine kuriose Rolle. Man hielt es nämlich für Lyrik Jelineks, deren Weiblichkeitsbilder zur Dekonstruktion entworfen waren. Robert Schumann dürfte dagegen die im Gedicht aufgerufenen Referenzen (Engel, Mignon, Heilige, Nonne), die Jelinek dann collagierte, um sie zu entmystifizieren, ernst gemeint haben (NZß\4 1838, S. 95; Doli, in: Twiehaus 1999, S. 240). Anfang der 1980er Jahre erschienen in England und den in den USA neue Biografien von Joan Chissell (Clara Schumann. A dedicated Spirit, 1983) und Nancy B. Reich (Clara Schumann. The Artist and the Women, 1985), die bereits das durch die Frauenforschung aufgeschlossene Interesse reflektierten und das gesamte künstlerische Wirkungsspektrum Clara Wieck Schumanns aufblätterten. Im selben Jahr, 1985, kam auch Beatrix Borchards grundlegende soziologische Untersuchung Robert Schumann und Clara Wieck. Bedingungen künstlerischer Arbeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heraus. Speziellere Forschungen über Die Virtuosin als Komponistin (Klassen 1990) Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
493
und Die Pianistin Clara Wieck-Schumann (de Vries 1996) folgten und vertieften das Wissen. Seit den frühen 1980er Jahren trugen außerdem kontinuierlich die oft auf wichtige Einzelfragen fokussierten Forschungen von Renate Hofmann immer wieder Neuigkeiten über Clara Wieck Schumann bei. Monica Steegmann platzierte dann 2001 die Künstlerin als erste Komponistin in der Reihe der Rowohlt-Monografien, parallel mit Fanny Mendelssohn Hensel. Autorinnen wie Reich, Steegmann, Weissweiler oder Borchard haben außerdem durch ihre Rundfunkarbeit und Fernsehfeatures sowie Workshops und Vorträge erheblich zur Popularisierung der Künstlerin Clara Schumann beitragen. Die ersten neuen Notenausgaben mit Musik der Komponistin Clara Wieck Schumann erschienen in den 1960er Jahren. Franzpeter Goebels gab 1967 und 1976 zwei Bände mit Romantischer Klaviermusik von Clara Schumann heraus. Das Klaviertrio op. 17 wurde 1972 nachgedruckt. Rosario Marciano edierte 1978 Drei Klavierstücke (Romanzen a- und h-Moll WoO, Andante op. 5 Nr. 3), gefolgt von Susskinds 1979 editiertem Band Selected Piano Music mit Stücken von op. 10 bis op. 21. Als ich in den 1980er Jahren meine Forschungen über die Komponistin begann, musste vor allem das Frühwerk noch erschlossen werden. Inzwischen liegen alle Werke weltweit in Neuausgaben und Tondokumenten vor. Selbst ausgesprochene Studien wie die Fugen nach Themen aus Bachs Wohltemperiertem Klavier sowie Fragment gebliebene Entwürfe hat man publiziert und aufgezeichnet (Bryn Mawr 1997; Goertzen 1999). Auch das Fragment des zweiten Klavierkonzerts in f-Moll wurde mit Ergänzungen von Jozef De Beenhouwer ediert, um es im Konzertsaal auffuhren zu können (De Beenhouwer/Nauhaus 1994). Eine Quintetteinspielung des Fragments auf historischen Instrumenten entstand innerhalb eines von Shinji Koiwa geleiteten Projekts zur historischen Klangforschung an der japanischen Hamamatsu-Universität 2008. Hier wird nicht zuletzt eine jahrzehntelange Missachtung und Verdrängung der Komponistin kompensiert. An Hochschulen und Universitäten hatte seit den späten 1970er Jahren in verschiedenen Ländern vereinzelt schon eine Beschäftigung mit Clara Wieck Schumanns Werken und ihrem Wirken begonnen. Im allgemeinen Konzertrepertoire haben sich ihre Werke allerdings nur sehr selektiv durchgesetzt. Am ehesten sind Lieder zu hören, hin und wieder ihr Klaviertrio, die Violinromanzen und das Konzert op. 7. Dagegen scheinen die Klavierstücke offenbar immer noch zu anspruchsvoll zu sein. Auf dem Podium hört man sie meist nur bei speziell veranstalteten Widmungs- oder Frauenkonzerten. Erneut erweist sich das durch Clara Schumann selbst etablierte restriktive »klassische« Kernrepertoire als erstaunlich resistent gegen jede Änderung. 494
Generationen
Die parallel dazu publizierten wissenschaftlichen Editionen der Robert Schumann-Forschung, wie die Tage- und Haushaltbücher, einschließlich der Ehetagebücher durch Georg Eismann (Band 1) und Gerd Nauhaus (Band 2 und 3) erweiterten das Wissen durch die philologisch sorgfältig aufbereiteten und ausführlich kommentierten Quellen immens. Friedrike Preiß arbeitete die rechtswissenschaftliche Seite des Ehekonsensprozesses auf (2004). Und mit der detailliert dokumentierten Herausgabe von Robert Schumanns Krankenakten (Schumann in Endenich) im Jahr 2006 hat Bernhard R. Appel auch dieses Dickicht transparenter gemacht, indem er synchrone Zeugnisse aus Briefen, Erinnerungen und Zeitungen um die Einträge in den Krankenakten gruppierte und auswertete. Hinzu kommen die umfangreichen Briefausgaben der letzten 20 Jahre: der Briefwechsel zwischen Clara und Robert Schumann (Weissweiler; ab 1987), zwischen Clara Schumann und ihrer Enkelin Julie (Julchen 1990), zwischen Clara Schumann und Theodor Kirchner (Kirchner 1996), Emilie und Elise List (Wendler 1996), der Schumann, Hermann Härtel, Richard und Helene Schöne (Steegmann 1997) und die Briefe von und an Clara Schumann und ihre Dresdner Freundinnen Marie von Lindemann und Emilie Steffens (Brunner 2005). Nicht zuletzt die diversen Tagungen und Symposien aus Anlass von Clara Wieck Schumanns 100. Todesjahr 1996 brachten eine Fülle von wissenschaftlichen wie populären Beiträgen in unterschiedlichen Medien. Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren etablierten Alltag-, Erinnerungs- und kulturellen Gedächtnisforschung sind inzwischen weitere Lebensdokumente veröffentlicht worden wie Das Berliner Blumentagebuch der Clara Schumann (R. Hofmann/Schmidt 1991), Clara Schumanns Frankfurter Vorspielbüchlein (R. Hofmann 2004), das Blumenbuch für Robert (Nauhaus/ Bodsch 2006), Clara Schumanns Photoalbum (Synofzik/Voigt 2007) oder Robert Schumanns Dichtergarten (Nauhaus/Bodsch 2007). Insgesamt hat sich der Forschungsfokus darauf verlagert, Lebensbedingungen und kulturelle Kontexte zu erschließen, um die Geschichte und den Prozess von Bedeutungsmustern beschreiben zu können. Und anstelle starrer Persönlichkeitsbilder haben sich längst heterogene Konzepte von sozialer und kulturell bedingter Subjekt- und Identitätskonstruktion etabliert. Davon bezieht auch die aktuelle Clara Schumann-Forschung zentrale Impulse.
Die Künstlerin im 20. und 21. Jahrhundert
495
W i e w ü n s c h e ich mir m e i n e H e l d i n ? Biografisches Schreiben „Sie lieben Sie ja", antwortete mir eine Psychologin, die ich nach Clara Wiecks kindlicher Sozialisation befragte. Ich selbst schätze mein Verhältnis zur Hauptperson distanzierter ein. Zumindest sollte die Arbeit an der Biografie von meinem übrigen Leben abgegrenzt werden, nicht nur aus methodischen Gründen, sondern auch, um ein gewisses M a ß an Distanz zu wahren, so jedenfalls der Wunsch. Manchmal empfand ich die lange Zeit, die ich mich schon mit Clara Schumann befasse, und die Akribie, mit der ich ihre Lebensdokumente und das zeitgenössische Umfeld sondierte, fast unheimlich. Dann überwog auch immer wieder die Faszination für eine wirkungsmächtige Künstlerin, von deren Existenz nicht zuletzt meine Forschung seit Jahren schon profitiert. Äußerlich bestehen zwischen ihrer und meiner Biografie wenig Ubereinstimmungen, sieht man von anekdotischem ab: „Frau Schumann steigt leicht und gern", nämlich die Berge hinauf, so beklagte sich Elise Pacher von Theinburg, die Schwester Emilie Lists, nach einem gemeinsamen Urlaub mit der Schumann in der Schweiz 1871 (in: Wendler, S. 491). Auch bei mir muss man darauf gefasst sein. Meine Reisen an die historischen Orte ihres Lebens lösten allerdings nicht unmittelbar das von Litzmann mit seinen Studierenden gesuchte emphatische Erlebnis aus. Unter den Palmen der Leipziger Nikolaikirche wandelnd kam mir vielerlei in den Sinn, das wenig mit dem Mädchen Clara Wieck, das hier sonntags eingekehrt sein mochte, zu tun hatte. Die rekonstruierten Wohnungen der Schumanns und der Mendelssohns in Leipzig, Clara Schumanns Handabguss, Witwenschleier, Strümpfe, Federcape und Goldbrosche, ihr Sonnenschirm, der tragbare Sekretär, ein Portemonnaie mit den kunstvollen Initialen, allerlei Tafelsilber und die goldene Davidsbündleruhr, die während der Gedenkausstellungen zum 100. Todestag 1996 zu sehen waren: Der Mythos vom Königsgewand zündete nicht wirklich. Dann füllten die Kinder einer angrenzenden Musikschule den heute gemeinsam genutzten Korridor der Schumannschen Wohnung in Leipzig dermaßen mit sprudelnden Alltagsgeräuschen, dass sofort klar war, warum der Papa nicht komponieren konnte, wenn die Kleinen herumrannten. Das brachte Leben ins Museum. Statt der Reliquien zog mich etwas anderes in Bann. Clara Schumann hatte versucht, ihre Wünsche zwischen Beruf und Familie in einer Gesellschaftsordnung auszuleben, die das nicht vorsah, sondern ein derartiges Lebenskonzept als unnatürlich und unmöglich bewertete. Ein großer Teil 496
Generationen
der Clara Schumann-Forschung übernahm diese Einschätzung. Während die private Dimension mit allen positiven wie negativen Facetten ihrer Persönlichkeit und die unterschiedlichen Konflikte mit weiblichen Rollenvorbildern zumindest während ihrer Ehe gut ausgeleuchtet sind, ist über ihre Öffentlichkeitsarbeit viel weniger bekannt. Daraus entsprang der Ansatz, eine öffentliche Perspektive einzunehmen und die Künstlerin als handlungsmächtiges Subjekt mit einem strategisch produktiven Machteinsatz zu beschreiben. Je mehr ich mich einarbeitete und je höher der Berg zusammengetragener Materialien sich auftürmte, desto ferner rückten die Person und die Zeit, in der sie lebte. Obwohl ich anfangs sicher war, schon recht viel über die Künstlerin zu wissen, begleitete dieser bekannte Effekt auch meine Arbeit. Gleichzeitig wuchs der Respekt vor der Person. Mit 20 Jahren hatte die Künsderin eine persönliche Autonomie erreicht, die es ihr ermöglichte, ihre Zukunft selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Dabei gelang ihr, worum heute viele ringen, nämlich Beruf und Familie zu leben, ohne die erreichte Spitzenposition, die sie als Künstlerin bei der Heirat bereits eingenommen hatte, aufzugeben. Die erhaltenen Dokumente zeigen, dass sie den dabei entstehenden Härten und Konflikten, dem Kampf um den Erhalt des professionellen Niveaus auf der einen und der häuslichen „Perfektionismusfalle" auf der anderen Seite, bis zur physischen Erschöpfung stand hielt und sich zumindest bis 1847 auch der musikalischen Partnerkonkurrenz herausfordernd stellte, um ihre Identität als Künstlerin und »Hausfrau« auszuleben. Man kann darüber staunen, wie selbstbewusst sie 1854 jede Kritik an ihrem Verhältnis zu Brahms zurückwies, als sie den jugendlichen Ritter bei sich einquartierte. Insgesamt ist auch ihr außergewöhnlicher Kompetenzerwerb und -erhalt über Jahrzehnte hinweg zu bewundern. Entgegen allen W i derständen setzte Clara Schumann ihre hochgesteckten künsderischen Ziele öffentlich durch, wenn auch nicht ohne Verlust. Schließlich verstummte die Komponistin nach 1856. Ihr ungebrochenes Sendungsbewusstsein dürfte die Quelle ihrer machtvollen Position in der Kunstszene gewesen sein. Insofern bietet sie tatsächlich ein Vorbild für weibliche Autonomie im 19. Jahrhundert. Nach den literarisch fixierten gesellschaftlichen Kategorien ihrer Zeit führte sie ein geradezu »männliches« Leben, indem sie aktiv handelnd eingriff und auch während ihrer Ehe die finanzielle Autonomie nicht aufgab. Dass die Mutterposition für sie durchaus Konflikt beladen sein konnte, zeigt am deutlichsten die spätere Aufgabenteilung mit ihrer Tochter Marie, der sie diesen Part in emotional kritischen Phasen abtrat. Dabei repräsentierte sie im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Weiblichkeitsbilder. Sie dienten einerseits ihrem Künstlerimage. Andererseits scheint Clara Schumann die Biografisches Schreiben
497
öffentliche Verkörperung bestimmter Frauentypen auch als Camouflage genutzt zu haben, um sich unangreifbar zu machen, frei handeln zu können und dahinter ein Stück Privatheit zu schützen. Ihre öffentlichen musikalischen Auffuhrungen galten als kulturelle und gesellschaftspolitische Ereignisse. Clara Schumann beeinflusste durch ihre Aktivitäten die Rezeption und kommerzielle Verbreitung eines klassischromantischen Klavierkanons entschieden. Welchen wertvollen Rückhalt dieser Kanon bis heute beziehungsweise vor dem Hintergrund aktueller Globalisierungskrisen heute wieder bieten kann, hat Lawrence Kramer in seinen 2007 publizierten Überlegungen Why classical music still matters bekräftigt: die »klassische« Musik erzwinge eine spezifische Aufmerksamkeit und fordere uns als Kunst zu einer Art »worth hearing« heraus. Indem wir uns auf ihre Werte einließen und ihre Sprache zu verstehen suchten, profitierten wir noch immer von ihren Ideen (S. 5 f). In Europa dürfte darüber hinaus der geschichtliche Aspekt eine zentrale Rolle spielen. Schließlich gilt die »klassische« Musik nach wie vor als wichtiges kulturelles Kapital, das mit der jetzigen Wiederentdeckung bürgerlicher Werte neu eingeschätzt wird. Uber Biografié und biografisches Schreiben, den Umgang mit Quellen, die Auswertung von Egodokumenten, die Position der Autoren zwischen »Supervisor« und »Spin-Doctor« (Klein, S. 14), die Reflexion und Evaluierung des eigenen Standorts wie der gewählten Sprache gibt es eine Fülle sehr spannender Spezialliteratur. Als zentrale Frage wird vor allem der Akt des bewusst oder implizit eingeschriebenen Sinns diskutiert, den man den Biografíen überstülpt. Legendäre Musterbeispiele des Genres wie Hans Magnus Enzensbergers Dokumentarbiografie Requiem fiir eine romantische Frau. Die Geschichte von Auguste Bußmann und Clemens Brentano von 1988, in der in chronologischer Folge Dokumente ihrer gemeinsamen Geschichte ausgebreitet werden, oder Läzlö F. Foldényis alphabetisch geordnetes Kultbuch Heinrich von Kleist. Im Netz der Worter, das 1999 auf Deutsch erschien, präsentieren anstelle Sinn konstituierender Lebensachsen parataktische Anordnungen des Materials. Beide verweigern eine kohärente Heldenkonzeption. Während Enzensberger auf eigene narrative Präsenz verzichtet (bis auf die »Nachrede«, S. 225 ff), verzichtet Foldényi darauf, kausale Zusammenhänge zwischen Leben und Werk herzustellen. Das gilt auch für den Darstellungsmodus. Seine einzelnen Kapitel können in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Jedoch ließen sich diese Vorbilder aus mehreren Gründen nicht kopieren. Für die erste Variante sind die Lebensdokumente Clara Schumanns zu umfangreich und für die zweite besteht das schon von Litzmann reflektierte 498
Generationen
Problem darin, dass die Künstlerin kaum über ihre Produkte, nämlich die Komposition und Interpretation von Musik, darstellbar ist. Hinzu kommt ein Interessenskonflikt. Wahrend Enzensberger und Foldényi im Zuge des „linguistic turn", der so genannten sprachkritischen Wende in der Erkenntnistheorie, von einer Dekonstruktion der uneingeschränkten Position des Kunst schaffenden Autorindividuums ausgingen, steht die seit den späten 1960er Jahren vom Feminismus ausgelöste Biografik von Künsderinnen unter anderen Prämissen. Frauen waren bis dahin in den einschlägigen Diskursen weder als Autorinnen noch als historische Figuren merkbar präsent. Daher galt es (und gilt immer noch), die bislang verborgene Wirkungsmacht von Frauen herauszuarbeiten und an dieser Form von wissenschaftlicher Geschichtsschreibung mitzuwirken, um ihre aktive Teilhabe an der (Kunst-)Geschichte überhaupt zu thematisieren und publik zu machen (Runge, in: Klein, S. 117 ff). Indessen hat sich das Interesse an Biografik in den letzten Jahren insgesamt gewandelt. Nach der langjährigen literarischen Karriere von Antiheldinnen und -helden, die in keiner Weise zu Vorbildern taugen, besteht seit Anfang des 21. Jahrhunderts wieder ein neues Interesse an Geschichte mitsamt dem Wunsch nach engagierten Protagonisten einer ausgesprochenen Neugier auf deren „normales" Alltagsleben. Zu sehen, wie sie sich in den Niederungen des Gewöhnlichen behaupten oder auch nicht, macht die Heroen menschlich, ohne ihre außergewöhnlichen Leistungen in Frage zu stellen. Dafür bietet Clara Schumann ein ausgesprochen attraktives Modell. Die Künsderin hat ihre literarischen Biografíen als Imagekonstruktion zu steuern versucht, so weit es in ihrer Macht stand. Um einen Weg zu finden, sowohl die von ihr ausgehenden Selbsterfindungen als auch die sie von außen beeinflussenden Faktoren darzustellen, bot es sich an, Clara Schumann aus unterschiedlichen Richtungen zu beschreiben und sich nicht ausschließlich auf ihre eigenen Aussagen zu fokussieren. Daraus resultierte dann die Entscheidung, ein historisches Panorama aufzuschlagen, vor dem die Künstlerin in ihren weiten Handlungsspielräumen mitsamt ihrer vielfältigen Aktivitäten sichtbar wird. Auf diese Weise ließ sich eine Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts aus wechselnden Perspektiven erzählen. Das hier skizzierte Panorama ist weder objektiv gegeben noch willkürlich. Vielmehr orientiert sich die Auswahl der Themen an Stichworten aus den Lebensdokumenten der Künstlerin. Damit konstruiere ich einen Sinn, der ermöglichen soll, die „soziale Energie" (Greenblatt) von Clara Schumanns künstlerischem Handeln freizulegen, gestützt auf kunstsoziologische Theorien des »new historicism«. Pierre Bourdieu beschreibt »Kultur« als semantisches »Feld von Kräften« unterschiedlicher Energien, die auf jede oder jeden
Biografisches Schreiben
499
einwirken. Gleichzeitig beeinflussen die handelnden Personen ihrerseits die Kräfte im Feld, indem sie neue Regeln setzen, wie etwa Avantgardisten im Umkreis eines traditionellen Diskurses. Diese Funktion gilt auch für Autoren, die die Prozesse »im Feld« beobachten und beschreibend in sie eingreifen. Mit der Feldtheorie können sowohl Zugänge von außen (etwa über die Machtverhältnisse) als auch von innen, aus einer immanenten Perspektive, geöffnet werden (Pinto, S. 9 ff.; Bourdieu 1997, S. 34 ff). Ubertragen auf die Biografie heißt das, Clara Schumann als individuelle historische Person in einem sich ständig verändernden Feld kultureller, sozialer, politischer und ökonomischer Kräfteverhältnisse und Vernetzungen sichtbar zu machen und dabei ihre eigenen Veränderungen zu interpretieren. In manchen Kapiteln tritt die Person, in anderen das »Feld« stärker hervor. Erzählperspektive und Sprachstile wechseln. Meine Position bleibt nicht neutral. Manchmal ergreife ich Partei für die Protagonistin, um ihre aus heutiger Sicht möglichen Handlungsoptionen durchzuspielen. Auch bei der Beschreibung ihrer Kompositionen wechselt der Standort. Sowohl der Blick von der Wirkungsebene als auch von der Produktionsebene aus wird eingenommen, um einen lebendigeren und emotionaleren Zugang bieten zu können als über analytische Interpretation allein möglich ist. Im Laufe der sich länger hinziehenden Arbeit entfaltete sich bei aller methodischen Reflexion dann allerdings eine eigene Dynamik des Schreibens. Die Chance, eine Biografie zu verfassen, hatte ich sorglos ergriffen. Sie zu realisieren, stellte eine größere Herausforderung dar, als ich ursprünglich dachte. Mit der Zeit verschoben sich auch immer wieder die Sichtachsen auf die Künstlerin. Auch ein Teil meiner früheren publizierten Annahmen hat sich inzwischen verändert. Als Konstante blieb indessen das, was ich als ihr »Lebensthema« darstelle, nämlich die öffentliche Durchsetzung von artifizieller Musik, zu der sie sich kraft ihrer Begabung berufen fühlte, und der sie alles andere unterordnete, so jedenfalls die Hypothese. Ihre Überzeugung, mit der Verbreitung von Kunst ein dem Alltag übergeordnetes Ziel zu verfolgen, dürfte die Antriebsfeder für das ausgeprägte pastorale Sendungsbewusstsein gebildet haben, das ihre Entscheidungen charakterisiert. Die Künstlerin hat die Höhen und Tiefen, die Linien und Kurven, Brüche und Sprünge ihrer Biografie selbst thematisiert. Als Clara Schumann 1888 als Touristin in Weimar noch einmal Goethes »Junozimmer« betrat, stand der Streicherflügel, auf dem sie sich und ihre Kunst 1831 vor dem Dichter präsentiert hatte, noch am selben Platz: »Das berührte mich ganz eigen! ein ganzes Leben hat sich seitdem abgespielt - wie ein Chaos kam es einem vor«, resümierte sie (in: Litzmann 3, S. 503). Der Flügel steht noch immer dort. 500
Generationen
Anhang
Bildnachweise Abb. 1: Abb. 2: Abb. 3: Abb. 4: Abb. 5: Abb. 6: Abb. 7: Abb. 8: Abb. 9:
Abb. 10: Abb. 11:
Abb. 12: Abb. 13:
Abb. 14: Abb. 15: Abb. 16: Abb. 17:
Clara Wieck, 1832. Lithographie nach einem Gemälde von Eduard Fechner (in: Porträts, S. 18; Schumannhaus, Bonn-Endenich) Clara Wied, 1835. Lithographie von Julius Giere (in: Porträts, S. 22; Zwickau, RobertSchumann-Haus, Archiv Nr. 10059-B2) Clara Wied, 1838. Lithographie von Andreas Staub (in: Porträts, S. 31; Zwickau, RobertSchumann-Haus, Archiv-Nr. 10054-B2) Clara Wieck, 1840. Aquarellierte Zeichnung von Johann Heinrich Schramm (Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 10950-B2/A4) Clara Schumann, 1844. Brustbild von August Wilhelm Wedeking, Ol auf Leinwand (in: Porträts, S. 81; Märkisches Museum Berlin Sig.: VII 60/94x) Clara und Marie Schumann, 1844/45. Daguerreotypie, Fotograf unbekannt (in: Porträts, S. 41; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 6021-B2) Doppelporträt von Robert und Clara Schumann, 1846. Gipsrelief von Ernst Rietschel (in: Porträts, S. 51; Privatbesitz) Robert und Clara Schumann, 1847. Lithographie von Eduard Kaiser (in: Porträts, S. 60; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 2915-B2) Clara Schumann, 1847. Bleistiftzeichnung von Wilhelm Hensel, mit Widmung der Künsderin (in: Porträts, S. 62; Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr-: Hensel NG 3/56) Clara und Robert Schumann am Pianino, 1850. Daguerreotypie von Johann Anton Völlner (in: Porträts, S. 64; Musée d'Orsay Pho 1986-90) Clara Schumann, 1853. Gemälde von Carl Ferdinand Sohn (Original vernichtet; in: Zwischen Poesie und Musik. Robert Schumann - früh bis spät. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung, hg. von Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Verlag Stadtmuseum Bonn und Stroemfeld-Verlag, Bonn-Frankfùrt 2006, S. 136 Clara Schumann, 1854. Fotografie von Franz Hanfstaengl (in: Porträts, S. 93; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 6031-B2) Johannes Brahms, 1854/55. Kalotypie aus dem Fotoatelier Berta &. Ed. Wehnert-Beckmann (in: Zwischen Poesie und Musik. Robert Schumann-früh bis spät. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung, hg. von Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Verlag Stadtmuseum Bonn und Stroemfeld-Verlag, Bonn-Frankfurt 2006, S. 230; Zwickau, RobertSchumann-Haus, Archiv Nr. 06.020-B2) Die Schumannschen Kinder, um 1855. Fotograf unbekannt (Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv-Nr. 6020-B2) Clara Schumann, 1857.Talbotypie von Franz Hanfstaengl, in: Zwischen Poesie und Musik, S. 230, Zwickau (Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 10530-A4/B2) Clara Schumann, datiert von Clara Schumann »d. 24. Aug 62.«, Carte de Visite, Fotograf unbekannt, in: Kat., S. 4, Zwickau, (Robert-Schumann-Haus, Archiv-Nr. 1645-B2) Clara Schumann, 1866. Brustbild, Foto von C. von Jagemann mit eigenhändigem Zitat des Themas »Andantino de Clara Wieck« aus Robert Schumanns Sonate für Klavier f-Moll op. 14 (in: Porträts, S. 104; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 8445-A4/B4)
Bildnachweise
501
Abb. 18: Clara Schumann, 1878. Brustbild, Mischtechnik von Franz von Lenbach (in: Porträts, S. 83; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 10045-DZ) Abb. 19: Clara Schumann, 1885. Marmorbüste von Adolf Hildebrand (in: Porträts, S. 73; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 10049a-Bl) Abb. 20: Clara Schumann, 1887. Fotografie aus dem Atelier Elliot & Fry, London (in: Porträts, S. IIS; Zwickau, Robert-Schumann-Haus, Archiv Nr. 10529-A4/B2) Abb. 21: Clara Schumann, Marie undEugenie Schumann, Loucky VonderMühll (?), 1895. Fotografie, aufgenommen im Garten der Familie Vonder Mühll, Basel (in Zwickau, RobertSchumann-Haus, Archiv-Nr. 07.051-B2)
502
Anhang
Siglen
AmZ Allgemeine musikalische Zeitung, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1820ff. AmA Allgemeiner musikalischer Anzeiger, Haslinger, Wien 1829ff. Ansteckung Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, hg. v. Miijam Schaub, Nicola Suthor, Erika Fischer-Lichte, Wilhelm Fink Verlag, München 2003 Bach-Rezeption Hartinger, Anselm, Wolff, Christoph, Wollny, Peter (Hg): »Zu groß, zu unerreichbar«. BachRezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, Leipzig, Paris 2007 Bedeutung Regeln der Bedeutung. Zur Theorie der Bedeutung literarischer Texte, hg. v. Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matias Martinez, Simone Winko, Walter de Gruyter, Berlin, New York 2003 Biedermeier Biedermeiers Glück und Ende, hg. v. Hans Ottomayer, Hugendubel, München 1987 Blumenbuch fiir Robert Clara Schumann, Blumenbuch für Robert 1854-1856, hg. v. Gerd Nauhaus und Ingrid Bodsch, unter Mitarbeit von Ute Bär und Susanna Kosmale, Verlag Stadtmuseum Bonn & Stroemfeld Verlag, Bonn-Frankfurt-Basel 2006 Blumentagebuch Das Berliner Blumentagebuch der Clara Schumann 1857-59, eingeleitet v. Renate Hofmann und kommentiert von Renate Hofmann und Harry Schmidt, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden etc. 1991 Brunner Brunner, Renate (Hg.): Alltag und Künstlertum. Clara Schumann und ihre Dresdner Freundinnen Marie von Lindemann und Emilie Steffens', Erinnerungen und Briefe, Studio-Verlag, Sinzig 2005 (Schumann-Studien, Sonderband 4) Bw Clara und Robert Schumann. Briefwechsel, kritische Gesamtausgabe, hg. von Eva Weissweiler unter Mitarbeit von Susanne Ludwig, 3 Bde., Stroemfeld / Roter Stern, Basel/Frankfurt am Main 1984,1987,2001 Concertwesen Hanslick, Eduard: Geschichte des Concertwesens in Wien, 2 Baende in 1 Band, Nachdr. d. Ausg. v. 1869-1870, Olms, Hildesheim etc. 1979
Siglen
503
Einfachheit Biedermeier. Die Erfindung der Einfachheit, Ausstellungskatalog, hg. v. Hans Ottomayer, Klaus Albrecht und Laurie Winters, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2006 Endenich Robert Schumann in Endenich (1854-1856): Krankenakten, Briefzeugnisse und zeitgenössische Berichte, hg. von der Akademie der Künste, Berlin, und der Robert-Schumann-Forschungsstelle, Düsseldorf, durch Bernhard R. Appel, mit einem Vorwort von Aribert Reimann, Schott Music G m b H 6c Co KG, Mainz etc. 2006 (Schumann-Forschungen 11) Erinnerungen Litzmann, Berthold: Im alten Deutschland. Erinnerungen eines Sechzigjährigen, Grote Verlag, Berlin 1923 Erz und Stein »Ein Bild von Erz und Stein*. Kaiser Wilhelm am Deutschen Eck und die Nationaldenkmäler, Katalog zur Ausstellung im Mittelrhein-Museum Koblenz 1997, hg. v. Klaus Weschenfelder, GörresVerlag, Koblenz 1997 E. Schumann Schumann, Eugenie: Erinnerungen, J. Engelhorns Nachfolger, Stuttgart 1925 Fashion Fashion. Eine Modegeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert. Die Sammlung des Kyoto Costume Institute, 2 Bde, hg. v. Akiko Fukai u.a., Kyoto 2002; dt. Taschen G m b H , Köln 2006 Geschichte der Frauen Duby, Georges / Perrot, Michelle (Hg.): Geschichte der Frauen, 5 Bde, zit. Ausgabe Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1997 Geschichte des privaten Lebens Aries, Philippe und Duby, Georges (Hg.): Geschichte des privaten Lebens, 5 Bde, zit. Ausgabe S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1989 GS Schumann, Robert: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker [1854], 2 Bde, fünfte Auflage, hg. v. Martin Kreisig, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1914 HsFW Handschrift Friedrich Wieck Hildebrand Adolf von Hildebrand und seine Welt. Briefe und Erinnerungen, besorgt von Bernhard Sattler, hg. v. der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Verlag Georg D. W. Callway, München 1962 ß Wieck, Clara und Friedrich: Jugendtagebücher (1828-1840), hg. von Gerd Nauhaus / Nancy B. Reich, Druck in Vorb.
504
D-Zsch, Archiv-Nr. 4877,l-4-A3;
Anhang
Joachim Briefe von und an Joseph Joachim. 1842-1907. In 3 Bänden, hrsg. von Johannes Joachim / Andreas Moser, verlegt von Julius Bard, Berlin 1911ff. Julchen Moser, Dietz-Rüdiger (Hg.): Mein liebes Julchen. Briefe von Clara Schumann an ihre Enkeltochter Julie Schumann, Nymphenburger, München 1990 Kanon Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung, Renate v. Heydebrand, Metzler, Stuttgart, Weimar 1998
hg. v.
Kat. Bodsch, Ingrid / Nauhaus, Gerd (Hg.): Clara Schumann 1819-1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem HeinrichHeine-Institut Düsseldorf aus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996 Kirchner Hofmann, Renate (Hg.): Clara Schumanns Briefe an Theodor Kirchner, Verlag Hans Schneider, Tutzing 1996 KuG Friedrich Wiecks Klavier und Gesang [1853] und andere pädagogische Schriften, kommentiert hg. v. Tomi Mäkelä und Christoph Kammertons, von Bockel Verlag, Hamburg 1998 Litzmann Litzmann, Berthold: Clara Schumann. Ein Künstlerleben. Breitkopf und Härtel, Leipzig 1902,1905,1908
Nach Tagebüchern und Briefen, 3 Bde.,
NZfM Neue Zeitschriftfiir
Musik, red. v. Robert Schumann, Robert Friese, Leipzig 1834ff.
Öffentlichkeit Öffentlichkeit - Geschichte eines kritischen B e g r i f f s , hg. v. Peter Uwe Hohendahl, Mitarbeit Russell A. Berman, Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar 2000 Popularisierung Popularisierung und Popularität, hg. v. Gereon Blaseio, Hedwig Pompe, Jens Ruchatz, DuMont Verlag, Köln 2005 Porträts Appel, Bernhard R./Hermstriiwer, Inge/Nauhaus, Gerd (Hg.): Clara und Robert Schumann: zeitgenössische Porträts, Katalog zur Ausstellung des Heinrich-Heine Instituts, Düsseldorf und des Robert-Schumann-Hauses in Zwickau, Droste, Düsseldorf 1994 (Veröffentlichungen des Heinrich-Heine-Instituts Düsseldorf) Schumann-Brahms Clara Schumann - Johannes Brahms: Briefe aus den Jahren 1853—1896, hg. von Berthold Litzmann, 2 Bde., Breitkopf und Härtel, Leipzig 1927
Siglen
505
Schumann-Interpretationen Schumann, Robert, Interpretationen Laaber 2005
seiner Werke, 2 Bde, hg. v. Helmut Loos, Laaber-Verlag,
Star Faulstich, Werner, und Körte, Helmut: Der Star. Geschichte - Rezeption — Bedeutung, Fink Verlag, München 1997
Wilhelm
Statistik Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch I, Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes 1815-1870, hg. v. Wolfram Fischer, Jochen Krengel und Jutta Wietog, Verlag C. H. Beck, München 1982 Tb Schumann, Robert: Tagebücher, 1, hg. v. Georg Eismann; 2, hg. v. Gerd Nauhaus; 3 (= Haushaltbücher I und II), hg. v. Gerd Nauhaus, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1971,1987, 1982 Virtuosität Musikalische Virtuosität, hg. v. Heinz von Loesch, Ulrich Mahlert und Peter Rummenhöller, Schott Verlag, Mainz etc. 2004 (Klang und Begriff I) Vorspielbüchlein Hofmann, Renate: Clara Schumanns Frankfurter Vorspielbüchlein, hg. von der Brahmsgesellschaft Baden-Baden e.V., SMR-Druck Rastatt, Rastatt o. J. {2004) Weltausstellungen Geschichte der Weltausstellungen: gesehen: 18. April 2008
http://www.expo2000.de/expo2000/geschichte/index.php, ein-
Wendler Wendler, Eugen (Hg.): »Das Band der ewigen Liebe«. Clara Schumanns Briefwechsel Elise List, Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar 1996
mit Emilie und
Wertung Heydebrand, Renate von / Winko, Simone: Einführung in die Wertung von Literatur, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1996 Wieck Briefe Wieck, Friedrich: Briefe aus den Jahren 1830-1838, hg. von Käthe Walch-Schumann, Arno Volk, Köln 1968 (Heft 74)
506
Anhang
Literatu rverzeichn is
Ackermann, Peter / Schneider, Herbert (Hg.): Clara Schumann - Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone: Bericht über die Tagung anlässlich ihres 100. Todestages, veranstaltet von der Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst und dem Hochschen Konservatorium in Frankfurt am Main, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 1999 (Musikwissenschaftliche Publikationen, Bd. 12) Adolf von Hildebrand und seine Welt. Briefe und Erinnerungen, besorgt von Bernhard Sattler, hg. v. der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Verlag Georg D. W. Callway, München 1962 AfFeldt-Schmidt, Birgit: Fortschrittsutopien. Vom Wandel der utopischen Literatur im dert, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1991 Allgemeine musikalische Zeitung, Breitkopf 6c Härtel, Leipzig 1820ff.
W.Jahrhun-
Altenburg, Detlef: Die Neudeutsche Schule — eine Fiktion der Musikgeschichtsschreibung? In: Ders.
(Hg.): Liszt und die Neudeutsche Schule, Laaber-Verlag, Laaber 2006, S. 9 - 2 2 Ansteckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, hg. v. M i i j a m Schaub, Nicola Suthor,
Erika Fischer-Lichte, Wilhelm Fink Verlag, München 2003 Appel, B e r n h a r d , R.: Robert Schumanns Davidsbund. Geistes- und sozialgeschichtliche Voraussetzungen einer romantischen Idee, in: Archiv für Musikwissenschaft, Steiner Verlag, W i e s b a d e n
1981, S. 1 - 2 3 Ariès, Philippe / Duby, Georges (Hg.): Geschichte des privaten Lebens, 5 Bde., zit. Ausgabe S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1989 Assmann, Aleida / Friese, Heidrun: Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität 3, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, 2 1999 Baggerman, Arianne: Autobiography and Family Memory in the Nineteenth Century, in: Dekker, R u d o l f (Hg.): Egodocuments and History. Autobiographical Writings in its Social Context since the Middle Ages, Verloren, Hilversum 2002, S. 161-173 Balzac, Honoré de: Béatrix, hg. v. Madeleine Fargeaud, Editions Gallimard, Paris 1979, zit. Ausg. 2004 Bär, Ute: Zur gemeinsamen Konzerttätigkeit Clara Schumanns undJoseph Joachims, in: Clara Schumann. Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone, hg. v. Peter A c k e r m a n n u n d H e r b e r t
Schneider, Georg Olms Verlag, Hildesheim etc. 1999, S. 35-57 Barth, Richard (Hg.): Johannes Brahms im Briefwechsel mit J. O. Grimm, N D der Ausgabe v. 1912, Verlag Hans Schneider, Tutzing 1974 Baßler, Moritz (Hg.): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, A. Francke-Verlag Tübingen und Basel, aktualisierte 2. Aufl. 2001 Bayly, Christopher A.: Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780-1914, dt. C a m p u s Verlag, Frankfurt/New York 2004 Becker, Sabina: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kunst im bürgerlichen Zeitalter, A . FranckeVerlag Tübingen und Basel 2003 Behne, Klaus-Ernst: Gehört. Gedacht. Gesehen. Zehn Aufsätze zum visuellen, kreativen und theoretischen Umgang mit Musik, ConBrio Verlagsgesellschaft, Regensburg 1994 Behr, Johannes: Johannes Brahms - Vom Ratgeber zum Kompositionslehrer. Eine Untersuchung in Fallstudien, Bärenreiter Verlag, Kassel etc. 2007 Belting, H a n s : Das unsichtbare Meisterwerk.
Die modernen Mythen der Kunst, Verlag C . H . Beck,
München 1998 Berger, Christian: Phantastik als Konstruktion. Hector Berlioz'»Symphonie fantastique«,
Bärenreiter
Verlag, Kassel etc. 1983 (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft Bd. 27)
Literaturverzeichnis
507
Berke, Dietrich: Art. »Denkmäler und Gesamtausgaben«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, völlig neu bearbeitete Ausg, hg. v. Ludwig Finscher, Sachteil Bd. 2, Kassel etc. 1995, Sp. 1111-1115 Berliner Allgemeine Musikalische Zeitung, Verlag Schlesinger, Berlin 1824 ff. Berlioz, Hector: Memoiren [1870], zit. Ausg. Rogner und Bernhard, München 1990 Bernhard, Klaus: Idylle. Theorie, Geschichte, Darstellung in der Malerei 1750-1850, Böhlau-Verlag Köln, Wien 1977 Bertz, Inka: Familienbilder. Selbstdarstellung im jüdischen Bürgertum, DuMont Verlag, Köln 2004 Biba, Otto: Clara Schumann in Wien, in: Clara Schumann 1819-1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf aus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, hg. v. Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 107-135 Biedermeier. Die Erfindung der Einfachheit, Ausstellungskatalog, hg. v. Hans Ottomayer, Klaus Albrecht und Laurie Winters, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2006 Biedermeiers Glück und Ende, hg. v. Hans Ottomayer, Hugendubel, München 1987 Bodsch, Ingrid: Nicht nur Efeu „von Roberts Grab". Clara Schumann und Bonn, in: Clara Schumann 1819—1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorfaus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, hg. v. Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 297-307 Dies. / Nauhaus, Gerd (Hg.): Zwischen Poesie und Musik. Robert Schumann -früh bis spät. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung, Verlag Stadtmuseum Bonn und Stroemfeld-Verlag Bonn-Frankfurt 2006 Dies. / Ders. (Hg.): Clara Schumann, Blumenbuch für Robert 1854—1856, unter Mitarbeit von Ute Bär und Susanna Kosmale, Verlag Stadtmuseum Bonn 8c Stroemfeld Verlag, BonnFrankfurt-Basel 2006 Böhme, Hartmut: Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne, Rowohlt Verlag, Reinbek 2006 Bohrer, Karl Heinz: Die Kritik der Romantik. Der Verdacht der Philosophie gegen die literarische Moderne, Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989 Borchard, Beatrix: R. Schumann und Cl. Wieck. Bedingungen künstlerischer Arbeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Weinheim/Basel 1984, 2. Auflage Kassel 1992 (Ergebnisse der Frauenforschung, Bd. 4) Dies.: Clara Schumann. Ihr Leben, Ullstein Buchverlage, Berlin 1991 Dies.: Stimme und Geige. Amalie undJoseph Joachim, Biographie und Interpretationsgeschichte, Böhlau, Wien 2005 (Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 5) Dies.: Von Robert zu Clara und zurück? In: Schumann-Studien 9, hg. v. Gerd Nauhaus und Ute Bär, Sinzig 2008, S. 81-96 Borgstedt, Silke: nLe concert, c'est moi"-Strukturelle Determinanten musikalischen Startums und ihr historischer Kontext, in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, hg. v. der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, Neue Folge Bd. 25, Bern etc. 2006, S. 113-129 Dies.: Stars und Images, in: Musiksoziologie, hg. v. Helga de la Motte-Haber und Hans Neuhoff, Laaber-Verlag, Laaber 2007, S. 327-337 (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft, Bd. 4) Borst, Arno: Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 1990, 3 2004 Bourdieu, Pierre: Das literarische Feld, in: Louis Pinto, Franz Schultheis (Hg.): Streijzüge durch das literarische Feld, Universitätsverlag Konstanz 1997, S. 33-145 Ders.: Die männliche Herrschaft, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005
508
Anhang
Brachmann, Jens: Kunst - Religion - Krise: Der Fall Brahms, Bärenreiter, Kassel etc. 2003 Brahms, Johannes: Briefwechsel mit Joseph Joachim, 2 Bde, hg. v. Andreas Moser, Verlag der deutschen Brahmsgesellschaft, Berlin 1908 Brahms-Fantasien. Johannes Brahms - Bildwelt, Musik, Leben, Katalog der Kunsthalle zu Kiel, hg. v. Jens Christian Jensen, Kiel 1983 Brändle, Fabian, Kaspar von Greyerz, Lorenz Heiligensetzer, Sebastian Leutert und Gudrun Piller: Texte zwischen Erfahrung und Diskurs. Probleme der Selbstzeugnisforschung, in: Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1850), hg. v. Kaspar von Greyerz, Hans Medick und Patrice Veit, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2001, S. 3-31 Braun, Christina von / Stephan, Inge (Hg.): GenderWissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, UTB Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2005 Breger, Klaudia, Identität, in: Braun, Christina von / Stephan, Inge (Hg.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien, UTB Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 2005, S. 47-65 Breidenstein, Georg: Geschlechtsunterschied und Sexualtrieb im Diskurs der Kastration Anfang des 20. Jahrhunderts, in: Was sind Frauen ? Was sind Männer? Geschlechtskonstruktionen im historischen Wandel, hg. v. Christiane Eifert u. a., Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1996, S. 216-239 Brendel, Franz: Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich, Verlag von Bruno Hinze, Leipzig 1852 Ders.: Die Musik der Gegenwart und die Gesammtkunst der Zukunft, Leipzig 1854 Bromen, Stefan: Studien zu den Klaviertranskriptionen Schumannscher Lieder von Franz Liszt, Clara Schumann und Carl Reinecke, Studio Verlag, Sinzig 1997 (Schumann-Studien, Sonderband 1) Brunner, Renate (Hg.): Alltag und Künstlertum. Clara Schumann und ihre Dresdner Freundinnen Marie von Lindemann und Emilie Steffens-, Erinnerungen und Briefe, Studio-Verlag, Sinzig 2005 (Schumann-Studien, Sonderband 4) Bruns, Karin: Machteffekte in Frauentexten. Nationalistische Periodika, in: Weiblichkeit in geschichtlicher Perspektive, hg. v. Ursula A. J. Becher und Jörn Rüsen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988, S. 309-338 Bulwer-Lytton, Edward: Die letzten Tage von Pompeji [1834], zit. Ausg. Artemis Sc Winkler Verlag, Düsseldorf und Zürich 2000 Burger, Ernst: Franz Liszt. Eine Lebenschronik in Bildern und Dokumenten, List Verlag, München 1986 Busch-Salmen, Gabriele: Kunst und Werbemittel. Die Bildnisse Clara Schumanns, in: Österreichische Musikzeitschrift, 1996, S. 808-821 Bußmann, Hadumod und Hof, Renate: Genus. Geschlechterforschung / Gender Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2005 Cacilia, eine Zeitungßir die musikalische Welt, Schott Verlag, Mainz 1824 ff. Cacilia. Ein Taschenbuchfür Freunde der Tonkunst, Hoffmann und Campe, Hamburg 1833ff. Cahn, Peter: Das Hoch'sche Konservatorium in Frankfurt am Main (1878-1978), Frankfurt am Main 1979 Charle, Christophe: Vordenker der Moderne. Die Intellektuellen im 19. Jahrhundert, Fischer Verlag Frankfurt am Main 1997 Chissell, Joan: Clara Schumann: A dedicated spirit. A study of her life and work, Hamilton, London 1983 Chopin, Frédéric: Briefe, hg. mit einem Vorwort und Kommentaren von Krystyna Kobylanska, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1984 Csäky, Moritz: Eine Welt von Gegensätzen: Wien und Zentraleuropa zur Zeit von Bruckner und Brahms, in: Bruckner - Brahms. Urbanes Milieu als kompositorische Lebenswelt im Wien der
Literaturverzeichnis
509
Gründerzeit, hg. v. Laurenz Lütteken und Hans-Joachim Hinrichsen, Bärenreiter Kassel etc. 2006, S. 10-26 Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow. Das Geheimnis des Glücks [1990], dt. 1992 Klett-Cotta, Stuttgart '2001 Czerny, Carl: Uber den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven'schen Klavierwerke, nebst Czerny's "Erinnerungen an Beethoven , hg. v. Paul Badura-Skoda, Universal Edition, W i e n 1963 Czok, Karl: Die Nikolaikirche Leipzig, Museen, Sammlungen, Denkmale, Edition Leipzig 1992 Dahlhaus, Carl: Die Idee der absoluten Musik, Bärenreiter Verlag, Deutscher Taschenbuch Verlag, Kassel und München 1978 Ders: Klassische und romantische Musikästhetik, Laaber Verlag, Laaber 1988 Ders.: Das deutsche Bildungsbürgertum und die Musik, in: Koselleck, Reinhart (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert,'VAX II, Klett-Cotta, Stuttgart 1990, S. 220-236 Danuser, Hermann (Hg.): Musikalische Interpretation, Laaber Verlag, Laaber 1992 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 11) Ders. und Münkler, Herfried (Hg.): Deutsche Meister - böse Geister? Nationale Selbstfindung in der Musik, in Zusammenarbeit mit der Staatsoper Unter den Linden, Edition Argus, Schliengen 2001 Der Freischütz. Gemeinnütziges Unterhaltungsblatt, Cranz, Hamburg 1825fF. Der musikalische Salon, Verlag Schlesinger, Berlin 1844ff. Die Gartenlaube, illustrirtes Familienblatt, Scherf, Berlin 1853ff. Dießner, Petra, Hartinger, Anselm: Bach, Mendelssohn und Schumann. Spaziergänge durch das musikalische Leipzig, Edition Leipzig, Leipzig 2005 Dömling, Wolfgang: Franz Liszt und seine Zeit, Laaber-Verlag, Laaber 1985 Dörffel, Alfred: Die Gewandhausconcerte zu Leipzig, vom 25. November 1781 bis 25. November 1881, Leipzig 1884, Reprint VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1980 Dorn, Heinrich: Aus meinem Leben. Gesammelte Aufsätze, 7 Bände, Berlin 1870-1886 Draheim, Joachim: Clara Schumann in Karlsruhe, in: Clara Schumann 1819-1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorfaus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, hg. v. Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 283-295 Ders. und Brigitte Höft (Hg.): Clara Schumann, Sämtliche Lieder fiir Singstimme und Klavier, Breitkopf Sc Härtel, Bd I Wiesbaden 1990, Bd II Wiesbaden 1992 Drewitz, Ingeborg: Bettine von Arnim. Romantik - Revolution - Utopie, Wilhelm Heyne Verlag, München 1969 Duby, Georges / Perrot, Michelle (Hg.): Geschichte der Frauen, 5 Bde., zit. Ausgabe Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1997 Echo. Berliner Musik-Zeitung, Verlag Schlesinger, Berlin 1851 ff. Edler, Arnfried: Robert Schumann und seine Zeit, Laaber Verlag, Laaber 1982 Ders.: Klavierschulen um 1800 als Quelle zur musikalischen Mentalitätsgeschichte, in: Musikalische Quellen - Quellen zur Musikgeschichte. Festschrift für Martin Staehelin, in Verbindung mit Jürgen Heidrich und Hans Joachim Marx hg. v. Ulrich Konrad, Vandhoeck Sc Ruprecht, Göttingen 2002, S. 391-404 »Ein Bild von Erz und Stein«.. Kaiser Wilhelm am Deutschen Eck und die Nationaldenkmäler, Katalog zur Ausstellung im Mittelrhein-Museum Koblenz 1997, hg. v. Klaus Weschenfelder, Görres-Verlag, Koblenz 1997 Engelmann, Carl Friedrich/Holle, Marie: Neues einfaches Kochbuch für bürgerliche Haushaltungen und bürgerliche Küchenzettel für Hausfrauen des Mittelstandes, Aus dem Gebrauch von Clara Schumann, Reprint, hg. v. Robert-Schumann-Haus Zwickau in Verbindung mit der RobertSchumann-Gesellschaft Zwickau, Zwickau 2000
510
Anhang
Enzensberger, Hans Magnus: Requiem für eine romantische Frau. Die Geschichte von Auguste Bußmann und Clemens Brentano. Nach gedruckten und ungedruckten Quellen überliefert, Friedenauer Presse, Berlin 1988 Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hg. v. Jürgen Mittelstraß, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar [1995], unveränderte Sonderausgabe 2004 Esposito, Elena: Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: Paradoxien der Mode, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004 Fashion. Eine Modegeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert. Die Sammlung des Kyoto Costume Institute, 2 Bde., hg. v. Akiko Fukai u.a., Kyoto 2002; dt. Taschen GmbH, Köln 2006 Faulstich, Werner / Körte, Helmut: Der Star. Geschichte - Rezeption - Bedeutung, Wilhelm Fink Verlag, München 1997 Fehrenbach, Elisabeth: Verfassungsstaat und Nationsbildung 1815—1871, Oldenbourg Verlag, München 1992 Fétis, François-Joseph: Biographie Universelle des Musiciens et Bibliographie générale de la musique, 8 Bde. und Supplement, Reprint der Ausgabe 1873, Didot, Paris 1972ff. Feuerbach, Anselm. Katalog, hg. v. der Stiftung Historisches Museum der Pfalz, Speyer, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2002 Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004 Fôldényi, Lazio F.: Heinrich von Kleist. Im Netz der Worter, dt. Matthes Sc Seitz Verlag, München 1999 Frevert, Ute: Geschlechter-Identitäten im deutschen Bürgertum des 19. Jahrhunderts, in: Assmann, Aleida und Friese, Heidrun (Hg.): Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität 3, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, 2 1999, S. 181-216 Fuhrimann, Daniel: „Herzohren fur die Tonkunst". Opern- und Konzertpublikum in der deutschen Literatur des langen 19. Jahrhunderts, Rombach Verlag, Freiburg 2005 Gathy, August: Clara Wieck, in: Neue Zeitschriftfür Musik 1837, S. 54 f. Gatzemeier, Matthias, Art. »Interpretation«, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hg. v. Jürgen Mittelstraß, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar 2004, Bd. 2, S. 273-276 Gay, Peter: Erziehung der Sinne. Sexualität im bürgerlichen Zeitalter [1984], dt. Verlag C. H. Beck, München 1986 Gebhardt, Volker: Das Deutsche in der deutschen Kunst, DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln 2004 Geck, Martin: Zwischen Romantik und Restauration. Musik im Realismus-Diskurs 1848-1871, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart, Weimar 2001 Ders.: Als Praeceptor Germaniae schlägt schlägt Bach Beethoven. Zur politischen Instrumentalisierung von Musikgeschichte im Vormärz, in: »Zu groß, zu unerreichbar«. Bach-Rezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, hg. v. Anselm Hartinger, Christoph Wolff und Peter Wollny, Breitkopf &c Härtel. Wiesbaden, Leipzig, Paris 2007, S. 31-37 Ders. und Schleuning, Peter: „Geschrieben auf Bonaparte". Beethovens JLroica": Revolution, Reaktion, Rezeption, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1989 Geschichte der Weltausstellungen', http://www.expo2000.de/expo2000/geschichte/index.php, eingesehen: 18. April 2008 Gestrich, Andreas: Geschichte der Familie im 19. und 20. Jahrhundert, Verlag Oldenbourg, München 1999 Ders. / Krause, Jens-Uwe / Mitterauer, Michael: Geschichte der Familie, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2003 Goethe, Johann Wolfgang von: Werke. Mit einem Vorwort von Emil Staiger, 6 Bde, Insel Verlag Frankfurt am Main 1970 Goodwin, Noël / Raynor, Henry: Art. »London, § VI: Concert Life«, in: The New Grove Dictionary of Music Csf Musicians, hg. v. Stanley Sadie, McMillian Publishers Limited, London 1980 ff., Bd. 11, S. 181-211
Literaturverzeichnis
511
Gottlieb-Billroth, Otto: Billroth und Brahms im Briefwechsel, Urban und Schwarzenberg, Berlin und Wien 1935 Gregor-Dellin, Martin: Richard Wagner. Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert, R. Piper 8c Co. Verlag, München Zürich 1980 Grenzboten, eine deutsche Revue fiir Politik, Literatur und öffentliches Leben, Leipzig 1844 Grillparzer, Franz: Grillparzers Werke infünfzehn Teilen, hg. und mit einem Lebensbild versehen von Stefan Hock, Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin etc. o.J. Grimm,Jacob und Wilhelm: Deutsches Worterbuch [1854], Reprint Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1984 Groß, Sabine: Lese-Zeichen. Kognition, Medium und Materialität im Leseprozeß, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994 Grotjahn, Rebecca: Das Konservatorium und die weibliche Bildung, in: Zwischen bürgerlicher Kultur und Akademie. Zur Professionalisierung der Musikausbildung in Stuttgart seit 1857, hg. v. Joachim Kremer und Dörte Schmidt, Edition Argus, Schliengen 2007, S. 147-165 Gruhn, Wilfried: Geschichte der Musikerziehung 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Wolke Verlag, Hofheim 2003 Gumbrecht, Hans Ulrich: Die Macht der Philologie, [2002] dt. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003 Haas, Angela: Adolf von Hildebrand. Das plastische Portrait, Prestel Verlag, München 1984 Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuauflage Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1990 Hahn, Kathrin: Clara Wieck-Schumanns Begegnungen mit Berlin, in: Clara Schumann 1819-1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf aus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, hg. v. Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 91-105 Hallmark, Rufus E.: Robert und Clara Schumanns Rückert-Lieder op. 37/12 - Zur Geschichte ihrer einzigen gemeinsamen Arbeit, in: Schumann-Studien 3/4, im Auftrag der Robert-SchumannGesellschaft Zwickau hg. v. Gerd Nauhaus, Studio. Verlag Dr. Gisela Schewe, Köln 1994, S. 270-290 Hamann, Brigitte: Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators, Piper Verlag, München, Zürich 1996 Dies.: Die Familie Wagner, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2005 Hamann, Richard / Hermand, Jost: Gründerzeit, Akademie-Verlag Berlin 1965 Hamburger Musikalische Zeitung, Schuberth und Niemeyer, Hamburg 1837fF. Hand, Ferdinand: Aesthetik der Tonkunst, 2 Bde, Leipzig 1837, Jena 1841 Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. Wolfgang Zorn, Klett Verlag, Stuttgart 1976 Hanslick, Eduard: Aus meinem Leben [1894], mit einem Nachwort hg. v. Peter Wapnewski, Bärenreiter Verlag, Kassel etc. 1987 Ders.: Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre 1870-1885, Nachdruck Gregg International Publishers Ltd, Westmead, Famborough, Hants, 1971 Ders.: Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe, Bd. 1,4, hg. und kommentiert v. Dietmar Strauß; Bd. 1,5, hg. und kommentiert v. Dietmar Strauß, unter Mitarbeit v. Bonnie Lomnäs, mit einem Essay von Markus Gärtner, Böhlau-Verlag, Wien, Köln, Weimar, 2002 und 2005 Ders: Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst [1854] hg. und kommentiert v. Dietmar Strauß, 2 Bde., Schott Verlag, Mainz etc. 1990 Hanson, Alice M.: Die zensurierte Muse. Musikleben im Wiener Biedermeier [1985], dt. Böhlau Verlag Wien, Köln, Graz 1987
512
Anhang
Hausen, Karin: »... eine Ulmefür das schwankende Efeu*. Ehefaaare im deutschen Bildungsbürgertum, in: Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, hg. v. Ute Frevert, Vandenhoeck 8c Ruprecht, Göttingen 1988, S. 85-117 Heine, Heinrich: Sämtliche Werke, 4 Bde, Winkler Verlag München 1969 Held, Wolfgang: Manches geht in Nacht verloren. Die Geschichte von Clara und Robert Schumann, Europäische Verlagsanstalt/Rotbuch Verlag, Hamburg 1998 Ders.: Traum vom Hungerturm, Urs Engeler Editor, Basel/Weil am Rhein 2007 Heller, Eva: Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative Farbgestaltung, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1989, 3 2006 Hensel, Sebastian: Die Familie Mendelssohn 1729-1847,2 Bde., 15. Aufl., Behr, Berlin 1908 Hermstrüwer, Inge und Krusejoseph A.:»Treue Freunde sind gar selten...«Aus Briefen Clara Schumanns an ihre Tochter Elise Sommerhoff, in: Clara Schumann 1819—1896, Katalog zur Ausstellung , hg. v. Bodsch, Ingrid / Nauhaus, Gerd, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 171-177 Herttrich, Ernst: Schumann und Geibel, in: Schumann und seine Dichter, hg. v. Matthias Wendt, Schott Verlag, Mainz etc. 1993, S. 122-131 (Schumann-Forschungen Bd. 4) Hinrichsen, Hans-Joachim: Musikalische Interpretation. Hans von Bülow, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden und Stuttgart 1999 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft Bd.XLVI) Hirschbach, Herrmann: Musikalisch-kritisches Repertorium aller neuen Erscheinungen im Gebiete der Tonkunst, Whistling, Leipzig 1844ff. HofFmann, Freia: Instrument und Körper. Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1991 Hofmann, Renate: Johannes Brahms im Spiegel der Korrespondenz Clara Schumanns, in: Brahms und seine Zeit, Symposium Hamburg 1983, hg. v. Constantin Floros, Laaber Verlag, Laaber 1984, S. 45—58 (Hamburger Jahrbuch zur Musikwissenschaft Bd. 7) Dies.: Clara Schumann und ihre Söhne, in: Schumann-Studien 6, hg. von Gerd Nauhaus, StudioVerlag, Sinzig 1997, S. 27-40 Dies, und Hofmann, Kurt: Johannes Brahms als Pianist und Dirigent. Chronologie seines Wirkens als Interpret, Hans Schneider, Tutzing 2006 Hofmann, Werner (Hg.): Luther und die Folgen für die Kunst, Katalog der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, Prestel-Verlag, München 1983 Hohendahl, Peter Uwe: Literarische Kultur im Zeitalter des Liberalismus: 1830-1870, C. H. Beck Verlag, München 1985 Hohenemser, Richard: Clara Schumann als Komponistin, in: Die Musik 5,1905/06, S. 113—126, S. 166-173 Honegger, Claudia: » Weiblichkeit als Kulturform«. Zur Codierung der Geschlechter in der Moderne, in: Kultur und Gesellschaft. Verhandlungen des 24. Deutschen Soziologentags [...] Zürich 1988, hg. v. Max Haller u. a., Campus Verlag Frankfurt/New York 1989, S. 142-164 Dies.: Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib 1750-1850, Frankfurt 1991, zit., Ausg. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1996 Horstmann, Angelika: Untersuchungen zur Brahms-Rezeption der Jahre 1860-1880, Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, Hamburg 1986 Hudemann-Simon, Calixte: Die Eroberung der Gesundheit 1750-1900, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2000 Iris im Gebiet der Tonkunst, Redaktion Ludwig Reilstab, verlegt bei Trautwein, Berlin 1830ff. Jacobsen, Christiane (Hg.), Bozarth, George S. (Mitarb.): Johannes Brahms. Leben und Werk, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1983 Jansen, Gustav Friedrich (Hg.): Robert Schumanns Briefe - N[eue] Ffolge], Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 2 1904 Jenner, Gustav: Johannes Brahms als Mensch, Lehrer und Künstler. Studien und Erlebnisse, N D der zweiten Auflage, Wollenweber, Gräfelfing bei München 1989
Literaturverzeichnis
513
Joachim, Joseph: Briefe von und an Joseph Joachim. 1842-1907. In 3 Bänden, hg. von Johannes Joachim/Andreas Moser, verlegt von Julius Bard, BerÜn 1911ff. Joss, Victor: Der Musikpädagoge Friedrich Wieck und seine Familie, Verlag Oscar Damm, Dresden 1912 Kabisch, Thomas: Konservativ gegen Neudeutsch, oder: Was heißt >außermusikalisch«?, in: Funkkolleg Musikgeschichte. Europäische Musik vom 12.-20. Jahrhundert, Wiss. Ltg.: Carl Dahlhaus, Ludwig Finscher, Giselher Schubert, Michael Zimmermann, Ulrich Mosch, hg. v. Deutschen Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen, Beltz Verlag Weinheim und Basel, Musikverlag B. Schotts Söhne,Mainz 1988, Studienbegleitbrief 8, S. 55-109 Kalbeck, Max: Johannes Brahms, 4 Bde, Deutsche Brahms Gesellschaft, Berlin 1904 ff. Kandeler, Riklef: Symbolik der Pflanzen und Farben. Botanische Kunst- und Kulturgeschichte in Beispielen, Verlag der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Osterreich, W i e n 2003 Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte ästhetischer Kanonbildung, hg. v. Renate v. Heydebrand, Metzler Stuttgart, Weimar 1998 Kawohl, Friedemann: Urheberrecht der Musik in Preussen (1820-1840), verlegt bei Hans Schneider, Tutzing 2002 Keil, Ulrike Brigitte: Luise Adolpha Le Beau und ihre Zeit. Untersuchungen zu ihrem Kammermusikstil zwischen Traditionalismus und »Neudeutscher Schule*, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main u.a., 1996 Kemp, Anthony: Neuere Forschungen zur Musikerpersönlichkeit, in: Musikpsychologie, Jahrbuch der deutschen Gesellschaftfür Musikpsychologie Bd. 15, hg. v. Klaus-Ernst Behne, Günter Kleinen, Helga de la Motte-Haber, Hogrefe, Verlag für Psychologie, Göttingen u. a. 2000, S. 9 - 2 8 Klassen, Janina: Clara Wieck-Schumann. Die Virtuosin als Komponistin. Studien zu ihrem Werk, Bärenreiter, Kassel u. a. 1990 (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft, Bd. 37) Dies.: Parzengesang, in: Rezeption als Innovation. Untersuchungen zu einem Grundmodell europäischer Kompositionsgeschichte, Festschrift für Friedhelm Krummacher zum 65. Geburtstag, hg. v. Bernd Sponheuer, Siegfried Oechsle, Helmut Well, Mitarbeit: Signe Rotter, Bärenreiter Verlag, Kassel etc. 2001, S. 323-335 Dies.: Beethoven und etwas von Schumann, in: Musiktheorie, Zeitschrift für Musikwissenschaft 1, 2006, S. 57-68 Dies.: Von Vor- und Übervätern. Familiäre und musikalische Genealogien im Selbstkonzept der Mendelssohns, Schumanns und ihrer Zeitgenossen, in: „Zu groß, zu unerreichbar'. Bach-Rezeption im Zeitalter Mendelssohns und Schumanns, hg. v. Anselm Hartinger, Christoph Wolff und Peter Wollny, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, Leipzig, Paris 2007, S. 51-58 Dies.: Art. »Clara W i e c k Schumann«, in: http://www.mugi.hfmt-hamburg.de, 2008 Dies.: Romantisches Lied und Gefühlsdiskurs. Clara Schumanns Lyrikvertonungen, in: Ton und Text, hg. v. Günter Schnitzler, Achim Aurnhammer, Rombach Verlag, Freiburg 2009 Kleefeld, Wilhelm: Clara Schumann, Velhagen 8c Klasing, Bielefeld und Leipzig 1910 Klein, Christian (Hg.): Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen Schreibens, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart, Weimar 2002 Kleinertz, Rainer: Zum Begriff >Neudeutsche Schulet, in: Altenburg, Detlef (Hg.): Liszt und die Neudeutsche Schule, Laaber-Verlag, Laaber 2006, S. 9 - 2 2 Klinger, Max. Auf der Suche nach dem neuen Menschen. Ausstellungskatalog, hg. v. Ursel Berger, Conny Dietrich, Ina Gayk, E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2007 Knechtges-Obrecht, Irmgard: Clara Schumann in Düsseldorf, in: Clara Schumann 1819-1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf aus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, hg. v. Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 189-229
514
Anhang
Knigge, Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr von: Über den Umgang mit Menschen, 2 Bde, Leipzig 1788, zit. Ausg. Nachdruck in einem Band, Bechtermünz, Augsburg 2003 Koch, Paul-August: Clara Wieck-Schumann (1819-1896): Kompositionen: Eine Zusammenstellung der Werke, Literatur und Schallplatten, Zimmermann, Frankfurt a. Main 1991 Kocka, Jürgen (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, 4Teile, Klett-Cotta, Stuttgart 1985 Köckritz, Cathleen: »So strebe darnach ein hehrer Ersten Ranges zu werden« - Die beginnende Unterrichtstätigkeit Friedrich Wiecks, in: Clara Schumann. Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone, hg. v. Peter Ackermann, Herbert Schneider, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York 1999, S. 151-163 Dies.: Friedrich Wieck - ein Klavierpädagoge im Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Studien zur Biographie und zur Klavierpädagogik, Georg Olms Verlag, Hildesheim etc. 2007 Köhler, Hans Joachim: Alltag und Kunst. Das Domizil der Schumanns in der Leipziger Inselstraße, Verlag Klaus-Jürgen Kamprad, Altenburg 2004 Köhler, Louis: Aus den Werdejahren der neudeutschen Musik. Louis Köhlers Erinnerungen und Schriften. In Auswahl herausgegeben von Erwin Kroll, Druck und Verlag der Königsberger Hartungschen Zeitung, Königsberg 1933 Koiwa, Shinji: Das Klavierkonzert um 1830. Studien zurformalen Disposition, Studio Verlag, Sinzig 2003 Konoid, Wulf: Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Zeit, Laaber Verlag, Laaber 1984 Kopiez, Reinhard: Virtuosität als Ergebnis psychomotorischer Optimierung, in: Musikalische Virtuosität, hg. v. Heinz von Loesch, Ulrich Mahlert und Peter Rummenhöller, Schott Verlag, Mainz etc. 2004, S. 205-231 Ders.: Experimentelle Interpretationsforschung, in: Motte-Haber, Helga de la, und Rötter, Günther (Hg.): Musikpsychologie, Laaber Verlag, Laaber 2005, S. 459-514 Ders., Lehmann, Andreas C., Klassen, Janina: Clara Schumanns collection of playbills: A historiometric analysis of life-span development, mobility, and repertoire canonization, in: Poetics 37, 2009, S. 50-73 Koselleck, Reinhart (Hg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Teil II, Klett-Cotta, Stuttgart 1990 Kramer, Lawrence: Why classical music still matters, University of Califormia Press, Berkeley 2007 Kreisig, Martin: Ein Blick in die Clara Schumann-Ausstellung im Schumann-Museum zu Zwickau, in: Neue Zeitschriftfür Musik 1919, S. 229 f. Kühn, Dieter: Familientreffen. Schauspiel, Sterz - Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kulturpolitik 42a, Graz 1988 Ders.: Clara Schumann. Klavier. Ein Lebensbuch, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1996 Kühnen, Barbara: Ist die Soldat nicht ein ganzer Kerl? Die Geigerin Marie Soldat-Roeger (1863— 1955), in: Ich fahre in mein liebes Wien. Clara Schumann — Fakten, Bilder, Projektionen, hg. v. Elena Ostleitner und Ursula Simek, Locker Verlag, Wien 1996, S. 137-150 Lakoff, George / Johnson, Mark: Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern [1980], dt. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg 3 2003 Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud [1990], Campus Verlag, Frankfurt/New York 1992 Lara, Adelina de: Clara Schumanns Teaching, in: Music and Letters 26,1945, S. 143-147 Lehmann, Andreas C.: Musikalischer Fertigkeitserwerb (Expertisierung): Theorie und Befunde, in: Motte-Haber, Helga de la, und Rötter, Günther (Hg.): Musikpsychologie, Laaber Verlag, Laaber 2005, S. 568-599 Lindeman, Stephan D.: Structural Novelty and Tradition in the Early Romantic Piano Concerto, Pendragon Press Stuyvesant, New York 1999
Literaturverzeichnis
515
Link, Jürgen, Wülfing, Wulf (Hg.): Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen. Fallstudien zum Verhältnis von elementarem Wissen und Literatur im 19. Jahrhundert, Klett-Cotta, Stuttgart 1984 Link, Jürgen, Wülfing, Wulf (Hg.): Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität, Stuttgart 1991. Liszt, Franz: Sämtliche Schriften, hg. v. Detlef Altenburg, Bd. 1: Frühe Schriften, hg. v. Rainer Kleinertz, Breitkopf Sc Härtel, Wiesbaden, Leipzig, Paris 2000; Bd. 3: Die Goethe-Stiftung, hg. v. Detlef Altenburg und Britta Schilling-Wang, Breitkopf Sc Härtel, Wiesbaden, Leipzig, Paris 1997 Ders.: Schriften zur Tonkunst, Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1981 Loesch, Heinz von: Robert Schumann. Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129, Wilhelm Fink Verlag, München 1998 (Meisterwerke der Musik 64) Loock, Reinhard: Art.: »Schweben«, in: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. v. Ralf Konersmann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, S. 355-368 Lossewa, Olga: Marfa Sabinina und ihre Erinnerungen an Clara und Robert Schumann, in: Schumann Studien 6, im Auftrag der Robert-Schumann-Gesellschaft Zwickau hg. v. Gerd Nauhaus, Studio Verlag, Sinzig 1997, S. 195-224 Dies.: Die Russlandreise Clara und Robert Schumanns (1844), unter Mitarbeit von Bernhard R. Appel, Schott Verlag, Mainz etc. 2004 (Schumann-Forschungen Bd. 6) Lucke-Kaminiarz, Irina: Der Allgemeine Deutsche Musikverein und seine Tonkünstlerfeste 1859— 1886, in: Altenburg, Detlef (Hg.): Liszt und die Neudeutsche Schule, Laaber-Verlag, Laaber 2006, S. 221-235 Luckmann, Thomas: Identität, Rolle, Rollendistanz, in: Poetik und Hermeneutik VIII. Identität, hg. V. Odo Marquard und Karlheinz Stierle, München 1979, 2 1996, S. 293-313 Lyschinska, Mary J.: Henriette Schrader-Breymann. Ihr Leben aus Briefen und Tagebüchern zusammengestellt, 2 Bde, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyther Sc Co, Berlin 1922 Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, zit. Ausg. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1994 Lyser, Johann Peter: Clara Wieck, in: Cacilia, eine Zeitschrift für die musikalische Welt, 9. Jg., Verlag der Hof-Musikhandlung von B. Schott's Söhnen, Mainz, Paris, Antwerpen 1833, S. 2 5 1 258 Maase, Kaspar: Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850-1970, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1997 Macdonald, Claudia: Criticai Perception and the Woman Composer: the Early Reception of Piano Concertos by Clara Wieck Schumann and Amy Beach, in: Current Musicology, number 55/ fall 1993, Columbia University, New York 1993, S. 24-55 Macho, Thomas: Art. »Schlafen, Träumen«, in: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. v. Ralf Konersmann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, S. 321-331 Marx, Adolf Bernhard: Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffen, 2 Bände in einem Band, Nachdruck der Ausgabe von 1859, Olms-Verlag, Hildesheim 1979 Ders.: Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke, Berlin 1863 May, Florence: Johannes Brahtns. Die Geschichte seines Lebens, London 1905, zit. Ausg, Matthes Sc Seitz Verlag, München 1983 Fanny Mendelssohn. Ein Portrait in Briefen, hg. von Eva Weissweiler Ullstein Taschenbuch, Frankfurt am Main, Wien, Berlin 1985 Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze — Personen - Grundbegriffe, hg. v. Ansgar Nünning, Verlag J. B. Metzler, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart/Weimar 2001 Meyer-Drawe, Käte / Witte, Egbert: Art. »Bilden«, in: Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. v. Ralf Konersmann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, S. 61-80
516
Anhang
Miller, Norbert: Von Nachtsticken und anderen erzählten Bildern. Mit einer Vorbemerkung von Harald Härtung, hg. v. Markus Bernauer und Gesa Horstmann, Carl Hanser Verlag, München/Wien 2002 Möhrmann, Renate (Hg.): Die Schauspielerin. Zur Kulturgeschichte der -weiblichen Bühnenkunst, Insel Verlag, Franfurt am Main und Leipzig 2000 Moore, Jerrod Northrop: Pupils of Clara Schumann, Booklet Pearl Gemm CDs, Pavilion Records Ltd, Sussex 1991 Mosch, Ulrich: Musikalisches Hören serieller Musik, Pfau-Verlag, Saarbrücken 2004 Motte-Haber, Helga de la: Die Musikerpersönlichkeit und Musikalische Begabung, in: dies, und Rötter, Günther (Hg.): Musikpsychologie, Laaber Verlag, Laaber 2005, S. 515-551,552-567 Musgrave, Michael: The musical l i f e of Chrystal Palace, Cambridge University Press, Cambridge 1995 Nagler, Norbert: Die verspätete Zukunft, in: Franz Liszt, hg. v. Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, edition text + kritik, München 1980, S. 4-41 (Musik-Konzepte 12) Nauhaus, Gerd (Hg.): Robert Schumann Tagebücher Bd. 2, Bd. 3 (= Haushaltbücher I und II), VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1982,1987 Nauhaus, Gerd / Bodsch, Ingrid (Hg.): Clara Schumann 1819-1896: Katalog zur Ausstellung des Stadtmuseums Bonn und des Robert-Schumann-Hauses Zwickau in Verbindung mit dem Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf aus Anlaß des 100. Todestages von Clara Schumann, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996 Ders. / Dies. (Hg.): Zwischen Poesie und Musik. Robert Schumann - früh bis spät. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung, Verlag Stadtmuseum Bonn und Stroemfeld-Verlag, Bonn/ Frankfurt 2006 Ders. / Dies. (Hg.): Clara Schumann, Blumenbuch für Robert 1854-1856, unter Mitarbeit von Ute Bär und Susanna Kosmale, Verlag Stadtmuseum Bonn & Stroemfeld Verlag, BonnFrankfurt-Basel 2006 Nauhaus, Gerd, / Reich, Nancy B. (Hg.): Clara Schumann. Jugendtagebücher (1828-1840), DZsch, Archiv-Nr. 4877,1-4-A3 (Druck in Vorb.) Nauhaus, Julia M.: Art. »Clara Schumann«, in: Ingrid Bodsch/fulia M . Nauhaus: http://www. Schumann-Portal.de/pgcms/, eingesehen 8. Oktober 2008 Dies.: »...vergnügter Abend bei Methfessel« - Clara Wieck Schumanns Konzerte in Braunschweig (in Druck) Nautsch, Hans: Friedrich Kalkbrenner. Wirkung und Werk, Verlag Karl Dieter Wagner, Hamburg 1983 Neue Berliner Musikzeitung, Bote & Bock, Berlin 1847ff. Niederrheinische Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler, DuMont-Schauberg, Köln 1853 ff. Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte, 3 Bde, München 1983; zit. Ausg. 1998 Novalis [Friedrich von Hardenberg]: Schriften. 3 Bde, hg. v.Joachim Mahl und Richard Samuel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1999 Öffentlichkeit - Geschichte eines kritischen B e g r i f f s , hg. v. Peter Uwe Hohendahl, Mitarbeit Russell A. Berman, Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar 2000 Ostleitner, Elena/Simek, Ursula (Hg.): Ich fahre in mein liebes Wien. Clara Schumann - Fakten, Bilder, Projektionen, Locker Verlag, Wien 1996 (Frauentöne, Band 3) Otto, Frank: Die Entstehung eines nationalen Geldes. Integrationsprozesse der deutschen Währungen im 19. Jahrhundert, Duncker & Humblot, Berlin 2002 Ozawa-Müller, Kazuko: Clara Schumann und Wilhelmine Schröder-Devrient, in: Clara Schumann 1819-1896, Katalog zur Ausstellung, hg. v. Bodsch, Ingrid / Nauhaus, Gerd, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 179-186 Parr, Rolf: »Zwei Seelen wohnnen, ach! in meiner Brust!« Strukturen und Funktionen der Mythisierung Bismarcks (1860-1918), Wilhelm Fink Verlag, München 1992
Literaturverzeichnis
517
Peters, Birgit: Prominenz. Eine soziologische Analyse ihrer Entstehung und Wirkung, Westdeutscher Verlag Opladen 1996 Pinto, Louis: Feldtheorie und Literatursoziologie. Überlegungen zu den Arbeiten von Pierre Bourdieu, in: ders. und Franz Schultheis (Hg.): Streifzüge durch das literarische Feld, UVK. Universitätsverlag, Konstanz 1997, S. 9-32 Der große Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte. Daten, Fakten, Zusammenhänge, begründet von Dr. Carl Ploetz, 32., neu bearbeitete Auflage, bearbeitet von 80 Fachwissenschaftlern, zit. Ausg. Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1998 Popularisierung und Popularität, hg. v. Gereon Blaseio, Hedwig Pompe, Jens Ruchatz, DuMont Verlag, Köln 2005 Preiß, Friederike: Der Prozeß. Clara und Robert Schumanns Kontroverse mit Friedrich Wieck, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2004 Ramann, Lina (Hg.): Franz Liszt, Gesammelte Schriften, 6 Bde, Verlag Breitkopf Sc Härtel, Leipzig 1880ff. Regeln der Bedeutung. Zur Theorie der Bedeutung literarischer Texte, hg. v. Fotis Jannidis, Gerhard Lauer, Matías Martínez, Simone Winko, Walter de Gruyter, Berlin, New York 2003 Reich, Nancy B.: Clara Schumann. The Artist and the Woman, Cornell University Press, Ithaca, London 1985; dt. Rowohlt Verlag, Reinbek 1991 Dies.: Women as Musicians: A Question of Class, in: Solie, Ruth A. (Hg.): Musicology and Difference. Gender and Sexuality in Music Scolarship, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1993; Paperbackprint 1995, S. 125-146 Dies.: Clara Schumann and America, in: Ackermann, Peter/ Schneider, Herbert (Hg.): Clara Schumann - Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone: Bericht über die Tagung anlässlich ihres 100. Todestages veranstaltet von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und dem Hochschen Konservatorium in Frankfurt am Main, Olms, Hildesheim, Zürich, New York 1999 (Musikwissenschaftliche Publikationen, Bd. 12), S. 195-203 Dies.: Robert Schumanns Music in New York City, 1848-1898, in: Schumanniana nova. Festschrift Gerd Nauhaus zum 60. Geburtstag, hg. v. Bernhard R. Appel, Ute Bär, Mathias Wendt, Studio Verlag, Sinzig 2002, S. 569-595 Reichholf, Josef H.: Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007 Reiser, Salome: Mendelssohns »Lobgesang« und das Problem der Fassungen, in: Meisterwerke — gefasst! Beiträge des Leipziger Mendelssohn-Symposiums » Wissenschaft und Praxis« am 1. September 2005, hg. v. Gewandhaus zu Leipzig und der Internationalen Mendelssohn-Stiftung e.V., Leipzig 2005, S. 47-61 Riedel, Manfred: Art. »Historismus«, in: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, hg. v. Jürgen Mittelstraß, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar [1995], unveränderte Sonderausgabe 2004, S. 113-116 Rieger, Eva: Vom »genuin Weiblichem zur »Geschlechter-Differenz*. Methodologische Probleme der Frauen- und Geschlechterforschung am Beispiel Clara Schumanns, in: Ackermann, Peter/ Schneider, Herbert (Hg.): Clara Schumann - Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone: Bericht über die Tagung anlässlich ihres 100. Todestages veranstaltet von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und dem Hochschen Konservatorium in Frankfurt am Main, Olms, Hildesheim, Zürich, New York 1999, S. 205-216 Dies. (Hg.): Mit 1000 Küssen, Deine Fillu. Briefe der Sängerin Marie Fillunger an Eugenie Schumann, 1875-92, Dittrich Verlag, Köln 2002 Dies, und Niberle, Sigrid: Frauenforschung. Geschlechterforschung und (post-) feministische Erkenntnisinteressen: Entwicklungen der Musikwissenschaft, in: Bußmann, Hadumod und Hof, Renate (Hg.): Genus. Geschlechterforschung/Gender Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 2005, S. 262-294
518
Anhang
Dies, und Steegmann, Monica (Hg.): Frauen mit Flügel. Lebensberichte berühmter Pianistinnen. Von Clara Schumann bis Clara Haskil, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1996 Rieger, Matthias: Heimholte Musicus. Die Objektivierung der Musik im 19. Jahrhundert durch Heimholte' Lehre von den Tonempfindungen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006 Riemann, Hugo: Musik-Lexikon, Verlag des Bibliographischen Instituts Leipzig 1882, zweite, vermehrte Ausgabe 1884 Rietschel, Ernst (1804-1861). Zum 200. Todestag des Bildhauers, hg. v. Bärbel Stephan, Deutscher Kunstverlag, München-Berlin 2004 Ritterman, Janet: „Gegensätze, Ecken und scharfe Kanten". Clara Schumanns Besuche in England, 1856-1888, in: Clara Schumann 1819-1896, Katalog zur Ausstellung, hg. v. Bodsch, Ingrid/ Nauhaus, Gerd, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 235-261 Roselt, Jens (Hg.): Seelen mit Methode. Schausfieltheorien vom Barock- bis zum postdramatischen Theater, Alexander Verlag, Berlin 2005 Rössler, Patrick: Inhaltsanalyse, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2005 Rötter, Günther: Ist der »Beitrag zur Klassifikation musikalischer Rhythmen« von Helga de la Motte-Haber heute noch von Bedeutung? in: Musikwissenschaft zwischen Kunst, Ästhetik und Experiment, Festschrift Helga de la Motte-Haber zum 60. Geburtstag, hg. v. Kopiez, Gembris, Kloppenburg, von Loesch, Neuhoff, Rötter, Schmidt, Könighausen 8c Neumann, Würzburg 1998, S. 465-473 Sand, George: Briefe. M i t zahlreichen Abbildungen. Aus dem Französischen übersetzt und herausgegeben von Annedore Haberl, Deutscher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1990, zit. Ausg. 2003 Sandkühler, Thomas / Schmidt, Hans-Günter: Frau oder Geschichte? Zur historischen Kontinuität einer verkehrten Alternative, in: Weiblichkeit in geschichtlicher Perspektive, hg. v. Ursula A. J. Becher und Jörn Rüsen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988, S. 339-363 Schabert, Ina: Englische Literaturgeschichte aus der Sicht der Geschlechterforschung, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1997 Schilling, Gustav: Art. »Wiek, Clara«, in: ders. (Hg.): Enzyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst, 6 Bde., F. H. Köhler, Stuttgart 1835-38 Schiller, Friedrich: Sämtliche Werke in 5 Bänden, auf der Grundlage der Textedition von Herbert G. Göpfert hg. v. Peter-André Alt, Albert Meier und Wolfgang Riedel, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004 Schiwietz, Lucian Felix: Johann Peter Pixis. Beiträge zu seiner Biographie, zur Rezeptionshistoriographie seiner Werke und Analyse seiner Sonatenform, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1994 Schlegel, Friedrich: Werke in zwei Bänden, hg. von den nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar, Aufbau-Verlag, Weimar und Berlin 1980 Ders.: Theorie der Weiblichkeit [1799], hg. und mit einem Nachwort versehen von Winfried Menninghaus, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1983 Schlemmer, Mirjam: »War es nicht Zeit, dass wir nach Berlin gingen, um mit einem Schlag in ganz Europa groß dazustehenDie ersten Berliner Konzertjahre, in: Clara Schumann 1819—1896, Katalog zur Ausstellung , hg. v. Bodsch, Ingrid/ Nauhaus, Gerd, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 73-85 Schmidt, Christian Martin: Johannes Brahms und seine Zeit, Laaber Verlag, Laaber 1983 Schmidt, Friedrich: Das Musikleben der bürgerlichen Gesellschaft Leipzigs im Vormärz (18151848), Beyer Verlag, Langensalza 1912 Schmidt, Jochen: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945, 2 Bde, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2 1988
Literaturverzeichnis
519
Schütze, Yvonne: Mutterliebe - Vaterliebe. Elternrollen in der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts, in: Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, hg. v. Ute Frevert, Vandenhoeck 8c Ruprecht, Göttingen 1988, S. 118-133 Schulte, Regina (Hg.): Der Körper der Königin. Geschlecht und Herrschaft in der höfischen Welt seit 1500, Campus Verlag, Frankfurt / New York 2002 Schultz, Hartwig: Schwarzer Schmetterling. Zwanzig Kapitel aus dem Leben des romantischen Dichters Clemens Brentano, Berliner Taschenbuch Verlag , Berlin 2002 Schulze, Hagen: Staat und Nation in der europäischen Geschichte, Verlag C. H. Beck, München 1999 Ders.: Kleine deutsche Geschichte, erweiterte und aktualisierte Sonderausgabe, Verlag C. H. Beck, München 2007 Clara Schumann, Blumenbuch für Robert 1854—1856, hg. v. Gerd Nauhaus und Ingrid Bodsch, unter Mitarbeit von Ute Bär und Susanna Kosmale, Verlag Stadtmuseum Bonn 8c Stroemfeld Verlag, Bonn-Frankfurt-Basel 2006 Clara Schumann 1819—1896, Katalog zur Ausstellung, hg. v. Bodsch, Ingrid/ Nauhaus, Gerd, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996 Clara Schumanns Briefe an Theodor Kirchner. Mit einer Lebenssiizze des Komponisten, hg. von Renate Hofmann, Hans Schneider Verlag GmbH,Tutzing 1997 Clara Schumann - Johannes Brahms: Briefe aus den Jahren 1853—1896, hg. von Berthold Litzmann, 2 Bde., Breitkopf und Härtel, Leipzig 1927 Clara und Robert Schumann. Briefwechsel, kritische Gesamtausgabe, hg. von Eva Weissweiler unter Mitarbeit von Susanne Ludwig, 3 Bde., Stroemfeld / Roter Stern, Basel/Frankfurt am Main 1984,1987,2001 Schumann, Clara: Jugendtagebücher, s. Wieck, Clara und Friedrich Schumann, Eugenie: Erinnerungen,}. Engelhorns Nachfolger, Stuttgart 1925 Schumann, Ferdinand: Erinnerungen an Clara Schumann, in: NZfM 1917, S. 69-104 Ders.: Aus dem Apothekerhaus. Ferdinand Schumann an Musikdirektor Kurt Barth, Zuschriften aus den Jahren 1941-1954, hg. v. Gerd Nauhaus, Veröffentlichungen des Robert-SchumannHauses, Zwickau 2004 Schumann, Robert: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker [1854], 2 Bde., fünfte Auflage, hg. v. Martin Kreisig, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1914 Schumann, Robert, Interpretationen seiner Werke, 2 Bde, hg. v. Helmut Loos, Laaber-Verlag, Laaber 2005 Ders.: Tagebücher, 1, hg. v. Georg Eismann; 2, hg. v. Gerd Nauhaus; 3 (= Haushaltbücher I und II), hg. v. Gerd Nauhaus, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1971,1987,1982 Schumanniana nova. Festschrift Gerd Nauhaus zum 60. Geburtstag hg. v. Bernhard R. Appel, Ute Bär, Matthias Wendt, Studio Verlag, Sinzig 2002 Seibold, Wolfgang: Robert und Clara Schumann in ihren Beziehungen zu Franz Liszt, 2 Bde., Lang-Verlag, Frankfurt am Main u.a. 2005 Semper, Gottfried: Wissenschaft, Industrie und Kunst und andere Schriften über Architektur, Kunsthandwerk und Kunstunterricht [1834-1869], mit einem Aufsatz von Wilhelm Mrazek, ausgewählt und redigiert von Hans M. Wingler, Florian Kupferberg Verlag, Mainz 1966 Sennett, Richard: Verfall und Elend des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität [1974], S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 14. Aufl. 2004 Signale für die musikalische Welt, Verlag SenfF, Leipzig 1843 ff. Smyth, Ethel: Ein stürmischer Winter. Erinnerungen einer streitbaren englischen Komponistin, dt. von Michaela Huber, hg. von Eva Rieger, Bärenreiter Verlag, Kassel, Basel 1988 Sontag, Susan: Krankheit als Metapher, zit. Ausg. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1993
520
Anhang
Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch I, Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes 1815-1870, hg. v. Wolfram Fischer, Jochen Krengel und Jutta Wietog, Verlag C. H. Beck, München 1982 Sponheuer, Bernd: Musik als Kunst und Nicht-Kunst. Untersuchungen zur Dichotomie von ,hoher' und .niederer'Kunst im musikästhetischen Diskurs zwischen Kant und Hegel, Bärenreiter Verlag, Kassel etc. 1987 (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft Bd. 30) Ders.: Über das Deutsche in der Musik. Versuch einer idealtypischen Rekonstruktion, in: Deutsche Meister - böse Geister? Nationale Findung in der Musik, in Zusammenarbeit mit der Staatsoper Unter den Linden hg. v. Hermann Danuser und Herfried Münkler, Edition Argus, Schliengen 2001, S. 123-150 Steegmann, Monica (Hg): »... daß Gott mir ein Talent geschenkt*. Clara Schumanns Briefe an Hermann Härtel und Richard und Helene Schöne, Atlantis-Musikbuch-Verlag, Zürich/Mainz 1997 Dies.: Clara Schumann, Rowohlt Verlag, Reinbek 2001 Stephenson, Kurt: Clara Schumann 1819-1896, Inter Nationes, Bonn, Bad Godesberg 1969 Strauß, Dietmar: Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik in der Tonkunst, Teill: Historisch-kritische Ausgabe,Teil II: EduardHanslicks Schrift in textkritischer Sicht, Schott Verlag, Mainz etc. 1990 Struck, Michael: Die umstrittenen späten Instrumentalwerke Robert Schumanns, Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner, Hamburg 1984 (Hamburger Beiträge zur Musikwissenschaft 29) Ders: Manuskripte mit Frage- und Ausrufezeichen. Die Clara Wieck zugeschriebenen Werke aus dem Familienarchiv Ave-Lallement, in: Musikhandschriften und Briefe aus dem Familienarchiv AveLallemant, hg. v. der Kulturstiftung der Länder in Verbindung mit dem Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck, Dräger Druck GmbH, Lübeck 2001, S. 33-43 Ders.: Träumerei und zahl-lose Probleme. Zur leidigen Tempofrage in Schumanns Kinderscenen, in: Schumanniana nova. Festschrift Gerd Nauhaus zum 60. Geburtstag, hg. v. Bernhard R. Appel, Ute Bär, Matthias Wendt, Studio Verlag, Sinzig 2002, S. 698-738 Sturm, Hermann: Alltag Ü" Kult. Gottfried Semper, Richard Wagner, Friedrich Theodor Vischer, Gottfried Keller, Birkhäuser-Verlag für Architektur, Basel, Boston, Berlin 2003 Synofeik, Thomas: Heinrich Heine - Robert Schumann. Musik und Ironie, Verlag Christoph Dohr, Köln 2006 Ders.: Zur Familiengeschichte Robert Schumanns, Vortrag 2008 (in Druck) Ders. und Voigt, Jochen (Hg.): Aus Clara Schumanns Fotoalben: photographische Cartes de Visite aus der Sammlung des Robert-Schumann-Hauses Zwickau, Edition Mobiiis, Chemnitz 2006 Tadday, Ulrich: Das schöne Unendliche. Ästhetik, Kritik, Geschichte der romantischen Musikanschauung, Metzler Verlag, Stuttgart und Weimar 1999 Ders.: Art. »Reilstab«, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, völlig neu bearbeitete Ausgabe, hg. v. Ludwig Finscher, Bärenreiter Verlag, Kassel etc. 2005, Bd. 13, Sp. 1546-1548 Titzmann, Michael: Die Konzeption der »Germanen« in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, in: Link, Jürgen, Wülfing, Wulf (Hg.): Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität, Stuttgart 1991, S. 120-145. Todd, Larry R: »Ein wenigstill und scheu* —Clara Wieck/Schumann as Colleague ofFelix Mendelssohn Bartholdy, in: Schumanniana nova. Festschriftfür Gerd Nauhaus zum 60. Geburtstag, hg. v. Bernhard R. Appel, Ute Bär, Matthias Wendt, Studio Verlag, Sinzig 2002, S. 767-784 Trapp, Eduard und Pinzke, Hermann: Das Bewegungsspiel. Seine geschichtliche Entwickelung, sein Wert und seine methodische Behandlung, nebst einer Sammlung von über 200 ausgewählten Spielen und 25 Abzählreimen, Böck & Kübler, Woltersdorf bei Berlin 1885, Reprint 1990
Literaturverzeichnis
521
Trepp, Anne-Charlott: Sanfte Männlichkeit und selbständige Weiblichkeit. Frauen und Männer im Hamburger Bürgertum zwischen 1770 und 1840 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 123), Vandenhoek &. Rupprecht, Göttingen 1996 Twiehaus, Stephanie: Zwischen Zeitbild und Fiktion. Zum Clara-Schumann-Bild in der deutschen Belletristik, in: Ackermann, Peter/ Schneider, Herbert (Hg.): Clara Schumann Komponistin, Interpretin, Unternehmerin, Ikone: Bericht über die Tagung anlässlich ihres 100. Todestages veranstaltet von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und dem Hochschen Konservatorium in Frankfurt am Main, Olms, Hildesheim, Zürich, New York 1999, S. 227-242 Uber Brahms. Von Musikern, Dichtern und Liebhabern. Eine Anthologie, hg. v. Renate Hofmann und Kurt Hofmann, Philipp Reclam jun., Stuttgart 1997 Ullrich, Volker: Die nervöse Großmacht 1871-1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs, zit. Ausg. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2007 Vinken, Barbara: Die deutsche Mutter. Der lange Schatten eines Mythos, zit. Ausg. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2007 Vogel, Juliane: Die doppelte Haut. Die Moden der Kaiserinnen im 19. Jahrhundert, in: Schulte, Regina (Hg.): Der Körper der Königin. Geschlecht und Herrschaft in der höfischen Welt seit 1500, Campus Verlag, Frankfurt / New York 2002, S. 216-235 Vossische Zeitung. Königlich privilegierte Berliner Zeitung von Staats- und Gelehrten Sachen, Jg. 1840-1880, Verlag Vossischer Erben, Berlin 1840ff. Vries, Claudia de: Die Pianistin Clara Wieck-Schumann: Interpretation im Spannungsfeld von Tradition und Individualität, Schott Verlag, Mainz u. a. 1996 (Schumann Forschungen Bd. 5) Dies.: »... da war mir ja schon, als habe ich sie verloren ...«. Auf den Spuren von Julie Schumann in Piemonte, in: Schumanniana nova. Festschrift Gerd Nauhaus zum 60. Geburtstag, hg. v. Bernhard R. Appel, Ute Bär, Matthias Wendt, Studio Verlag, Sinzig 2002, S. 149-168 Wagner, Cosima: Die Tagebücher, 2 Bde, ediert und kommentiert von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack, R. Piper & Co. Verlag, München / Zürich 1976 Wagner, Richard: Gesammelte Schriften und Dichtungen in zehn Bänden, hg. von Wolfgang Golther, Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin/Leipzig/Wien/Stuttgart o. J. Walker, Alan: Franz Liszt, 3 Bde, Faber and Faber, London 1983,1989,1997 Was sind Frauen? Was sind Männer? Geschlechtskonstruktionen im historischen Wandel, hg. v. Christiane Eifert u.a., Suhrkamp Verlag, Franfurt am Main 1996 Wasielewski, Wilhelm Joseph von: Robert Schumann. Eine Biographie, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1857, 3 1880 Ders.: Schumanniana [1889], zit. Ausg. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1988 Wehler, Hans-Ulrich: Nationalismus. Geschichte - Formen - Folgen, Verlag C. H. Beck, München 2001 Weinzierl, Stefan: Beethovens Konzerträume. Kaumakustik und symphonische Aufführungspraxis an der Schwelle zum modernen Konzertwesen, Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt am Main 2002 Weber-Kellermann, Ingeborg (Hg.): Die Familie. Eine Kulturgeschichte der Familie, Insel Verlag Leipzig 1976, zit. Ausg. 1996 Weimar, Klaus: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft, U T B Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2003 Weisbrod, Bernd: Die theatralische Monarchie. Victoria als Familiy-Queen, in: Schulte, Regina (Hg.): Der Körper der Königin. Geschlecht und Herrschaft in der höfischen Welt seit 1500, C a m pus Verlag, Frankfurt/New York 2002, S. 236-253 Weissweiler, Eva: Clara Schumann. Eine Biografie, Hoffmann und Campe, Heidelberg 1990 Wendler, Eugen (Hg.): »Das Band der ewigen Liebe«. Clara Schumanns Briefwechsel mit Emilie und Elise List, Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar 1996
522
Anhang
Wendt, Mathilde: Meine Erinnerungen an Clara Schumann, in: Neue Zeitschrift für Musik 1919, S. 232-234 Wendt, Matthias: Albtraum zwischen Trümmern, in: Schumann-Studien 9, hg. v. Gerd Nauhaus und Ute Bär, Sinzig 2008, S. 297-318 Wenzel, Silke: Art. »Emma Brandes«, »Fanny Davies«, »Amina Goodwin«, »Natalie Janotha«, »Mathilde Verne«, in: http://www.mugi.hfmt-hamburg.de, 2007 Westhoff-Krummacher, Hildegard: Als die Frauen noch sanft und engelsgleich waren. Die Sicht der Frau in der Zeit der Aufklärung und des Biedermeier. Westfälisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte Münster, Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Kleins Druck- und Verlagsanstalt Lengerich, Münster 1995 Widmaier, Tobias: Der deutsche Musikalienhandel. Funktion, Bedeutung und Topographie einer Form gewerblicher Musikaliendistribution vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, PfauVerlag, Saarbrücken 1998 Ders.: Diagnose »musikalische Impotenz«. Antimoderne Affekte am Beispiel Hans Ffitzner, in: Puppen, Huren, Roboter. Körper der Moderne in der Musik zwischen 1900 und 1930, hg. v. Sabine Meine und Katharina Hottmann, Edition Argus, Schliengen 2005, S. 82-101 Wieck, Clara und Friedrich: Jugendtagebücher (1828-1840), D-Zsch, Archiv-Nr. 4877,1-4-A3, hg. von Gerd Nauhaus und Nancy B. Reich, Druck in Vorb. Wieck, Friedrich: Briefe aus den Jahren 1830-1838, hg. von Käthe Walch-Schumann, Arno Volk, Köln 1968 (Heft 74) Wieck, Marie: Aus dem Kreise Wieck-Schumann, Pierson, Dresden, Leipzig 1912 Wild, Reiner: Die Vernunft der Väter. Zur Psychographie von Bürgerlichkeit und Aufklärung in Deutschland am Beispiel ihrer Literatur für Kinder, Metzler, Stuttgart 1987 Winko, Simone: Art. »Kanon, literarischer«, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze - Personen - Grundbegriffe, hg. v. Ansgar Nünning, Verlag J. B. Metzler, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage Stuttgart, Weimar 2001 Dies, und Heydebrand, Renate von: Einführung in die Wertung von Literatur, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1996 Winter, Rainer: Der produktive Zuschauer. Medienaneignung als kultureller und ästhetischer Prozeß, Quintessenz M M V Medien Verlag GmbH, München 1995 Wörterbuch der philosophischen Metaphern, hg. v. Ralf Konersmann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007 Wittkowski, Désirée: »In Paris hast Du doppelte Mühe in Allem ... «. Clara Wieck-Schumanns Parisreisen, in: Clara Schumann 1819-1896, Katalog zur Ausstellung, hg. v. Bodsch, Ingrid/ Nauhaus, Gerd, Stadtmuseum Bonn, Bonn 1996, S. 137-169 Wülfing, Wulf: Die heilige Luise von Preußen. Zur Mythisierung einer Figur der Geschichte in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, in: Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen. Fallstudien zum Verhältnis von elementarem Wissen und Literatur im 19. Jahrhundert, hg. v. Jürgen Link und Wulf Wülfing, Klett-Cotta, 1984 (Sprache und Geschichte Bd. 9), S. 233-275 Ders., Bruns, Karin, Parr, Rolf: Historische Mythologie der Deutschen 1798-1918, Wilhelm Fink Verlag, München 1991 Zahlmann, Stefan, Scholz, Sylka (Hg.): Scheitern und Biographie. Die andere Seite moderner Lebensgeschichten, Psychosozial-Verlag, Gießen 2005 Zorn, Wolfgang (Hg.): Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhundert, Klett Verlag, Stuttgart 1976 Zwischen Poesie und Musik. Robert Schumann - früh bis spät. Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung, hg. von Ingrid Bodsch und Gerd Nauhaus, Verlag Stadtmuseum Bonn und Stroemfeld-Verlag, Bonn-Frankfurt 2006
Literaturverzeichnis
523
Werkverzeichnis Klaviermusik Quatre Polonaises op. 1 (1829-1830), Hofmeister, Leipzig 1831 Caprices enforme de valse op. 2 (1831/32), Stoepel, Paris/ Hofmeister, Leipzig 1832 Romance variée C-Dur op. 3 (1831-1833), Richault, Paris/ Hofmeister, Leipzig 1833 Etüde As-Dur (frühe 1830er Jahre; unveröffentlicht) Valses romantiques op. 4 (1835), Whistling, Leipzig 1835 Quatre Pièces caractéristiques op. 5 (1833-1836), Breitkopf &, Härtel, Leipzig. 1836 1. Impromptu: Le Sabbat; 2. Caprice à la Boléro; 3. Romance; 4. Scène fantastique: Ballet des revenants Soirées musicales op. 6 (1834—1836), Hofmeister, Leipzig/Richault, Paris 1836 1. Toccatina; 2. Notturno; 3. Mazurka; 4. Ballade; 5. Mazurka; 6. Polonaise Variations de concert pour le piano-forte sur la cavatine du »Pirate« de Bellini C-Dur op. 8 (1837), Haslinger, Wien 1837 Souvenir de Vienne. Impromptu op. 9 (1838), Diabelli, Wien 1838 Scherzo d-Moll op. 10 (1838), Breitkopf Sc Härtel, Leipzig/Schonenberger, Paris 1838 Trois Romances op. 11 (1838/39), Mechetti, Wien/Richault, Paris 1840 Deuxième Scherzo c-Moll op. 14 (1841), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1845 Sonate g-Moll (1841/42), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1992 Quatre Pièces fugitives op. 15 (1841-1844), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1845 Impromptu E-Dur (um 1844), in: Album du Gaulois, Paris 1885 Drei Präludien und Fugen op. 16 (1845), Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1845 Variationen fur Pianoforte über ein Thema von Robert Schumann fis-Moll op. 20 (1853), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1854 Drei Romanzen op. 21 (1853-1855), Breitkopf & Härtel Leipzig 1855 Romanze a-Moll (1853), 2 Fassungen 1. in: The Girl's Ovm Paper, London 1891; 2. in: Ausgewählte Klavieriuerke G. Henle Verlag, München 1987 Romanze h-Moll (1856), in: Romantische Klaviermusik 2, Verlag Willy Müller, Heidelberg 1977 Marsch Es-Dur für Klavier 2 hd. (1879) (unveröffentlicht) und 4hd. (1891), Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1996 improvisierte Präludien und Vorspiele, (vermud. 1895 notiert), Deutsche Staatsbibliothek Berlin Drei Fugen über Themen von J. S. Bach [=Studien] (1845), Robert-Schumann-Haus, Zwickau Präludium f-Moll [=Studie] (1845), Deutsche Staatsbibliothek Berlin Präludium und Fugenfragment fis-Moll [=Entwurf] (1845), Sächsische Landesbibliothek, Dresden verloren: Walzer (1828); Variationen über ein Originalthema (1830); Variationen über ein Tyrolerlied (1830); Phantasie-Variationen über eine Romanze von Friedrich Wieck An Alexis (1832/33); Rondo h-Moll (1833); Elfentanz (1834), Variationen über ein Thema aus "Hans Meiling* (1834); Drei Impromptus (1835); Scherzi (1835); Bravour-Variationen über das Thema der G-Dur Mazurka op. 6 Nr. 5 (1836); weitere Werke
524
Anhang
Konzerte Premier Concert pour le piano-forte avec accompagnement d'orchestre a-Moll op. 7 (1833—1836), Kl. A. Hofmeister, Leipzig/ Richault, Paris/Cranz, Hamburg 1837; Klavierkonzert f-Moll (1847), Particeli, Fragment, Robert-Schumann-Haus, Zwickau
Kammermusik Trio für Klavier, Violine und Violoncello g-Moll op. 17 (1846), Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1847 Drei Romanzen für Klavier und Violine op. 22 (1853), Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1855
Orchesterwerke Scherzo für Orchester (1833) (verloren) Ouverture für Orchester (1833) (verloren) Valses Romantiques op. 4 (Orchesterfassung 1836; verloren)
Kadenzen Zwei Kadenzen zu Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert G-Dur Nr. 4 op. 58 (1846), RieterBiedermann, Leipzig 1870 Kadenz zu Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert c-Moll Nr. 3 op. 37 (1868), Rieter-Biedermann, Leipzig 1870 Zwei Kadenzen zu Wolfgang Amadeus Mozart, Klavierkonzert d-Moll KV 466, Rieter-Biedermann, Leipzig 1891
Vokalmusik Lieder (wenn nicht anders angegeben, für eine Stimme und Klavier) Zwölf Lieder aus F. Rückerts Liebesfrühling op. 12 (1841), Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1841, (Nr. 2,4 und 11; Nr. 1,3,5-10 und 12 = Robert Schumann op. 37): 1. »Der Himmel hat eine Träne geweint«-, 2. »Er ist gekommen in Sturm und Regen«-, 3. » 0 ihr Herren«; 4. »Liebst Du um Schönheit«; 5. »Ich hat' in mich gesogen«-, 6. »Liebste, was kann denn uns scheiden?« für S und T; 7. »Schön ist das Fest des Lenzes« für dass.; 8. »Flügel' Flügel! um zu fliegen«; 9. »Rose, Meer und Sonne«; 10. »O Sonn', o Meer, o Rose«-, 11. »Warum willst du Andre fragen«-, 12. »So wahr die Sonne scheinet« für S und T Sechs Lieder op. 13 (1840-1843), Breitkopf 8c Härtel, Leipzigl843: 1. »Ich stand in dunklen Träumen« (Heine); 2. »Sie liebten sich beide« (ders.) (1842); 3. Liebeszauber »Die Liebe saß als Nachtigall« (Geibel); 4. »Der Mond kommt still gegangen« (ders.); 5. »Ich hab'in deinem Auge« (Friedrich Rückert); 6. »Die stille Lotosblume« (Geibel) Sechs Lieder aus Jucunde (Hermann Rollett) op. 23 (1853), Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1856: 1. » Was weinst du«-, 2. »An einem lichten Morgen«-, 3. »Geheimes Flüstern«; 4. »Auf einem grünen Hügel«-, 5. »Das ist ein Tag«-, 6. » 0 Lust«
Werkverzeichnis
525
Einzelne Lieder Der Wanderer »Die Straßen, die ich gehe» (Justinus Kerner) (1832?) Der Wanderer in der Sägemühle »Dort unten in der Mühle«, (Juli 1832), [beide zuerst veröffentlicht unter Friedrich Wieck, F.E.C.Leuckart, Leipzig 1875] in: Sämtliche Lieder II, Breitkopf 8t Härtel, Leipzig 1992 Der Abendstern »Bist du denn wirklich so fern« (frühe 1830er Jahre), in: Sämtliche Lieder II, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 Walzer »Horch! welch ein süßes harmonisches Klingen« (Johann Peter Lyser) (um 1833), in: Zehn Lieder eines wandernden Malers, Gustav Schaarschmidt, Leipzig 1834 Am Strande »Traurig schau ich« (Robert Bums, übs. von Wilhelm Gerhard) (1840), in: NZfM 8, Juli 1841, Suppl. 14 Ihr Bildnis »Ich stand in dunklen Träumern (Heine) (1840), in: Sämtliche Lieder II, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 Volkslied »Esfiel ein Reif in der Frühlingsnacht» (ders.) (1840), in: Sämtliche Lieder 11, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 »Die gute Nacht« (Friedrich Rückert) (1841), in: Sämtliche LiederW, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 Lorelei »Ich weiß nicht, was soll das bedeuten« (Heine) (1843), in: Sämtliche Lieder II, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 »Oh weh des Scheidens« (Rückert) (1843), in: Sämtliche Lieder II, 1992 Beim Abschied »Purfurgluten leuchten ferne« (Friederike Serre) (1846), in: Sämtliche Lieder II, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 Mein Stern »Odu mein Stern« (dies.) (1846),engl.als »OThou myStar«, Wessel 8cCo,London 1846 Das Veilchen »Ein Veilchen auf der Wiese stand« (Goethe) (1853), in: Sämtliche Lieder II, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1992 verloren: Der Traum (1831) (Christoph August Tiedge)-, Alte Heimath (1831) (Justinus Kerner); weitere Lieder
Chöre Drei gemischte Chöre (Emanuel Geibel) (1848), Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1 9 8 9 : 1 . A b e n d f e y e r , 2. » Vorwärts«; 3. Gondoliera
Bearbeitungen von Werken Robert Schumanns Klavierquintett Es-Dur op. 44 für Kl. 4hd., Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1845 Genoveva op. 81, Kl.A., Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1851 30 Lieder für Kl. solo, Durand 8c Schönewerk, Paris 1873 Drei Skizzen für den Pedal-Flügel aus op. 56 und 58 für Kl. 2hd., Novello, London 1883
Editionen Robert Schumanns Werke, Breitkopf 8c Härtel 1881-1893 (mit Johannes Brahms u.a.) Jugendbriefe von R. Schumann. Nach den Originalen mitgeteilt, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1885
526
Anhang
Robert Schumann, Klavierwerke. Erste mit Fingersatz und Vortragsbezeichnungen versehene instruktive Ausgabe , Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1886 Domenico Scarlatti, 20 ausgewählte Sonaten für das Pianoforte, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig o. J. (1860er Jahre)
Neue Ausgaben Sammlungen Clara Schumann. Romantische Klaviermusik, hg. v. Franzpeter Goebels, 2 Bde., W i l l y Müller, Heidelberg 1967,1976 Clara Schumann. 3 kleine Klavierstücke, hg. v. Rosario Marciano, Verlag Doblinger, W i e n 1978 Clara Wieck Schumann. Selected Piano Music, hg. v. Pamela Susskind, Dacapo Press, New York 1979 Clara Wieck-Schumann. Ausgewählte Klavierwerke, hg. v. Janina Klassen, G. Henle Verlag, M ü n chen 1987 Clara Schumann. Sämtliche Lieder, hg. v. Joachim Draheim / Brigitte Höft, 2 Bde., Breitkopf 8c Härtel, Wiesbaden 1990,1992 Clara Schumann. Seven Songs, hg. v. K. Norderval, Bryn Mawr /Pennsylvania 1993 Clara Wieck. Frühe Klavierwerke, hg. v. Gerd Nauhaus / Joachim Draheim, Hofheim 1997
Einzelausgaben 3 Fugen über Themen von J. S. Bach, hg. v. V. Goertzen, New York 1999 3 Präludien und Fugen, 1. hg. v. B. Harbach, Pullman 1994; 2. hg. v. S. Glickman, Bryn Mawr 1997 Drei gemischte Chöre, hg. v. G. Nauhaus, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1989 Drei Romanzen für Kl. und V. op. 22, hg. v. J. Draheim, Breitkopf 8c Härtel, Wiesbaden 1983 Konzertfür Klavier und Orchester a-Moll op. 7 , 1 . hg. v. J. Klassen, Breitkopf 8c Härtel, Wiesbaden 1990; 2. bearb. für 2 Kl. v. K. Smith, Bryn Mawr 1993; bearb. für 2 Kl., hg. v. V. Erber, Wiesbaden 1993 Klavierkonzert f-Moll, erg. und orchestriert als Konzertsatz, hg. v. J. De Beenhouwer / G. Nauhaus, Wiesbaden 1994 Trio für Klavier, Violine und Violoncello g-Moll op. 17, Wollenweber, München 1972 Marsch Es-Dur, bearb. für Kl. 4hd., hg. v. G. Nauhaus, Breitkopf 8c Härtel, Wiesbaden. 1996 Präludien, hg. v. V. Goertzen, New York 1999 Präludium und Fuge fis-Moll, hg. v. V. Goertzen, New York 1999 Quatre Polonaises op. 1, hg. v. B. Hierholzer, Ries 8c Erler, Berlin 1987 Sonate für Klavier g-Moll, hg. v. G. Nauhaus, Breitkopf 8c Härtel, Leipzig 1991
Werkverzeichnis
527
Personenregister
Abegg, Meta 196 Adami, Heinrich 145 Albert, Prinz von England [= Franz August Carl Albert Emmanuel von Sachsen-Coburg und Gotha] 12,191,233,298 Alexander I. Pavlovitsch Romanov, Zar von Russland und König von Polen 19 Allgeyerj u l i u s 421,480f. Altenburg, Detlef 371-373 Ambros, August Wilhelm 367,400 Appel, Bernhard R. 215,236,240,248,253,403, 434,495 Archidiakon Fischer 89 Aristoteles 29 Arndts, Fanny 439 Arnim, Achim von 6,203 Arnim, Bettina von 142,254,203,392 Arnold, Samuel 413 Asten, Julie von 328,475 Auber, Daniel François Esprit 425 Augusta Marie Louise Katharina von SachsenWeimar-Eisenach, Prinzessin (»Prinzeß Wilhelm«), spätere deutsche Kaiserin und Königin von Preußen 19,354,371 Auguste (Nachname unbekannt, Reisebegleiterin Clara Wiecks) 79 Auhagen, Wolfgang 342f. Avé-Lallement, Theodor 14 B a c h j o h a n n Sebastian 15,103,112,125f., 137, 143,156,172,185,255f., 274,314,317,320, 330f., 348,367,370,380,385,396f., 399-407, 412-414,416,462,467,485,494 Backer Grandahl, Agathe 419,473 Bär, Ute 320,331,404 Bagge, Selmar 344 Baillot, Pierre 119,332 Balakirew, Mili 419 Balzac, Honoré de 280,360-362 Banck, Carl 92,211 Bargiel, Adolf 60 Bargiel, Cäcilie 62 Bargiel, Mariane 45,59-66,89,223,232£, 237-240,244f„ 247,250,252,276,283,311, 313,358,380,441,450 Bargiel, Woldemar 62,250,277,390,411,419, 459 Baudelaire, Charles 393 Baudissin, Graf 83 Bayly, Christopher A. 159 Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 214 Bebel, August 392,481
528
Becker, Carl Ferdinand 107,126,137,143,249 Becker, Clementine 419,474 Beckerjean 479 Becker, Rupprecht 249 Beethoven, Ludwig van 16,22,24,26,75f., 100-104,112,115,118,126,134f., 140,142, 145,148f., 151,155f., 160,167,169f., 174, 185,202,222f., 233,258,260,262,271,273, 281,312,314,316-319,330-335,337-341, 343-345,347-349,351f., 355-357,359,367, 369,373,377,386,396f., 399-407,413,416, 423,435f., 448,462,466f., 470,474-476,479 Behne, Klaus-Ernst 342 Behr Johannes 479 Behrens (Berliner Stadtrat) 95 Belleville, Anna Caroline von 149 Bellini, Vincenzo 93,100,118,175,176,426 Bendemann, Eduard 265,409,434f. Bendemann, Pauline —> Hübner, Pauline Benecke, Marie 308 Bennett, Sterndale 148,308,310,374,419 Beriot, Charles-Auguste de 160 Berlioz, Hector 87,150,186,310,328,357,362, 369,374,405,413 Bernhard, Klaus 233 Billroth, Theodor 385,389,442 Bismarck, Otto Fürst von 383f., 386-389,395, 417f., 421,428-430,437-439,481-483,489 Bizet, Georges 419 Blagrove, Henry 311f. Blahetka, Leopoldine 140,149 Böcklin, Arnold 277,417 Böhme, Hartmut 165 Bölling, Bertha 240 Bohtz, August Wilhelm 234 Borsig, Familie 427 Borwick, Leonard 472,476,478 Brahms, Christiane 281,290 Brahmsjakob 290 Brahmsjohannes 11,24,39-42,49-52,56,58, 115,120,124,135,139,159,168,172f., 180, 198,240,250,268,273-296,304,306f., 314, 317,319f., 321,323-326,328f., 331,334,345, 349-352,356,367,373f., 377-379,383-389, 391,394f„ 403,405f., 408f., 411,413-416, 418-424,426f., 431,434,436,447,449f., 452,454,456,458f., 461f., 465-467,469, 472-475,478f., 485f., 488-491,497 Brandes, Emma 451 Brasch, C. (Fotograf) 350 Breidenstein, Georg 35
Anhang
Brendel, Alfred 432 Brendel, Franz 134,139,157f„ 352,367f., 373375,393,395f., 400f., 405 Brentano, Bettina -> Arnim, Bettina von Brentano, Clemens 6,129,184,203,228f., 498 Brown, John 11 Bruch, Max 408f. Bryant, Hannah 464 Bucher, Lothar 299f. Büchner, Luise 445 Bülau, Friedrich 91 Bull,John 407 Bülow, Cosima von —> Liszt, Cosima Bülow, Hans von 137,145,159f„ 172,293,318, 321f., 328,350-352,376,378,390,405f., 416, 465,473,487,490 Bürger, August 306 B u r k s j o h n 491 Burns, Robert 114,211,216 Busby, Emma 312 Busby, Familie 309 Busoni, Ferruccio 488f. Bußmann, Auguste 184,228,498 Bulwer-Lytton, Edward 88,183 Byrd, William 407 Byron, George Gordon Noël, 6th Baron Byron of Rochdale 6,204,214,357,369 Campe j o a c h i m Heinrich 67 Charles X. Philippe, König von Frankreich 177 Carl, Emilie 90,179 Caroline Amalie, Königin von Dänemark 224 Carus, Carl Gustav 35,53,237,400 Cavalcaböjulie 140 Chappell, Arthur 314f. Chappell, Familie 391 Charcot Jean-Martin 35 Chopin, Frédéric 12,18f., 23,25f., 34,73£, 76, 85,91,93,100,101-103,112f„ 115,117,119, 122,127f., 130-135,138f., 146,148-150, 152,164,166,170,173,175-177,197,200f., 204,221,223,256,317,319,324-327,330f., 337f., 344,349,353-356,358-360,374,397, 404—406,413f., 430,432f„ 462,467,473 Cimarosa, Domenico 396 Clairmont, Ciaire 204 Claudius, Matthias 225 Clauß-Szärvädy, Wilhelmine 151,328 Corelli, Arcangelo 413 Cornelius, Peter 143,370,408,413 Cramer, Johann Baptist 176,469 Cranz, August Heinrich 333 Csikszentmihalyi, Mihaly 166 Cui, Cesar 419 Czerny, Carl 72,82,84,148,149,169,221,337, 340,348,469
Personenregister
d'Agoult, Claire-Christine 361 d'Agoult, Familie 361 d'Agoult, Marie 153,157,191,204,357,360f., 365 d'Albert, Eugène 160,419 d'Annunzio, Gabriele 493 da Vinci, Leonardo 400 Danhauser, Josef 357 Darwin, Charles 36,437,483 David, Ferdinand 399 Davies, Fanny 469,475f., 478,431,492 De Beenhouwerjozef 494 Debussy, Claude 420 Dehn, Siegfried 255 Delacroix, Eugène 349 Dessoff, Margarethe 464 Deutsch, Antonie —» Schumann, Antonie Dickens, Charles 475 Diesterweg, Adolph 371 Dietrich, Albert 249f., 276f., 409 Dietrich, Anton 357 Dilthey, Wilhelm 30 Dingelstedt, Franz von 427 Döhler, Theodor 26,148,326 Dörffel, Alfred 96,431 Donizetti, Gaetano 165 Donndorf, Adolf von 409f. Dorn, Heinrich 38, 82 Draeseke, Felix 405 Draheim, Joachim 211,230,269f. Dreyschock, Alexander 148,326,328 Dürer, Albrecht 382 Dumas, Alexandre (der Ältere) 177,357 Dupré, Karoline 469,471 Dussekjohann Ladislaus 83 Dvorak, Antonin 419,431 Ehrenfeld, Moritz 426 Ehrlich, Heinrich 474 Eibenschütz, Ilona 160,433,474-477,492 Eichendorff j o s e p h Freiherr von 258,335 Eichrodt, Ludwig 235 Einert, Wilhelm 89 Eismann, Georg 495 Elisabeth Amalie Eugenie, Kaiserin von Österreich-Ungarn 9 Ella j o h n 310f., 315 Elsnerjózef 102 Engelbrunner, Nina 63 Engelmann, Carl Friedrich 182 Enzensberger, Hans Magnus 498,499 Erard, Sébastien 81,119,301 Ernst August I., König von Hannover 8 Ertmann, Dorothea Freiin von 102 Esmarch, Friedrich von 323,485 Eugénie, Kaiserin von Frankreich 9
529
Falk-Auerbach, Nanette 477 Falten, Carl 467 Fallersleben, Hoffmann von 387 Fanny (Nachname unbekannt, Kindermädchen der Schumanns) 241 Farrenc, Louise 140 Fauré, Gabriel 419 Fechner, Clementine —> Wieck, Clementine Fechner, Eduard 120,122 Fellinger, Familie 292 Fellinger, Maria 40 Ferdinand I., Kaiser von Österreich-Ungarn 104 Fétis, François-Joseph 26,150,335,355,396,398 Feuerbach, Anselm 277,417,422f., 480 Feuerbach, Ludwig 368f. Fickler (Vorname unbekannt, Kopist Robert Schumanns) 238 Fiedler, Carl 386 Fiedler, Conrad 422,424 F i e l d j o h n 62,69,75,78,83,116,126 Fillunger, Marie 39,451,459 Filtsch, Carl 72 Fink, Gottfried Wilhelm 61,138 Fischer-Lichte, Erika 165 Fischhofjosef 103,241,301 Flaubert, Gustave 195,393 Fóldényi, LázlóF.498f. Förster, Henriette 66 Flaxland, Gustave Alexandre 378 Fontana, Julian 177 Fontane, Theodor 429 Forkel, Johann Nikolaus 169,400,412 Fouqué, Friedrich Heinrich Karl Baron de la Motte 6 Franck, César 420 Frankenberg, Adolf 241 Frege, Livia 122,271,275,293,409 Frege, Woldemar 122 Freud, Sigmund 35 Fricken, Ernestine von 88,199,446 Friedberg, Carl 433,468,476,477 Friedrich II., genannt »Friedrich der Große«, König von Preußen 413 Friedrich Wilhelm III., König von Preußen 5, 481 Friedrich Wilhelm IV, Kronprinz 7,421 Fröbel, Friedrich 241,446f., 482 Gade, Nils Wilhelm 262,369 Galston, Gottfried 488 Garnier, Charles 118 Gathy, August 146 Gauthier, Théophil 359 Gay, Peter 35 Gayk, Ina 424 Geibel, Emanuel 225-227,265
530
Gentet, Marguerite 464 George, Stefan 468 Gerhard, Wilhelm 216 Gerhardt, Livia —> s. Frege, Livia Gerke, Anton 155 Gervinus, Georg Gottfried 8,382 Geyer, Therese 66 Giere, Julius 122f., 125 Glinka, Michail 419 Gluck, Christoph Willibald 396,400,403 Godwin, William 204 Goebels, Franzpeter 494 Goldschmidt, Lily 474 Goldschmidt, Otto 420 Goodwin, Amina 474 Gottlieb-Billroth, Otto 50,334 Gottsched, Johann Christoph 171 Graf, Conrad 105,153,180,357 Gregor-Dellin, Martin 351 Greiling j o h a n n Christoph 163 Grieg, Edvard 314,419,431 Griepenkerl, Wolfgang Robert 305 Grillparzer, Franz 8,102f„ 107,139£, 142,258 Grimm, Hermann 383 Grimm, Jacob 8,209,232 Grimm, Julius Otto 250,275f., 284,306,374, 409,414 Grimm, Wilhelm 8,209,232 Grönemeyer, Herbert 491 Groß, Sabine 212f. Grove, George 298,313 Gutenbergjohannes 382 Habeneck, François-Antoine 118,332 Habermas Jürgen 391 Händel, Georg Friedrich 298£, 302-304,314, 320,367,385,396f., 399-401,403,413,467 Härtel, Familie 43 Härtel, Helene 43,495 Härtel, Hermann 43,209,258,279,284,495 Härtel, Raimund 382 Hallmark, RufUs 217 Halm, Anton 102 Hamann, Richard 382f., 386f., 417,421 Hand, Ferdinand 27,259f. Hanfstaengl, Franz 239,329,421 Hanslick, Eduard 21,36,138,151,153,172, 241,312,322,324,327-330,334,337-340, 344f., 351,366,375f., 389,393,404,407,411, 425-427,433 Harris, Clement 468 Hauptmann, Moritz 116,405 Hausmann, Friedrich Christoph 424 Haussmann, Georges-Eugène 118,426 Haydn, Joseph 102,106,302,314,316,319,331, 387,396f., 399f., 403,406f., 467,470,473
Anhang
Hebbel, Friedrich 279 Hegar, Alfred 36,483 Heine, Heinrich 23,177,211,224-231,354, 358,373 Heinzel, Thekla 191 Held, Wolfgang 176,193,201 Hellmesberger, Joseph 319,406 Helm, Theodor 160 Helmholtz, Hermann von 30,398,429 Henried, Paul 491 Hensel, Fanny 32,204,246,263,310,335,494 Hensel, Sebastian 480 Hensel, Wilhelm 243 Henselt, Adolph 19,93,100,152,155,169,175, 262,324,326,354,473 Hepburn, Kathleen 491 Herbeck, Johann Fritz Ritter von 351 Herder, Johann Gottfried von 369,371 Herloßsohn, Carl 20,107,143 Hermand, Jost 382f., 386f., 417,421 Herwegh, Georg 354 Herz, Henri 25,76,116,119,122,126,148,149, 176,221 Herz,Jaques 149 Herzogenberg, Elisabet von 39,47f., 291,293, 423 Herzogenberg, Familie von 292f. Herzogenberg, Heinrich von 414 Hickethier, Knut 110 Hildebrand, Adolf von 38,421-424,461 Hiller, Ferdinand 119,149,210,250,262,353, 409 Hiller, Johann Adam 15f. Hill-Handley, Delphine 140,142 Hinrichsen, Hans-Joachim 406 Hirschbach, Hermann 27,29,186,207 Höcker, Karla 490 Höft, Brigitte 211,230,269f. Hoehn, Alfred 477 Hölderlin, Johann Christian Friedrich 28,383, 386 Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 21,74,101, 197,211,401 Hofmann, Renate 40,48,278,285,292,403, 442-444,474,479,494f. Hofmann, Werner 383,395,400, Hofmannsthal, Hugo von 417 Hohenemser, Richard 487 Holle, Marie 182 Honegger, Claudia 29,31,35,237 Hübner, Familie 275 Hübner, Pauline 265 Hünten, Franz 76 Hugo, Victor 195,357,362f., 393 Humboldt, Gebrüder 209
Personenregister
Humboldt, Wilhelm Freiherr von 31,351,371, 444 Hummeljohann Nepomuk 71f., 74,83,126,133, 149,151,164,337,340 Humperdinck, Engelbert 419,464 Ignaz (Familienname unbekannt, Diener der Schumanns in Wien) 241 Jacobsthal, Gustav 384 Jaell, Marie 160 Jahn, Otto 254,279 Janotha, Nathalie 451,469,475-478 Jansen, Gustav 184,411 Jelinek, Elfriede 493 Jenner, Gustav 296 Joachim, Amalie 160,320,331,408£, 427,439 Joachim, Joseph 24,27,43,49,137,143,161, 167,171f., 174,240,249f., 271,275-280, 282,292-294,300,302,304,306£, 311-314, 316f., 319-322,331,334,340£, 350£, 366, 374,389£, 394f„ 404-407,409£, 412,414, 416,423f., 427,430,443,448-450,454,462, 478,488f. Johner, Helene 464 Kaiser, Eduard 10,242 Kalbeck, Max 350,435,458 Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm 66,74,76,83, 119,125£, 133,148£, 176,388 Kalliwoda, Johann Wenzel 148 Kawohl, Friedemann 346£, 368 Keferstein, Gustav Adolph 162 Kerner, Justinus 83,211 Kierkegaard, Seren 186 Kiesewetter, Raphael Georg 105 Kietz, Theodor Benedikt 210 Kinski, Nastassja 491 Kirchner, Theodor 12,48£, 167,198,276£, 283, 285-288,495 Kleefeld, Wilhelm 487 Kleist, Heinrich von 6,382,498 Kiems j o h a n n Bernhard 271,301£, 342 Klengel, August Stephan Alexander 341 Klinger, Max 294,296,424 Knigge, Adolph Freiherr von 32,67 Knorr, Iwan 464,479 Knorrjulius 113 Köhler, Louis 72,79,179£, 186,196 Körner, Theodor 6 Koiwa, Shinji 74,102,126,149,332,494 Krahl, Hilde 491 Krämer, Lawrence 498 Krebs, Carl 487 Kreisig, Martin 487 Kretzschmar, Hermann 385 Kühn, Dieter 492f. Kühn, Sophie von 6
531
Kufferath, Familie 292 Kußmaul, Adolf 235 Kwast, James 419 La Mara [= Marie Lipsius] 137 Lacombe, Louis 148,152 Ladenburg, Emil 474 Lafont, Charles Philippe 8 Laidlaw, Robena 148,326 Lamartines, Alphonse de 355 Lamennais, Hugues Félicité Robert de 362 Lange, Friedrich Albert 382 Lanner, Joseph 85,102 Laqueur,Thomas 35f., 483 Lara, Adelina de 431,433,469-472,474-476, 478,492 Lassalle, Ferdinand 172,394 Lasso, Orlando di 413 Latour, Theodor Graf Baillet de 389 Laube, Heinrich 21 Laurens, Jean-Joseph-Bonaventure 243 Le Beau, Luise Adolpha 470 Leander, Zarah 491 Lewald, Fanny 37 Lichnowski, Felix Maria Vincenz Andreas Fürst von 389 Lickl, Karl Georg 241 Liebig, Justus von 248 Leitmeyer, Wolfgang 422 Lemercier, Alfred-Léon 120 Lenau, Nikolaus 247 Lenbach, Franz von 417,421f., 424,461 Leser, Rosalie 249,273,282,319,467 Levi, Hermann 289f., 292,351,367,381,385, 414,425,441,478 Lipsius, Marie —> La Mara Lienhard, Friedrich 428 Lind(-Goldschmidt), Jenny 158,160,241,282, 308,325,409f., 420,430,461 Lindemann, Marie von 44,241,245,263,495 Link,Jürgen 7,157,435 List, Elise 90,495f. List, Emilie 38,40,43,65f., 77,81,88-90,92,94, 97f., 190,207,213f., 221,233,237,248,252, 264,280,292,308,366,380f„ 414,419,421, 441f., 449,495f. List, Friedrich 17,43f., 81,89 Liszt, Blandine-Rachel 153,361,445f., 460 Liszt, Cosima 153,293,361,446,455,460 Liszt, Daniel 153,361,444f„ 454£, 460 Liszt, Franz 8,18£, 23,33f., 36,45,73,87,91, 93,100,107£, 110,115,118f., 124,131,133, 137£, 143£, 148,150,152-155,157,160, 162,164,166,169,172,176,178,186,191, 200,204,221,230,296,321f., 324-327,333, 335,337,340,348,350-378,385,389f., 394,
532
405,407,413,421,444,446,454f., 460,473f., 479,488 Liszt, Maria Anna 445 Ljadow, Anatoli 419, Lobe,Johann Christian 144,210 Loesch, Heinz von 431 Loewe, Carl 131,413 Logierjohann Bernhard 60,73,337 Lortzing, Albert 382 Louis Philippe d'Orléans I., König von Frankreich 177,359 Löwenthal-Rheinberg, Rosette 464 Louise, Königin von Preußen 1,4-7,10,13,33, 38,158,185,438f., 481,483,487 Lucke-Kaminiarz, Irina 394,405 Ludwig II., König von Bayern 386 Ludwig, Susanne 48 Luhmann, Niklas 46,183f. Luise, Königin von Schweden [= Wilhelmine Friedrike Alexandra Anna Luise von Oranien-Nassau, Königin von Schweden und Norwegen] 461 Luther, Martin 31,119,382f., 385 Lutzerjenny 104,110 Lyon, Victoire 464 Lyser, Johann Peter 141,211 Maassen, Maria 479 Mälzeljohann Nepomuk 337 Mahler, Gustav 420,433,379 Makart, Hans 417,426f. Malata, Fritz 477 Malibran, Maria 8,107,119,160 Malinska, Friederike 241 Manns, August 313 Marciano, Rosario 494 Maria Anna, Kaiserin von Österreich-Ungarn 353 Maria Theresia, Kaiserin von Österreich 439 Marmorito , Roberto Radicati di 460 Marmorito, Chiarina Radicati di 460 Marmorito, Eduardo Radicati di 457 Marmorito, Vittorio Radicati di 449 Marées, Hans von 386 Marschner, Heinrich 86,116,186,377 Marx, Adolf Bernhard 61,100,307,334,340, 347,375 Marxen, Eduard 326 May, Florence 293,487 Mayer, Charles 76 Mayer, Leopold von 318 Mayer, Lina 477 Mayseder, Joseph 104,160 Méhul, Étienne Nicholas 396,399 Mendelssohn Bartholdy, Fanny > Hensel, Fanny Mendelssohn Bartholdy, Felix 12,19,22-24,26f.,
Anhang
87f., 96,100,102f„ 115,119f„ 125,127,130, 142,150f., 156,164,170,180,185f., 188,200, 204f., 208,232f., 240,263,265-268,271,291, 295,302,304,308,310,314,317,324,330, 335-339,353,357f., 361f., 365,368f„ 377, 382,396,399,401,403-407,413f., 430,448, 462f., 467,470,474,479 Mendelssohn Bartholdy, Paul 253 Mendelssohn, Familie 412,480,496 Menter, Sophie 160 Merk, Joseph 104,160 Metternich, Klemens Wenzel Fürst von 19,104, 357,392,430 Metzradt, Emil von 54,70 Meurer, Adolph 490 Meyerbeer, Giacomo [= Jakob Liebmann Meyer Beer] 119,227,365 Michael, Thomas 492 Miksch, Johann Aloys 211 Milchmeyer, Johann Peter 67,72 Möbius, Paul J. 36,437,483 Moser, Karl 152 Moke, Marie Denise -> Pleyel, Camilla Montez, Lola 34 Moritz, Karl Philipp 341 Moscheies, Ignaz 8,77,83,124,126,133,147, 149,168,186,329,343,364,397,474 Moser, Dietz-Rüdiger 441f., 444,447,450 Mosse, Rudolf 393,427 Motte-Haber, Helga de la 33,77,147,342f. Mozart, Wolfgang Amadeus 58,71,76,82f„ 102, 126,156,164,167,198,279,314,316f., 331£, 348f., 356,396£, 399f., 403,405^107,413, 425,463,467,479 Mrazek, Wilhelm 300 Müller, Carl 107 Müller, Ida 464 Müller-Reuter, Theodor 467f., 470 Nägeli, Hans Georg 170 Nagler, Norbert 359,361 Napoleon I., Kaiser von Frankreich 5,61,120, 185,412,438 Napoleon III., Kaiser von Frankreich 9,380, 393,430 Nauhaus, Gerd 56f., 89,188,190,192,222f„ 247, 265,409,494f. Nauhausjulia M . 317,330 Neisser, Ulric 215 Nicolai, Otto 92,397 Niemeyer, August Hermann 67 Nietzsche, Friedrich Wilhelm 392,432 Nissen, Georg Nikolaus von 198 Novalis [= Friedrich von Hardenberg] 5-7,141, 203,231,432 Novello, Clara 148
Personenregister
Oldenbourg, Hedwig 38 Oison, Marie 473 Oppenheim, Familie 474 Oppenheim, Marie 474 Orgeni, Aglaja 452 Oriola, Marie von 38 Ortlepp, Ernst August 214 Oswald, Nannette 148 Oulibicheff, Alexander 334 Pacher von Theinburg, Elise —• List, Elise Pacini, Giovanni 100,157,353,356 Paderewski, Ignacy 160 Paer, Ferdinando 119,122 Paganini, Niccolò 2,71,83,86,93,101,104, 107f., 116,119,140,149,153,327,329,353, 355,357 Palestrina, Giovanni Pierluigi 413 Parish, Charles 150 Parr, Rolf 5,383,428,437,438f. Parson, Josephine 475 Pasta, Giuditta 8,104 Patti, Adelina 425f. Pauer, Ernst 316f. P a u l j e a n 6,141,170,213,233f. Pavlovna Romanova, Maria, Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach 18£, 372 Paxton, Joseph 299 Pereira, Henriette 353 Pesadori, Antoinette 140 Pestalozzi,Johann Heinrich 54,447 Peters, Eberhard Dr. 248 Peters-Otto, Luise 445f., 483 Pfitzner, Hans 419,464,489 Pfundt, Ernst 88 Piatti, Alfredo 319 Pierce, Ludemile 464 Pixis, Francilla 164 Pixis, Johann Peter 79,83,100,116,119,122, 148f., 169,221 Piaton 28,387 Pleyel, Camilla 149-151,326 Pohl, Richard 367 Polidori, John William 204 Posch, Leonard 5 Preiß, Friederike 89,91,96,98,495 Preston, Adelina —» Adelina de Lara Pringsheim, Familie 427,429 Prutz, Robert 306,393 Püttlingen,Johann Vesque von 103 Radecky, Olga von 464 Raff, Joachim 25,419,464-^167,469 Raffael (da Urbino) 35,185£, 198,388,399 Rakemann, Louis 88,92,125,336 Ramann, Lina 144,351 Ravel, Maurice 359,420
533
Reichmann, Henriette 80,477f. Reichold, Emilie 66 Reinick, Robert 378 Reinthaler, Familie 409 Reilstab, Ludwig lf., 21,84,130,134,138,145, 176,335,371f.,430 Renck, Johanna 464 Reuter, Moritz 88,336 Richarz, Franz 252,254,312,434 Richter, Ludwig 235f. Rieger, Eva 39,463,470-472,474-476,492 Riemann, Hugo 135,260,275 Ries, Ferdinand 62,149 Rietschel, Ernst 5,10,209f., 242,277,301,350, 366,409,410 Righini, Vincenzo 396,399 Rimski-Korsakow, Nikolai 419 Ritterman,Janet 308 Robinson, Familie 310 Rochau, Ludwig August von 384 Rochlitzjohann Friedrich 21,116,170 Rollett, Hermann 269f., 305,378 Rötter, Günther 342f. Romberg, Bernhard 396,399 Romberg, Familie 332 Rossini, Gioachino 19,66,126,357,435 Rothschild-Bassermann, Florence 474,477 Rott, Hans 479 Rubini, Giovanni Battista 8,118 Rubinstein, Anton 174,374,376,406f., 419,473 Rückert, Adine 472 Rückert, Friedrich 210,216-220,222,224f., 227,378 Rudorff, Ernst 409,414,419,448,451 Sabinina, Marfa 39,41,110,188,193,206,264, 339,366,371,378,469,471,474 Saint-Saéns, Camille 419,476 Saint-Simon, Claude Henri Comte de 354 Salieri, Antonio 396,399 Salomon, Alice 447 Salomon, Hedwig von 277 Sand, George 177,204,357,360,362,365 Sand, Maurice 360 Sand, Solange 360 Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg, Carolyne Elisabeth Fürstin von 144,371,372 Scarlatti, Domenico 19,317,414,416,467,474 Schadow, Johann Gottfried 7 Schadow, Wilhelm 277,422 Schäifer, Julius 277 Schamoni, Peter 491 Schauer, Friedrich 210 Schein, Johann Hermann 413 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 203 Scherer, Wilhelm 384,482-485
534
Schiller, Friedrich 27,141f., 163,209,233,257, 306,371,380,382f., 402,407,439,482,484 Schilling, Gustav 107,133,135 Schilling-Wang, Britta 371f. Schindler, Anton 102,340 Schinkel, Karl Friedrich 210,382 Schlegel, August Wilhelm 203 Schlegel, Caroline 203 Schlegel, Friedrich 2 8 , 3 1 , 1 8 5 , 2 0 3 , 2 3 1 , 3 8 2 , 4 3 2 Schlesinger, Moritz August 119,177 Schloß, Sophie 216 Schmidt, Georg Philipp 83 Schnorr von Carolsfeld, Malwine 464 Schönburg-Hartenstein, Eduard Fürst von 92 Schöne, Helene —> Härtel, Helene Schöne, Richard 43,495 Schönerstedt, Agnes 290 Scholz, Bernhard 374,419,466f. Schrader-Breymann, Henriette 446f. Schramm, Johann Heinrich 159 Schröder-Devrient, Wilhelmine 156,160,186, 208,358,380 Schröter, Corona 487 Schubert, Franz 1 , 1 9 , 2 4 , 3 3 , 8 3 , 8 5 , 1 0 4 , 1 3 1 , 140,228f., 281,330,337,348,355-357,403f., 406,413,430,467 Schuberth, Julius Ferdinand Georg 243 Schütz, Heinrich 413 Schultz, Agathe 464 Schulze, Hagen 418 Schumann, Alfred 442,447,450,459,488 Schumann, Antonie, geb. Deutsch 409,441,442 Schumann, August 462 Schumann, Carl 182 Schumann, Clara (Urenkelin von Clara Schumann) 460 Schumann, Eduard 89,183 Schumann, Elise 52,237,239,241,244,283f., 287,323,423,442,444,449-452,460,462, 479 Schumann, Emil 237,246,263,460 Schumann, Erich 442 Schumann, Eugenie 3 8 - 4 1 , 4 5 , 4 8 , 5 7 , 9 8 , 1 7 4 , 237f., 240-242,249,275,277f., 283,288,290, 294,313,315,322,380f., 441,443f., 446-455, 460,458£, 461£, 469,472,474,478-480, 487f. Schumann, Felix (Sohn von Clara Schumann) 144,239f., 268,283,289,322,444,448, 452-458,460,488 Schumann, Felix (Enkel von Clara Schumann) 442,450,460f. Schumann, Ferdinand (Sohn von Clara Schumann) 238f., 246,283,322,380f., 409, 441-444,448,450,453,456,458-460
Anhang
Schumann, Ferdinand (Enkel von Clara Schumann) 45,97,242,377,424,442,447, 450,459,473,488 Schumann, Julie (»Julchen«, Enkelin von Clara Schumann) 442,446-448,450,452,459f., 469,476,495 Schumann, Julie (Tochter von Clara Schumann) 98,237,239,242,252,283f., 287,289,323, 441£, 449,453,456f., 460 Schumann, Ludwig 237,239,242,246,278, 283f„ 287,289,322,443f., 450,453,456,458, 460,479 Schumann, Marie 3 6 , 5 5 - 5 7 , 1 9 2 , 2 0 5 , 2 2 1 , 2 3 2 f , 239-241,249,278f., 283f., 287,293f., 313, 423,443,447,449-454,458^162,464,4684 7 0 , 4 7 2 , 4 7 6 , 4 7 9 ^ 8 1 , 4 8 3 , 4 8 5 f . , 488,497 Schumann, Pauline 253 Schumann, Robert 1 - 4 , 6 , 1 2 , 1 5 , 1 9 - 2 1 , 2 3 f „ 2 7 , 3 4 , 3 6 - 3 8 , 4 0 - 4 2 , 4 4 - 5 2 , 5 5 f . , 58,61f., 65f., 69,71,75f., 80f., 84f„ 87-101,103-107, 114f„ 117,120-130,133f., 137-144,146, 149-153,155f., 159-166,168,173,175f., 178-203,205-218,220-224,226f., 229, 232-234,236-243,245-259,261-265, 267-271,273,275-282,284-286,288, 291-296,302,306-308,310f., 314,316-318, 320-322,324-331,334-339,341,343f., 350, 352-359,361f, 364-370,373-375,377f., 380,388,397-417,423,425,430-^136,440f„ 443£,446,449-451,453,456,459-462,468, 472-474,480,484,486f., 490-493,495 Schumann, Victor 442,457 Schumann, Walther 442 Schunke, Ludwig 185 Schuppanzigh, Anton Ignaz 160,332 Schutz, Eugenie 239 Schwind, Moritz von 449 Scott, Walter 214 Scudo, Paul 26 Sechter, Simon 103 Seckendorf, Christian Adolf Freiherr von 60 Seckendorf, Familie von 60 Sedlnitzky von Choltic, Joseph Graf 102 Sekles, Bernhard 477 Semmelweis, Ignaz Philipp 237 Semper, Gottfried 299-303,305,307,372£, 376, 391,393,395,398£,418 Senff, Bartholf 253 Senfft von Pilsach, Ernst Freiherr 437 Senfter, Johanna 464 Sennett, Richard 9 Serre, Friederike 269 Serre, Friedrich Anton 269 Shaw, George Bernard 137 Shelley, Mary 204
Personenregister
Shelley, Percy Bysshe 204 Siebold, Adam Elias von 31 Siebold, Agathe von 284 Silcher, Friedrich 229 Simrock, Peter Joseph 289,384,409,479 Sinding, Christian 419,473 Smetana, Bedfich 419 Smyth, Ethel 291,419 Sohn, Carl Ferdinand 243,277,424,461 Soldat, Marie 291 Sommerhoff, Clara 457,460 Sommerhoff, Elise -> Schumann, Elise Sommerhoff, Familie 423,450,459 SommerhofF, Louis 443,450 Sonnleithner, Joseph von 412 Sontag, Henriette 2 Spitta, Philipp 414,485 Spohr, Louis 53,83, 86,116,125,128,397,403, 406 Sponheuer, Bernd 436 Spontini, Gaspare 96,401 Staub, Andreas 158f.,491 Steffens, Emilie 44,241,245,495 Stein, Andreas 77 Stern, Margarete 474 Stifter, Adalbert 258 Stockhausenjulius 160,274,335,380,385,409, 423,463,472 Strauß, David Friedrich 383 S t r a u ß j o h a n n 85,102,295,413 Strauss, Richard 419 Strobel, Johanna 59£ Strausberg, Familie 427 Stümcke, Therese 468,470 Sullivan, Arthur Seymour 314,419 Susskind, Pamela 492,494 Sweelinckjan Pieterszoon 413 Szymanowska, Maria 341 Tacchinardi-Persiani, Fanny 104 Tartini, Giuseppe 406 Taubert, Wilhelm 148,326,333,397 Tausch j u l i u s 469 Tausig, Carl 159,328 Taylor, Franklin 474,478 Thalberg, Sigismund 18£, 33,100,104,135,137, 148,152£, 155,157,175£, 186,221,324,326, 329£,353£, 474 Thayer, Alexander Wheelock 334 Thonet, Gebrüder 305 T i e c k j o h a n n Ludwig 198,203 Titzmann, Michael 436 Townsend, Familie 409 Treitschke, Heinrich von 438,483 Tromlitz J o h a n n Georg 16 Tromlitz, Mariane —> Wieck, Mariane
535
Trulla, Friedrich 92 Truhn, Hieronymus 173 Tschaikowski, Peter 419,431 Tutein, Josepha 222 Ulex, Wilhelm 336 Unger, Max 484 Unger-Sabatier, Caroline 156 Urspruch, Anton 467 Uzielli, Lazzaro 477 Varnhagen von Ense, Karl August 371f. Veit, Dorothea 203 Verdi, Giuseppe 377,419,425 Verhulst, Johann Joseph Hermann 282 Verne, Mathilde 472,474,476,478 Viardot-Garcia, Pauline 43f., 156,160,186,308, 380 Victoria, Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland 1,9-13, 37f., 113,191,233,237,299,303,308f., 371, 420f., 485 Victoria (»Vicky«), Tochter von Königin Victoria, spätere Königin von Preußen und deutsche Kaiserin 421 Vieuxtemps, Henri 155 Virchow, Rudolf 35,483 Vischer, Friedrich Theodor 191,418 Völlner, Johann Anton 243,435 Vogler, Abbé 396,399 Voigt, Henriette 131,196 Vorwerk, Anne 277 Voss, Heinrich 203 Wach, Lili 291 Wackenroder, Wilhelm Heinrich 198 Wagner, Adolph 388 Wagner, Cosima —> Liszt, Cosima Wagner, Eva 390 Wagner, Isolde 390 Wagner, Richard 186,266,292f., 296,305,351f., 367-369,372-377,385f„ 387,389f., 394,405, 413,417,419,421,424,429,460,479,488 Wagner, Siegfried 464,468 Waldbrühl,Wilhelm von 228 Walker, Alan 361 Wasielewski, Wilhelm von 23,185,196,326£, 409 Weber, Carl Maria von 42,61,83,124,151,314, 382,396,399,403,405 Wedekind, August Wilhelm 243 Weerth, Georg 394 Wehler, Hans-Ulrich 383 Weicke, Henriette - » Förster, Henriette
536
Weinlig, Theodor 82 Weinzierl, Stefan 105 Wendt, Gustav 411 Wendt, Mathilde 433,451,474 Wenzel, Emst Ferdinand 88,336 Wenzel, Silke 451,474,478 Werner, Anton von 387,429 Werner, Elisabeth 322 Wesendonck, Familie 368 White, Holdom 471,473 Widmaier, Tobias 397 Widmann,Josef Viktor 39 Widmann, Sophie 40 Wieck, Alwin 53f., 62,409,455,467,477 Wieck, Cäcilie 54,62 Wieck, Clementine 4 4 , 6 2 - 6 4 , 6 6 , 7 8 Wieck, Friedrich 17f„ 2 5 , 4 0 , 4 2 , 4 4 , 5 2 - 5 5 , 58-82,86,89-100,102-105,107-110, 116-123,127,137,147-153,157,173,176, 179-181,187,211,246,265,323,331,333, 357,395,458,467 Wieck, Gustav 54 Wieck, Mariane —> Bargiel, Mariane Wieck, Marie 62,411,473,475,487f. Wieck, Victor 59 Wiemann, Mathias 491 Wild, Margarethe 464 Wilde, Oscar 468 Wilhelm I., Kaiser [Wilhelm Friedrich Ludwig, König von Preußen und deutscher Kaiser] 7, 371,379,384f., 387f., 390,420,429,438 Wilhelm II., Kaiser [Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, deutscher Kaiser] 421, 441 Wolf, Hugo 420,479 Wollstonecraft, Mary 204 Wolter, Charlotte 426 Woodhull, Victoria 447 Wordswoth, Dorothy 204 Wordswoth, William 204 Worth, Charles Frederick 9 Wülfing, Wulf 435 Wüllner, Franz 414 Wurm, Mary 464,468£, 474 Wylde, Henry 310 Zellner, Leopold Alexander 138,145,348,350 Zelter, Carl Friedrich 108,258 Zemlinsky, Alexander von 420,479 Zobeltitz, Hanns von 487 Zuccalmaglio, August Wilhelm von 228f., 362
Anhang
EUROPAISCHE KOMPONISTINNEN HERAUSGEGEBEN VON ANNETTE KREUTZIGER-HERR UND MELANIE UNSELD
Band 4:
3 ra
M a r i o n Fürst
MARIA THERESIA
PARADIS
MOZARTS BERÜHMTE
jE :0
ZEITGENOSSIN 2005. XII, 405 S. 21 s/w-Abb. und 8 Noten-
-Q
beispiele. Gb. mit Schutzumschlag. ISBN 978-3-412-19505-2
B a n d 1:
Stefan Johannes Morent,
Marianne Richert Pfau HILDEGARD VON
BINGEN
DER KLANG DES HIMMELS 2005. 401 S. 12 s/w-Abb. auf 12 Taf. Mit Musik-CD. Gb. mit Schutzumschlag.
Band 5: MYRIAM
Detlef G o j o w y MARBE
NEUE MUSIK AUS RUMÄNIEN 2007. XII, 292 S. 10 s/w-Abb auf 8 Taf. Gb. mit Schutzumschlag. ISBN 978-3-412-04706-1
ISBN 978-3-412-11504-3 B a n d 2:
Ruth Müller-Lindenberg
WILHELMINE VON
BAYREUTH
DIE H O F O P E R A L S B Ü H N E D E S
FANNY Hl'KSEI.
![Clara Schumann: The Artist and the Woman [Revised Edition]
9780801468308](https://dokumen.pub/img/200x200/clara-schumann-the-artist-and-the-woman-revised-edition-9780801468308.jpg)