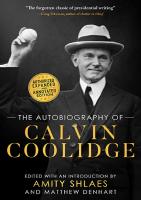Calvin 9783110825114, 9783110019407
181 22 7MB
German Pages 122 [128] Year 1971
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Einleitung: Humanismus, Mystik und Libertinismus in Frankreich
1. Jugend- und Schulzeit (1509-1523)
2. Universitätsstudium (1523-1533)
3. Calvins „Bekehrung" (1528 bzw. 1534)
4. Auf dem Weg zur Berühmtheit - die Institutio Christianae Religionis (1534-1536)
5. Erste Genfer Wirksamkeit (1536-1538)
6. Calvin in Straßburg und seine Teilnahme an den Religionsgesprächen von Hagenau, Worms und Regensburg (1538 bis 1541)
7. Die Neuordnung der Genfer Kirche nach der Rückkehr Calvins (1541-1545)
8. Auflehnung gegen das „Joch Christi" - die Prozesse Ameaux, Perrin, Gruet, Bolsec, Servet (1546-1555)
9. Calvins Verhältnis zu Deutschland und der Ostschweiz
10. Die Ausbreitung der Reformation in Europa
11. Das Ringen um die Reformation in Frankreich
12. Der Schriftsteller und Theologe
Literatur
Namensregister
Sachregister
Citation preview
Calvin von
Dr. "Wilhelm Neuser Prof. an der Universität Münster
w DE
G_
Sammlung Göschen Band 3005
Walter de Gruyter & Co. Berlin 1971
© Copyright 1971 by Walter de Gruyter Sc Co., vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung - J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl J. Trübner Veit Sc Comp., Berlin 30. - Alle Rechte, einschl. der Rechte der Herstellung von Photokopien und Mikrofilmen vom Verlag vorbehalten - Archiv-Nr.: 7610705. Satz und Druck: Saladruck, Berlin. - Printed in Germany
Inhalt Einleitung: Humanismus, Mystik und Libertinismus in Frankreich 1. Jugend- und Schulzeit (1509-1523)
5 11
2. Universitätsstudium (1523-1533)
14
3. Calvins „Bekehrung" (1528 bzw. 1534)
18
4. Auf dem Weg zur Berühmtheit - die Institutio Religionis Christianae (1534-1536)
24
5. Erste Genfer Wirksamkeit (1536-1538)
30
6. Calvin in Straßburg und seine Teilnahme an den Religionsgesprächen von Hagenau, Worms und Regensburg (1538 bis 1541)
39
7. Die Neuordnung der Genfer Kirche nach der Rückkehr Calvins (1541-1545)
57
8. Auflehnung gegen das „Joch Christi" - die Prozesse Ameaux, Perrin, Gruet, Bolsec, Servet (1546-1555) 9. Calvins Verhältnis zu Deutschland und der Ostschweiz . . . . 10. Die Ausbreitung der Reformation in Europa 11. Das Ringen um die Reformation in Frankreich
71 84 89 99
12. Der Schriftsteller und Theologe
108
Literatur
116
Namensregister
120
Sachregister
122
D. Dr. Walter Hollweg dem gelehrten und verdienten Erforscher der Geschichte der reformierten Kirchen zugeeignet
Einleitung Humanismus, Mystik und Libertinismus in Frankreich Wie wurde Calvin zum Reformator? Man kann diese Frage nicht allein durch Nennung der Daten, Orte und Namen beantworten, die die einzelnen Stationen seines Weges nach Genf kennzeichnen. Will man seinen Werdegang verstehen, so muß seine Geisteswelt erfaßt werden. Es liegt nahe, seine Entwicklung zum Reformator auf den Einfluß der großen Theologen seiner Zeit zurückzuführen - Luther, Zwingli, Melanchthon und Bucer haben sich bereits einen Namen gemacht, als Calvin an die Öffentlichkeit tritt. Calvin war jedoch nicht der Schüler eines einzelnen, sondern nahm Gedanken aller dieser Männer auf und fügte sie in sein imponierendes Lehrsystem ein. Seine theologische Selbständigkeit läßt den Forscher nach weiteren Impulsen suchen, die die Eigenart seines Denkens erklären. Die Umwelt Calvins, die Geistesströmungen der Zeit und die politischen Zustände in Frankreich müssen einsichtig gemacht werden. Dann erst erschließt sich dem Betrachter die einzigartige Persönlichkeit und das Werk Calvins. Nennt man sein Werk, so ist zuerst an die Genfer Reformation zu denken. Sie findet bis heute große Beachtung, nicht zuletzt, weil sie in vieler Hinsicht von derjenigen in Zürich und Wittenberg verschieden ist. Zahlreichen Kirchen in aller Welt hat sie ihr Gepräge gegeben. Der Calvinismus trug zur Bereicherung des kirchlichen Lebens bei; er ist aber auch mitverantwortlich für die Spaltung der evangelischen Kirche. Wenn man die Zersplitterung des Protestantismus untersucht, stößt man bald auf Calvins Theologie. Die Wurzeln der konfessionellen Spannungen - soweit diese von Calvin herrühren- reichen aber noch weiter zurück. Calvins Denken ist von der geistesgeschicht-
6
Einleitung
liehen Situation in Westeuropa, und zwar der französischen des 16. Jahrhunderts, geprägt. Ihr gilt es zunächst nachzugehen. Die Reformation ist nicht die einzige kirchliche Erneuerungsbewegung der damaligen Zeit. Vor ihrem Beginn breitet sich, von Italien kommend, jene Philosophie nördlich der Alpen aus, die im 19. Jahrhundert den Namen Humanismus erhält. Ihr bekanntester Vertreter wird Erasmus von Rotterdam (ca. 1466-1536). Das Programm des Humanismus lautet: Renaissance der antiken Philosophie. Die Werke der griechischen und römischen Schriftsteller werden neu gedruckt und eifrig studiert und ihre Sprachen erlernt, um sie unverfälscht lesen zu können. Der Rückgriff auf die ,Alten' soll der Reform der Sitten dienen. Die Tugendlehre des Altertums wird daher erneuert, nach den Regeln der Rhetorik eindrücklich vorgetragen und mit den Mitteln der Dialektik bewiesen. Versittlichung ist das Hauptziel, das die Humanisten verfolgen. Zugleich ist der Humanismus eine kirchliche Reformbewegung. Philosophien, die nicht auf dem christlichen Glauben fußen, sind am Ausgang des Mittelalters undenkbar. Es ist kennzeichnend für den Humanismus, daß er eine Gegenbewegung zur scholastischen Theologie darstellt. Leidenschaftlich bekämpfen seine Anhänger die endlose Zergliederung der Begriffe in den Schulen der Scholastik, ihren Kampf untereinander um Subtilitäten und ihr im Blick auf die Sittenverbesserung fruchtloses Disputieren. Die moralischen Mißstände im Klerus, die Veräußerlichung des Kultus und die Vielzahl der Zeremonien werden angeprangert. Die Humanisten geraten dadurch in einen Gegensatz zur herrschenden Theologie, wenn auch nicht zum Dogma der Kirche. Man erstrebt jedoch nur eine Reform, der die Verantwortlichen zustimmen. Die kirchliche Einheit ist ernstes Anliegen aller Humanisten, denn sie ist ein Teil der Einheit des Reiches und der abendländischen Kultur. Da die Forderung nach Rückkehr zu den Quellen auch die biblischen Schriften umfaßt, ergibt sich eine beachtliche Ge-
Einleitung
7
meinsamkeit zwischen Humanismus und Reformation. Luther, obgleich selbst nicht Humanist, wird in den ersten Jahren seines Auftretens als Mitkämpfer gefeiert. Nicht nur Huldrych Zwingli in der Schweiz, ein bewußter Erasmianer, bejubelt sein mannhaftes Reden und verfolgt aufmerksam jeden Schritt des Wittenbergers. Auch Männer, die der Kirche Roms die Treue halten, begrüßen zu Anfang sein Hervortreten. Als sich aber herausgestellt, daß Luther das Papsttum und die Kirchengewalt grundsätzlich in Frage stellt, wenden sie sich ebenso schnell wieder von ihm ab. Für die Sittenreform in Staat und Kirche bedarf man keiner Reformation; der reformatorische Gnadenbegriff bleibt ihnen unverständlich. Erasmus verfaßt gegen Luther die Schrift „Über den freien Willen" (1524) und dokumentiert in ihr die ganz andere Zielsetzung des Humanismus. Namhafte Humanisten schließen sich jedoch der Reformation an, allen voran Philipp Melanchthon (1497-1560). Wie werden sich die französischen Humanisten stellen? Faber Stapulensis (ca. 1455-1536) bringt den Humanismus aus Italien nach Frankreich und sorgt dort für seine Verbreitung. Bezeichnend für sein Denken ist aber nicht die Vertiefung in die aristotelische Philosophie - hierin unterscheidet er sich nicht von Erasmus und seinen Schülern — sondern die Aufnahme mystischer Gedanken. In seinen Schriften verwendet er die Begriffe der Kontemplation, die wie bei den Mystikern des Mittelalters zur inneren Gottesschau führen soll. Bei Erasmus von Rotterdam hingegen tritt, obgleich er dem Augustinismus der niederländischen Devotio moderna entstammt, der Gedanke der Christusvereinigung im Glauben auffallend zurück. Seinen Schülern, auch Zwingli und Melanchthon, fehlt gleichermaßen dieses tiefe warme Verständnis des Glaubens. Dagegen steht Faber der Bilder- und Farbenreichtum der Mystik zur Beschreibung der Gemeinschaft mit Gott zur Verfügung. Die namhaftesten französischen Humanisten sind seine Schüler: Briconnet, Clichtow, G. Roussel, F. Vatable, L. von Berquin, G. Bude und auch Calvins späterer Freund, G. Farel, der erste
8
Einleitung
Reformator Genfs. Indem Calvin mit dem mystisch gefärbten französischen Humanismus in Berührung kommt, eröffnet sich ihm die Möglichkeit, viel stärker als Zwingli es vermag, auf Luthers Gedanken einzugehen. Der Wittenberger Reformator war vor seinem Durchbruch zur Reformation der Mystik stark verhaftet; seine Herausgabe und Hochschätzung der „Theologia deutsch" (1516 und 1518) sind Zeugnis dafür. Doch darf auch die Mystik nicht mit der Reformation verwechselt werden. Sie ist die zweite antischolastische Bewegung, die die Reformation bereits vorfindet. Da sie einen direkten Zugang zu Gott lehrt, entwertet sie die Hierarchie der Kirche und ihre Institutionen. Der Laie wird auch ohne sie der göttlichen Offenbarung teilhaftig. Diese Lehren bringen Faber in Konflikt mit der Sorbonne, der berühmten Universität von Paris. Zwei kritische Untersuchungen über Maria Magdalena (1517/18) werden von der Sorbonne am 9. November 1521 verdammt. Sein Evangelienkommentar wird 1523 auf den Index librorum prohibitorum gesetzt. Es macht sich bemerkbar, daß zu Luthers mächtigsten Gegnern unter den theologischen Fakultäten auch die der Sorbonne gehört. Noël Bedier, seit 1520 Syndikus der theologischen Fakultät, tritt als leidenschaftlicher Kämpfer ebenso gegen Luther wie gegen Faber Stapulensis auf. Nachdem die Reformation in Deutschland nicht verhindert werden konnte, stellen sich die Pariser Theologen um so entschiedener der Kritik an der Kirche im eigenen Lande entgegen. Doch findet Faber einen mächtigen Gönner in König Franz I. von Frankreich (1515-1547), der humanistischen Gedanken aufgeschlossen ist. Das gleiche gilt für seine Schwester Margareta von Navarra, die der Mystik anhängt. Der König verhindert ein weiteres Vorgehen der Sorbonne gegen Faber. Als er aber in der Schlacht bei Pavia (1525) gefangen genommen wird, müssen Faber Stapulensis und Gerard Roussel nach Straßburg fliehen. Gewiß, nach des Königs Rückkehr wird der berühmte Humanist Privatlehrer der Prinzen und wohnt als Bibliothekar im königlichen Schloß zu Blois.
Einleitung
9
Der kurze Einblick zeigt deutlich, mit welcher Erbitterung gestritten wurde. Die gewaltigen Möglichkeiten, die sich aus der freundlichen Haltung des Königs dem Humanismus gegenüber für eine Reformation in Frankreich ergeben, werden vorerst von der schroffen Gegnerschaft der Vertreter der scholastischen Theologie in Paris zunichte gemacht. Eine weitere Eigenart der geistigen Situation in Frankreich liegt in dem Auftreten eines theologischen und moralischen Libertinismus. Von Italien her dringt nicht nur ein religiöser Humanismus in das Land, sondern auch ein menschliches Autonomie-Bewußtsein, das sich über die Moralgesetze und eine Verantwortung im Jüngsten Gericht hinwegsetzt. Die Anhänger und Befürworter dieses Freiheitsstrebens sind Humanisten. Calvin nennt sie Lucianiker und Epikuräer, die die Verbindlichkeit des göttlichen Gesetzes und die Unsterblichkeit der Seele öffentlich bezweifeln und die Sittenlosigkeit fördern. Er beschreibt und bekämpft sie insbesondere in der Schrift „De scandalis" (1550). Gemeint sind die Kreise um Rabelais, Dolet, Des Periers, Govean und andere. Dieser Geist findet auch am königlichen Hof Eingang. Zum Beispiel trägt Mellin de Saint Gelays, Almosenpfleger des Dauphins, obgleich apostolischer Protonotar, zur Guitarre Lieder vor, die das Vergnügen, das Liebesleben und den Ehebruch verherrlichen. Der „gewandte Höfling im geistlichen Gewand" neigt zeitweise der Reformation zu. Calvin spielt auf ihn an, wenn er von den „feinen Protonotaren" spricht. Margareta von Navarra beruft Quintin und Pocque an ihren Hof, die zur Sekte der „Libertiner" zählen. Sie hängen einem Pantheismus an, der Gott die Ursache der Sünde zuschreibt und daher die Sünde entschuldigt. Calvin kannte die Männer persönlich von einem Zusammentreffen in Genf her. Er greift sie an in der Schrift „Contre la secte fantastique et furieuse des Libertins" (1545). Mit Recht wird die Bezeichnung „Libertiner" auch auf die Gruppe der Epikuräer übertragen, mögen sie nun in Frankreich oder in Genf den Ruf nach sittlicher Freiheit laut werden
10
Einleitung
lassen. J. Bohatec stellt in seinem Buch über den französischen Frühhumanismus fest, daß „Calvin mittelbar auch die Freiheit des sich selbst bestimmenden, seine Grenze sich selbst vorschreibenden, seiner Göttlichkeit sich bewußten Bildners der Renaissance" bekämpft. „Die Freiheit ist nicht ein Leben nach Belieben, nicht sittliche Zügellosigkeit, die Calvin an den Epikureern seiner Zeit tadelt" (S. 473). Mag Calvins Verurteilung der Libertiner - gleich welcher Gruppe sie angehören - von seiner theologischen Ansicht mit bestimmt sein, fraglos stellt die Befürwortung eines schrankenlosen Individualismus den Beginn der Säkularisierung des christlichen Abendlandes dar. Für die Reformationsgeschichte wird nun von großer Bedeutung, daß sich in Deutschland im Wesentlichen nur ein religiöser Humanismus verbreitet. Luther und die übrigen deutschen Reformatoren müssen sich hauptsächlich mit der Scholastik und der vulgärkatholischen Frömmigkeit auseinandersetzen. Gesetzlichkeit, Verdienstglaube und die beständige Angst vor dem drohenden Fegefeuer sind ihre Gegner. Dem Antinomismus begegnen sie nur im Gefolge der Mystik (J. Agricola, A. Osiander). Calvin steht indessen einer Gesetzesfeindlichkeit (Antinomismus) gegenüber, die einem selbstherrlichen Individualismus entspringt. Wie auch immer man diese Entwicklung bewerten mag, im Westen ist die Neuzeit bereits angebrochen. Daher steht Calvin auch nicht vor Luthers Frage, ob das Gesetz für den Glaubenden verbindlich sein kann. Das ganze Leben muß seiner Meinung nach wieder unter die Ordnung Gottes gestellt, dem Gesetz Gottes wieder Geltung verschafft werden. An dieser Stelle hegt einer der Hauptunterschiede in der Theologie Luthers und Calvins - er ist situationsund ortsbedingt. Calvin wird konsequent zum Theologen der Heiligung und Kirchenzucht. Man hat viel darüber gerätselt, woher Calvins Betonung der Ehre Gottes (gloire de Dieu) stammen könnte. Das Wort wird der Begriffswelt der französischen Monarchie entnommen worden sein und sich Calvin während seines Studiums des römischen Rechts eingeprägt
Jugend und Schulzeit
11
haben. Doch ist seine Übernahme in die Theologie kein Zufall. Er vollzieht sie wohlüberlegt, weil sie ihm angesichts der Säkularisation in der westlichen Welt notwendig erscheint.
1. Jugend und Schulzeit (1509-1523) Jean Cauvin, wie sein Name eigentlich lautet - Johannes Calvinus ist die latinisierte Form - wurde am 10. Juli 1509 in der nordfranzösischen Bischofsstadt Noyon geboren. Es verdient Beachtung, daß er im Schatten einer großen Kathedrale aufgewachsen ist. Die eindrucksvolle und zugleich fragwürdige Machtentfaltung der mittelalterlichen Kirche stach am Sitz einer bischöflichen Kurie besonders ins Auge. Noyon besaß eine lange kirchliche Tradition. Bereits im sechsten Jahrhundert hatte der Heilige Menardus den Bischofssitz errichtet, der in den folgenden Jahrhunderten kirchlicher Mittelpunkt Nordfrankreichs wurde. In der Kathedrale war Karl der Große im Jahre 768 zum König gesalbt worden. Zahlreiche Klöster und Kirchen waren seitdem entstanden und zeugten von regem kirchlichem Leben. Nicht weniger eindrucksvoll präsentierte sich den Bewohnern Noyons die weltliche Macht des Bischofs. Karl von Hangest, der während der Jugendzeit Calvins das Bischofsamt innehatte, war ein prunkliebender Herr, einer der zwölf Pairs von Frankreich, mit Sitz im Parlament. Im Jahre 1525 gab er sein Amt an seinen Neffen Johann von Hangest ab, doch blieb er - wohl um seine Hausmacht zu sichern dessen Generalvikar. Seine zahlreichen bischöflichen Vorrechte boten ihm auch großen Einfluß auf das städtische Gemeinwesen. Bereits im zwölften Jahrhundet hatten die Bürger einen Aufstand gegen den damaligen Bischof unternommen, waren aber nicht durchgedrungen. Bei dieser Machtfülle konnten Auseinandersetzungen innerhalb des Klerus nicht ausbleiben. Es bestand Rivalität zwischen Johann von Hangest und dem Domkapitel, dem 57 Chorherren angehörten. Der Streit entlud
12
Einleitung
sich, als im Jahre 1533 an den Bischof die Aufforderung erging, sich den Bart abnehmen zu lassen. Da er sich weigerte, verschlossen die Chorherren ihm den Eingang zum Chor der Kathedrale. Im nächsten Jahr widersetzte sich der Bischof dem Termin für eine öffentliche Prozession, den das Kapitel festgesetzt hatte. Als sie trotzdem stattfand, exkommunizierte der Bischof das Kapitel. Er unterlag schließlich und verließ die Stadt. Den Bewohnern Noyons blieben diese Streitigkeiten nicht verborgen. Gérard Cauvin, der Vater Calvins, arbeitete als Finanzberater für den Bischof wie für das Kapitel. Er war apostolischer Notar, Steuereinnehmer der Grafschaft, Schreiber des kirchlichen Gerichtshofs, Sekretär des Bischofs und Rechtsbeistand des Kapitels. Aus einfachen Verhältnissen hatte er sich emporgearbeitet. Die frühen Biographen Calvins überliefern das folgende Bild seiner Familie - bringt man die oft gehässige Polemik in Abzug: Die Vorfahren Calvins väterlicherseits waren Flußfischer in dem Dorf Pont-1'Éveque, nicht weit von Noyon. Während aber Gérard Cauvins beiden Brüder sich als Schlosser in Paris niederließen, erwarb er selbst 1497 das Bürgerrecht von Noyon und errang im Laufe der Jahre durch seine Klugheit, gepaart mit Ehrgeiz, eine angesehene Stellung in der Stadt. Er heiratete Jeanne Le Franc, die Tochter eines begüterten Gastwirts aus Cambrai, der sich in Noyon niedergelassen hatte. Calvin verlor seine Mutter bereits im jugendlichen Alter; sein Vater heiratete nochmals. Zur Familie gehörten vier Söhne, Karl, Johannes, Anton und Franz, der jung starb, dazu zwei Töchter, Marie und eine, deren Name unbekannt ist. Anton und Marie begleiteten später Johann Calvin nach Genf, und auch Karl scheint sich der Reformation angeschlossen zu haben, denn er starb 1537 als Priester, exkommuniziert und ohne die kirchlichen Sakramente empfangen zu haben, die er ablehnte. Auch Calvins Vater starb 1531 im Kirchenbann, so daß die Söhne nur mit Mühe die Erlaubnis erhielten, den Vater in geweihter Erde bestatten zu lassen. Doch scheint seine Exkom-
Jugend und Schulzeit
13
munikation keine religiöse Ursache gehabt zu haben; Gérard Cauvin hatte sich mit dem Domkapitel überworfen. Im Jahre 1528 wurde er aufgefordert, endlich die Erbschaft zweier Kapläne zu regeln, und wurde auf seine Weigerung hin mit dem kleinen Kirchenbann belegt. Er selbst hatte sich entschuldigt, er liege krank danieder. Man wird nicht an Veruntreuung denken müssen, sondern sollte den Mißbrauch in Betracht ziehen, der mit der Exkommunikation getrieben wurde. Calvin hat später in der Institutio (IV, 11,7) den katholischen Brauch angeprangert, Geldschulden durch einen Bannspruch einzutreiben. Jeanne Le Franc, heißt es, sei eine sehr schöne und auch fromme Frau gewesen. Uber tiefergreifende religiöse Eindrücke in der Jugendzeit Calvins ist indessen nichts bekannt. Er berichtet später einmal: „Unter anderem erinnere ich mich, daß ich einen Teil (der Reliquien der Heiligen Anna) in der Abtei von Orcamps bei Noyon geküßt habe; dabei wurde ein großes Festmahl gegeben." Diese vereinzelte Erinnerung läßt erkennen, daß Calvin in der allgemeinen kirchlichen Frömmigkeit erzogen und aufgewachsen ist. Es ist möglich, daß er durch die Tätigkeit seines Vaters einen kritischen Blick für die weltliche Machtentfaltung und das Finanzgebaren der römischen Kirche bekommen hat. Des Vaters guten Beziehungen zu den Adeligen in der Umgebung Noyons eröffneten seinem Sohn Johannes die Möglichkeit, an dem Hausunterricht der Söhne Hangest-Montmor teilzunehmen. Diese Erziehung begann bereits in seiner frühesten Jugend. Man wird an einen Werdegang ähnlich Zwinglis denken müssen, der mit fast sechs Jahren zu seinem Onkel Bartholomäus, Pfarrer in Weesen, gegeben wurde und mit zehn Jahren in die Lateinschule in Basel eintrat. Calvin erhielt den Lateinunterricht im Collège des Capettes in Noyon, das seinen Namen von dem Mäntelchen der Schüler (cappa) erhalten hatte. Wie Zwingli zog er mit vierzehn Jahren zur Universität. Mit den Söhnen de Montmor, beaufsichtigt von deren Haus-
14
Universitätsstudium
lehrer, begann er in Paris mit den Studien. Einer der späteren Kritiker Calvins, F. W. Kampfschulte, urteilt: „So eignete er sich mit den Anfangsgründen des Wissens schon in jungen Jahren auch eine gewisse Feinheit der Sitten und jene vornehme Art an, die Calvin in so auffallender Weise von dem deutschen Reformator unterscheidet." Die Erklärung ist einleuchtend. Neben seiner aristokratischen Haltung ist als ein zweiter Charakterzug seine Reizbarkeit und Heftigkeit zu nennen. Sie ist kaum aus seiner dauernden Kränklichkeit zu erklären. Calvin war sich dieser Fehler bewußt und hat sie ein Lebenlang bekämpft - nicht immer mit Erfolg, wie er gesteht. Er war ein echter Franzose, eben ein Pikarde.
2. Universitätsstudium (1523-1533) Gérard Cauvin hatte für den Unterhalt seines Sohnes in Paris vorgesorgt. Er verschaffte ihm 1521 eine Pfründe, ein Viertel der Einkünfte der Kaplanei, die den Dienst am Gesinenalter in der Cathedrale in Noyon versah. Ein Dispens für das fehlende kanonische Alter und die fehlende Priesterweihe war damals leicht zu erhalten. Der Pfründeninhaber bestellte einen Stellvertreter, der die vorgeschriebene Zahl der Messen las, und war aller Pflichten ledig. Im Jahre 1527 wurde Calvin auf diese Weise zum Pfarrer von Marteville bestellt, 1529 zum Pfarrer von Pont-l'Eveque. Man wird in diesen Pfründen lediglich ein Stipendium zu sehen haben, das die Kirche vergab. In Paris wohnte Calvin bei seinem Onkel Richard. Er besuchte zuerst das Collège de la Marche. Ein vierzehnjähriger Student war damals nichts Außergewöhnliches; man muß beachten, daß das Universitätsstudium mit der Erlernung der ,sieben freien Künste' begann. Zu ihnen gehörte lateinische Grammatik, Rhetorik und Dialektik, während die höhere Stufe Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie umfaßte. Erst wenn die ,Septem artes liberales' erfolgreich absolviert waren,
Universitätsstudium
15
stand dem Studenten das Studium der Theologie, Rechtswissenschaft oder Medizin offen. Das Vorstudium entspricht also der Oberstufe unseres Gymnasiums. Später hat Calvin seiner Freude Ausdruck gegeben, daß er im Collège de la March Mathurin Cordier zum Lateinlehrer bekam. Jener war ein berühmter Pädagoge, der die lateinische Sprache nicht nach der Weise der Zeit den Schülern mit Schlägen einbläute. „Willst du leicht unterrichten", so mahnt er den Lehrer, „so beginne mit den Sitten. Fange mit Gott und den himmlischen Dingen an. Lehre die Kinder Christus lieben. Sie können sich nicht selbst überlassen bleiben, sondern bedürfen der Stütze der göttlichen Hilfe." Aus dem Satz spricht humanistisches Denken. Cordier hat die Grundlage zu Calvins elegantem Latein gelegt. Im Jahre 1536 holte Calvin seinen Lehrer nach Genf an das Collège de Rive und widmete ihm 1550 den Kommentar zum ersten Thessalonicherbrief. Schon bald wechselte Calvin zum Collège Montaigu über. Der bereits erwähnte Noel Bedier leitete es und verlieh ihm großes Ansehen. Erasmus von Rotterdam und Rabelais hatten die Schule vorher besucht und ihr Grausamkeit, Unsauberkeit und Engstirnigkeit nachgesagt. Man wird diese Urteile nicht überbewerten dürfen, denn sie entspringen letztlich der Enttäuschung über die hier herrschende feindselige Haltung gegenüber dem Humanismus. Calvin lernte nun neben harter Disziplin vor allem den Geist strenger kirchlicher Scholastik kennen. Diese Schulung muß als eine Bereicherung angesehen werden, denn er, der später so berühmte Theologe, hat nie Theologie studiert. Zugleich wird er im reformations- und reformfeindlichen Sinne Bediers beeinflußt worden sein. Nach vier Studienjahren wurde Calvin zu Anfang des Jahres 1528 Lizentiat der freien Künste. Welcher Disziplin wird er sich nun, der noch nicht Neunzehnjährige, zuwenden? Er selbst berichtet: „Zur Theologie hatte mich mein Vater bereits als ganz kleinen Knaben bestimmt. Als er aber bemerkte, daß die Rechtswissenschaft ihre Jünger allenthalben reicher macht, be-
16
Universitätsstudium
wegte ihn diese Hoffnung plötzlich zur Änderung seines Planes. So kam es, daß ich vom Philosophiestudium weggenommen wurde, das Rechtsstudium zu betreiben." Sicherlich haben des Vaters berufliche Schwierigkeiten in Noyon diesen Entschluß mit beeinflußt. Calvin ging nach Orlean, weil in Paris nur das kanonische Recht, nicht aber das Zivilrecht gelehrt wurde. An der Universität Orlean empfing Calvin neue, unauslöschliche Eindrücke. Er ist mit Leib und Seele Jurist gewesen und hat auch später diese Kenntnisse in den Dienst der Stadt Genf gestellt. Seine theologischen Schriften geben zu erkennen, daß er im exakten juristischen Denken geschult war; wiederholt läßt er Rechtsbegriffe einfließen. Beza beschreibt seine Studierweise: „Nach einem äußerst sparsamen Abendessen arbeitete er bis Mitternacht. In der Frühe fuhr er fort, das Gelesene im Bett möglichst vollständig sich in die Erinnerung zurückzurufen und zu durchdenken. In seinem Nachdenken ließ er sich nicht gerne durch Fragen stören. Durch die fortwährenden nächtlichen Studien gewann er zwar ein gründliches Wissen und ein ausgezeichnetes Gedächtnis, doch hat er sich andererseits hierdurch wahrscheinlich eine Magenkrankheit zugezogen, die ihm verschiedene andere Gebrechen und schließlich auch den frühen T o d brachte." Bezas Urteil ist glaubwürdig: „In erstaunlich kurzer Zeit machte Calvin Fortschritte, so daß er sehr oft den Platz der Lehrer einnahm; er galt mehr als Lehrender denn als Hörer. Und als er schied (wahrscheinlich im Sommer 1533), wurde ihm auf einstimmigen Beschluß des Dozentenkollegiums umsonst die Doktorwürde angeboten, weil er sich um die Universität aufs höchste verdient gemacht hatte." Unter anderem bekleidete er auch das Amt des Prokurators einer der zehn „Nationen", in die sich die Studentenschaft gliederte; er wurde zum Leiter der Nation „Pikardie" gewählt. Berühmtester (Petrus Stella). Rechtsgelehrten. damals zu einer
unter den Professoren war Pierre de l'Estoile Calvin nennt ihn den „Fürsten" unter den Die Verehrung für seinen Lehrer trieb ihn ersten literarischen Veröffentlichung. Im nahen
Universitätsstudium
17
Bourges hatte im April 1529 der berühmte italienische Jurist Andreas Alciati Vorlesungen zu halten begonnen. Um ihn zu hören, begab sich Calvin dorthin. Während nun Stella Vertreter einer juridischen Scholastik war, zeichnete sich Alciati durch sein humanistisches Wissen aus. Er ist der Begründer der historischen Schule, das heißt, er erklärte die Gesetze aus Geschichte und Literatur. Die Studenten waren jedoch unzufrieden, weil er zu wenig Stoff und zu viel Entwicklungen vortrug und sein Latein barbarisch klang. Als er nun unter einem Pseudonym eine Verteidigungsschrift ausgehen ließ, in der er Pierre de l'Estoile angriff, schrieb Calvins Freund Duchemin eine „GegenVerteidigung" (Antapologia), die 1531 mit einer Vorrede Calvins erschien. Aus ihr geht hervor, daß Calvin in Paris den Druck beaufsichtigte. „Ubermäßig bissige Beredtsamkeit" wirft er Alciato vor, versucht aber der Veröffentlichung jede persönliche Spitze zu nehmen. Geschickt deklariert er den literarischen Streit als Sachdiskussion. Im Blick auf Calvins Jurastudium ist nichts Ungewöhnliches zu vermerken. Aufmerksamkeit fordern hingegen die humanistischen Eindrücke auf ihn in Orlean und Bourges. An beiden Universitäten wurden die ,litterae', Sprache und Geist der Antike, gepflegt. Wir wissen nicht, was Calvin veranlaßte, Humanist zu werden, Mathurin Cordiers Anleitung lag schon einige Jahre zurück. Jedenfalls begann Calvin nun bei dem deutschen Humanisten Melchior Volmar die damals nur wenig bekannte griechische Sprache zu erlernen. Als Volmar nach Bourges übersiedelte, folgte er ihm. Selbstverständlich gehörte damals zur Sprache die Einführung in die antike Sittenlehre. Bedenkt man, daß der religiöse Humanismus - wie bereits ausgeführt - eine kirchliche Reformbewegung darstellte, so wird man diesen Eindrücken auf Calvin erhöhte Beachtung schenken. Welche Bedeutung ihnen für die „Bekehrung" Calvins zukommen, wird im nächsten Abschnitt zu erörtern sein. Im Jahre 1531 wurde Calvin nach Noyon ans Sterbebett seines Vaters gerufen. Gérard Cauvins Tod brachte eine Wen2
Neuser, Calvin
18
Calvins „Bekehrung"
dung in Calvins Leben. Im Widmungsbrief an Melchior Volmar, den er 1546 seinem Kommentar zum 2. Korintherbrief voransetzte, erklärte er, der Deutsche habe ihm jede Hilfe angeboten, das Studium der antiken Schriften zu Ende zu führen. Aber sein Studium des Zivilrechts, zu dem ihn der Vater nach Orlean geschickt habe, habe nur nebenbei eine Beschäftigung mit den ,Graecas literas' zugelassen. Nun wendet sich Calvin nach Paris, um dort seine humanistische Bildung zu vervollständigen. Das Jurastudium trat ganz zurück, ohne daß angenommen werden muß, er habe es aufgegeben. Die erwähnten Funktionen als Studentenvertreter an der Universität Orlean übte er nämlich, wie wir sicher wissen, während seines Aufenthaltes von Mai 1532 bis Sommer 1533 in dieser Stadt aus. Das eine Jahr in Paris nützte er, um zu Senecas Schrift De dementia (Uber die Milde) einen Kommentar zu verfassen, den er auf eigene Kosten drucken ließ. Da Seneca sein Buch an Kaiser Nero gerichtet hatte, um ihn zur Milde zu mahnen, ist immer wieder der Gedanke geäußert worden, Calvin habe sich öffentlich gegen die Verfolgung der Evangelischen in Frankreich wenden wollen. Doch bietet das Werk keinen Anhaltspunkt für diese These. Vielmehr versucht Calvin in echt humanistischer Manier Stoa und Christentum miteinander zu versöhnen. Wilhelm Bude und Erasmus erhalten von ihm hohes Lob. Mit diesem Buch versucht sich Calvin in der Welt des Humanismus einen Namen zu schaffen. Soviel Gelehrsamkeit seine Schrift aber auch aufweist, der Erfolg blieb aus, denn sie ragte, indem sie die gängige humanistische Kommentierweise übte, über das Mittelmaß nicht hinaus. Sie liefert uns vor allem den Beweis, daß Calvin noch nicht zur Reformation durchgestoßen war. 3. Calvins „Bekehrung" (1528 bzw. 1534) In der Vorrede zum Psalmenkommentar (1557) findet sich Calvins berühmtes Selbstzeugnis, aus dem der Anfang bereits zitiert wurde: Von Jugend an für die Theologie bestimmt,
Calvins „Bekehrung"
19
änderte der Vater später sein Berufsziel, weil die Juristerei einträglicher sei. „So sehr ich mich nun aber aus Gehorsam gegen meinen Vater bemühte, dem Rechtsstudium getreulich nachzugehen, so hat doch Gott durch seine geheime Vorsehung meinem Leben eine andere Richtung gegeben. Zuerst nämlich - da ich dem päpstlichen Aberglauben hartnäckiger ergeben war, als daß es leicht gewesen wäre, mich aus einem so bodenlosen Schlamm herauszuziehen - hat Gott meinen Sinn, der für sein Alter allzu sehr verstockt war, durch eine plötzliche Bekehrung zur Gelehrigkeit (subita conversione ad docilitatem) bezwungen." Es ist viel diskutiert worden, wann die „plötzliche Bekehrung" stattgefunden habe. P. Sprenger hat „Das Rätsel um die Bekehrung Calvins" gelöst, indem er des Reformators Verständnis der docilitas aufdeckte: Sie ist nicht Glaube, sondern eine Vorstufe zum Glauben. Die „Bekehrung zur Gelehrigkeit" ist die Abwendung von der katholischen Kirchenlehre und die Hinwendung zum (humanistischen) Studium der Hl. Schrift. Offensichtlich denkt Calvin an den Unterricht des Melchior Volmar seit 1528 in Orleans und Bourges. Beza nennt neben Volmar noch Calvins Vetter Olivétan, der dem Humanismus des Faber Stapulensis anhing. Jener habe ihn zum Bibellesen und zur Abkehr von dem heidnischen Kultus der römischen Kirche ermahnt. Doch kann Calvin seinem Vetter nur kurz begegnet sein, denn schon 1528 mußte Olivétan nach Straßburg fliehen. Ob diese Flucht ein Anlaß der „plötzlichen Bekehrung" war? Über Vermutungen kommen wir nicht hinaus. Calvin gibt selbst zu erkennen, daß seine „Bekehrung" ein Anfang war. In seinem Selbstzeugnis fährt er fort: „Nachdem ich daher einen gewissen Vorgeschmack der wahren Frömmigkeit empfangen hatte, entflammte mich ein solcher Eifer, Fortschritte zu machen, daß ich die übrigen Studien zwar nicht aufgab, aber doch nachlässiger betrieb. Es war noch kein Jahr vergangen, als alle, die nach reinerer Lehre begehrten, zu mir, dem Neuling und Anfänger, kamen, um zu lernen." Mit den 2»
20
Calvins „Bekehrung"
„übrigen Studien" muß das Jurastudium gemeint sein, nicht aber die Vertiefung in die Sprache und Lehre der antiken Philosophie. Ihr begann er sich vielmehr jetzt mit Eifer zuzuwenden. Calvin versteht sie rückblickend als Fortschritt auf dem Weg zum Verständnis der Sprache und Botschaft des Neuen Testamentes. Nach einem Jahr kann er andere Interessierte bereits in die „reinere" Lehre (wohlgemerkt nicht in die doctrina pura) einführen, das heißt, sie über die Schriftwidrigkeit der Heiligenverehrung, des Bilderdienstes und anderer Stücke des „päpstlichen Aberglaubens" (superstitiones) aufklären. Von der „wahren Frömmigkeit" ist jedoch weder im Senecakommentar noch in seinen Briefen aus dieser Zeit etwas zu spüren. Aus den Briefen geht hervor, daß er in Paris ein unbekümmertes Leben geführt hat, in dem ihn Weinsorgen oder die launige Empfehlung eines Arztes bewegten. Der „Gelehrigkeit" in der Hl. Schrift muß nach Calvins Sprachgebrauch der „Glaube" folgen, dem „Vorgeschmack" die „wahre Frömmigkeit". Wann erlebte Calvin den entscheidenden Durchbruch? Sicherlich nicht vor der Rückkehr nach Paris im Sommer 1533. Seine Berichte aus dieser Zeit geben jedoch keine Aufschlüsse: Am 27. Juni schreibt er seinem Freund Daniel in Orleans, er habe dessen Schwester im Kloster aufgesucht und sie angeblich vom Gelübde abzuhalten versucht. Aber seine Einwände gegen das Klostergelübde sind nicht grundsätzlicher Art. Die Bemerkung, er beabsichtige bei Petrus Danäus Griechischunterricht zu nehmen, leitet zu dem zweiten Brief über. König Franz I. hatte mit dem Dreisprachenkollegium (Collège des Troislangues), an das er den Gräzisten Danäus, den Hebraisten Vatable und andere nahmhafte Gelehrte als königliche Lektoren berief, dem Humanismus in Paris eine Heimstatt geschaffen. Dieser Schritt verschärfte die Gegensätze. Noel Bedier, der Dekan der theologischen Fakultät der Sorbonne, hatte sich offen gegen eine Übersetzung der Heiligen Schrift aus dem Urtext durch die Lektoren gewandt; das sei lutherisch. Im Brief vom 27. Oktober berichtet Calvin
Calvins „Bekehrung"
21
nun von einer Schulaufführung, in der des Königs Schwester Margarete und deren Beichtvater Roussel verspottet wurden. Die Vertreter der Scholastik hatten diesen Gegenschlag geführt, um den Reformhumanismus zu treffen, dessen Vertreter sich um Margarete von Valois gesammelt hatten. Calvin hat sich dem Kreis angeschlossen, denn er nennt Roussel „unseren Gérard"; soviel ist dem Brief über Calvins innere Entwicklung zu entnehmen. Der König zwang die Universität, seine Schwester von jedem Verdacht reinzusprechen. So nahte der 1. November 1533, an dem die Universität traditionsgemäß mit einer Rede des neuen Rektors das Allerheiligenfest beging. Zum Rektor gewählt worden war der Mediziner Nikolaus Cop, ein Freund Calvins. Mit großer Wahrscheinlichkeit entstammt die Rektoratsrede über die Seligpreisungen (Matthäus 5) der Feder Calvins. Der Inhalt überrascht, denn er enthält im Wesentlichen Zitate und Gedanken aus Schriften des Erasmus und Martin Luthers. In der Einleitung wird die ,philosophia christiana' nach des Erasmus Vorwort zum Neuen Testament (1524) entwickelt. Als ihr Ziel wird die Glückseligkeit genannt, die von keiner Philosophie erreicht wird, weil sie aus dem Wort Gottes geschöpft ist; sie gibt Frieden und glückliches Leben. Mit der Anrufung der Jungfrau Maria schließt die Einleitung. Die Auslegung der Seligpreisungen lehnt sich eng, oft wörtlich, an eine Predigt Luthers über diesen Text (wahrscheinlich) aus dem Jahr 1522 an; Calvin benutzt die lateinische Kirchenpostille, übersetzt von Martin Bucer. Der Vorlage folgend beginnt er mit der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium und schließt die Einzelerklärung an. Ergreifend ist die letzte Seligpreisung ausgelegt, „Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden". Ohne Zweifel hörte die Universität am 1. November 1533 in der Kirche der Mathuriner eine reformatorische Predigt. Aber war ihr Verfasser zum neuen Verständnis des Evangeliums durchgedrungen? Die enge Anlehnung an eine Predigt Luthers
22
Calvins „Bekehrung"
läßt die Frage bejahen. Daneben stehen aber die Übernahme erasmischer Gedanken und die Anrufung der Maria, die mit Luthers Darlegungen nicht zu vereinbaren sind. Die Seligpreisungen sind zudem zu keiner Zeit vor dem Mißverständnis sicher gewesen, eine Imitatio Christi zu lehren. Weitere Einwände sind: Der von Calvin fünf Tage zuvor verfaßte Brief läßt den Durchbruch zur reformatorischen Erkenntnis nicht erwarten. Als gegen Cop durch zwei Bettelmönche vor dem Parlament Anklage erhoben wird, flieht er und Calvin mit ihm. Selbst die Flucht ist nicht eindeutig, denn schon oft hatten Humanisten in diesen Jahren das Land verlassen müssen. Am 4. Mai 1534 leistete Calvin in Noyon Verzicht auf seine Pfarrstelle. Doch dürften hierfür juristische Gründe maßgebend gewesen sein. Calvin stand vor der Vollendung des 25. Lebensjahres, dem kanonischen Alter, und mußte sich daher entscheiden, die Weihen zu empfangen oder auf seine Pfründe zu verzichten. Auch dieser Schritt muß daher nicht als Bruch mit der römischen Kirche verstanden werden. Dies alles zeigt, daß wir nicht genau wissen, wann Calvin zum reformatorischen Glauben durchgestoßen ist. Die Rektoratsrede des Cop steht noch unter der Devise Erasmus und Luther, Humanismus und Reformation. Sicherlich wurde sie samt ihren einschneidenden Folgen für Calvin zum Anlaß, sich zur vollen Klarheit durchzukämpfen. Beza berichtet, Calvin habe Anschluß an die heimliche evangelische Gemeinde in Paris gefunden und sich dort ganz Gott geweiht. Diese Notiz liefert das abschließende Glied in der sich über Jahre hin erstreckenden „Bekehrung" Calvins. Doch wird der Anschluß an die Gemeinde, abweichend von Bezas Darstellung, erst nach dem 1. November 1533 erfolgt sein; wir wissen, daß Calvin auch nach seiner Flucht noch mehrmals in Paris weilte. In einem Brief aus dem Jahr 1534 an seinen Freund an einem geheimen Zufluchtsort geschrieben, spricht erstmals über seinen Glauben. Er rühmt die Vorsehung „Ich habe es erfahren, daß wir nicht ins Weite schauen
Daniel, Calvin Gottes: dürfen.
Calvins „Bekehrung"
23
Als ich mir Ruhe in Allem versprach, stand vor der Tür, was ich am wenigsten erwartet hatte. Dann wieder, als ich auf einen unangenehmen Wohnsitz denken mußte, wurde mir ein Nest im Stillen hergerichtet wider alles Erwarten. Das alles ist die Hand des Herrn. Wenn wir uns ihm anvertrauen, wird er für uns sorgen." In den vorangehenden Briefen fehlen Bekenntnisse dieser Art völlig. Ein neuer Ton voll biblischen Ernstes wird hörbar. Leider fehlt das genaue Datum des Briefes. Es ist möglich, daß er erst nach Ausbruch der schweren Verfolgung im Herbst 1534 verfaßt ist. Calvin befindet sich im Jahre 1534 in Frankreich auf Reisen. Ihr Zweck und ihre Dauer sind unbekannt; den Spekulationen über Erlebnisse Calvins sind Tor und Tür geöffnet. Spätere französische Biographen wissen erstaunliche Einzelheiten. Es ist jedoch ratsam, sich auf die Angaben Bezas und einige gesicherte Fakten zu beschränken: In Angouleme ist er Gast bei dem Gelehrten Chorherrn von Claix, Louis du Tillet. In Nerac besucht er Faber Stapulensis, der dort unter dem Schutz der Margarete von Navarra seinen Lebensabend verbringt. Von seinen Geschäften in Noyon war bereits die Rede. Nach Paris kehrte er zurück, um mit Servet über die Trinitätslehre zu diskutieren; doch hielt der Spanier die Verabredung nicht ein. In Orleans ist endlich die Vorrede zu Calvins erstem theologischem Werk „Über die Wachsamkeit der Seele" (De Psychopannychia) verfaßt. Calvin widerlegt in ihm die wiedertäuferische Lehre vom Seelenschlaf nach dem Tod. Ob die Schrift damals bereits die unverkürzte reformatorische Botschaft enthielt, ist ungewiß, denn sie erschien erst 1542 im Druck. Es ist möglich, daß Calvin an das Jahr 1534 denkt, wenn er am 1. Juli 1562 in der Predigt gesteht, er hätte vor „zwanzig oder beinahe dreißig Jahren" sich lieber die Zunge abschneiden lassen, als „das Wort" (des Bekenntnisses) auszusprechen. Damit bezeichnet er sich für jene Zeit als ,Nikodemit' Nicht zufällig wird Calvins Hinwendung zur Heiligen Schrift von ihm selbst als „Bekehrung" bezeichnet, während er den
24
Institutio Christianae Religionis
Durchbruch zur reformatorischen Erkenntnis als eine beinahe selbstverständliche Folge darstellt, über die sich genaue Angaben erübrigen. Calvin hat immer den Bruch mit der katholischen Lehre und Frömmigkeit stärker hervorgehoben als die evangelische Erkenntnis. Seine wiederholten Appelle an die französischen Humanisten verdeutlichen es. Obgleich jene die evangelische Rechtfertigungslehre offensichtlich nicht verstanden hatten, forderte Calvin sie auf, endlich die Konsequenz aus ihrer Kritik am Papsttum zu ziehen und sich zum Evangelium zu bekennen. Calvin gleicht hierin Zwingli (und in gewisser Hinsicht auch Luther), der seine Ablösung von der Papstkirche unter dem Einfluß des Erasmus im Jahre 1516 hervorhebt, den langen Weg bis zum Verständnis des biblischen Gnadenbegriffes aber unbeachtet läßt. 4. Auf dem Weg zur Berühmtheit die Institutio Christianae Religionis (1534-1536) Nach der Rektoratsrede Cops bereits hatte König Franz I. die Ausrottung der „verdammten lutherischen Sekte" befohlen; gegen die Ketzer sollten exemplarische Strafen verhängt werden. Die damals gefangengesetzt worden waren, wurden jedoch im Frühjahr 1534 auf Befehl des Königs wieder freigelassen. Noel Bedier hingegen wurde ins Gefängnis geworfen und der Majestätsbeleidigung angeklagt. Wie kam es zu diesem Umschwung? Schwerwiegende politische Gründe veranlaßten Franz I. zum Einlenken. Er stand in Verhandlung mit den deutschen evangelischen Fürsten, die auf einen Zusammenschluß gegen den Kaiser und auf Reformen in der französischen Kirche abzielten. Über die notwendigsten Reformen verfaßte Melanchthon ein Gutachten, das jedoch in der Schweiz wegen der großen Zugeständnisse an Rom Mißfallen erregte. Die ,affaire des placards' war wahrscheinlich eine Antwort auf die Kompromißbereitschaft der deutschen Protestanten und auf die Doppelzüngigkeit des Königs.
Institutio Christianae Religionis
25
Was war geschehen? In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1534 wurden in Paris und einigen anderen Städten heimlich Maueranschläge angebracht, die den Titel trugen „Wahrhaftige Artikel über die schrecklichen, großen und unerträglichen Mißbräuche der päpstlichen Messe". Selbst an der Tür des königlichen Schlafgemachs in Amboise fand sich ein „Plakat". Der Verfasser war Marcourt, ein Flüchtling aus Lyon, der jetzt als Pfarrer in der Schweizerstadt Neuchätel wirkte, wo die ,Artikel' auch gedruckt worden waren. Die Reaktion war unerwartet hart: 24 Verdächtige wurden zum Scheiterhaufen verurteilt, 52 entzogen sich dem Gericht durch die Flucht. Unter den Hingerichteten befand sich auch der Kaufmann Etienne de la Forge, in dessen Haus Calvin verkehrt hatte. Es ist anzunehmen, daß Calvin und du Tillet angesichts dieser Verfolgungen das Land verließen und in Straßburg Zuflucht suchten. Frankreich verlor einen seiner größten Theologen. Der französischen Politik kam die ,affaire des placards' sehr ungelegen. Franz I. gab jedoch seinen Plan nicht auf. Am 16. Juli 1535 lud er Melanchthon zu einem Religionsgespräch für den 4. August ein. Am gleichen Tag erließ er das Edikt von Coucy, das allen, die ihren Irrglauben abschwörten, eine Generalamnestie gewährte. Die „Sakramentierer" waren von der Amnestie ausgenommen - immerhin vertraten die ,Plakate' eine radikale Leugnung der Gegenwart Christi im Abendmahl. Diese Einschränkung konnte den Verhandlungen mit den deutschen Lutheranern nur förderlich sein, denn jene verdammten ebenfalls die Zwinglianer als „Sakramentierer". Hätte auch Calvin die Amnestie in Anspruch nehmen können? Es verdient Beachtung, daß er sich in Frankreich bereits offen gegen die Lehre Zwingiis ausgesprochen hat, wie er später versicherte. Da er niemals seinem „Irrglauben" abgeschworen hätte, ist die Erörterung müßig, ob er den „Sakramentierern" zugezählt worden wäre. Dem König blieb die schwierige Aufgabe, den Deutschen gegenüber die Hinrichtung der französischen „Lutheraner", wie
26
Institutio Christianae Religionis
sie im Lande genannt wurden, zu rechtfertigen. Bereits am 1. Februar 1535 hatte er ein Manifest ausgehen lassen, in dem er die zum Tode Verurteilten als „Aufrührer" bezeichnete. Ihre Hinrichtung bedurfte nach damaligem Recht keiner weiteren Rechtfertigung. Den Deutschen wurde ausdrücklich Freizügigkeit und ungestörtes Leben in Frankreich zugesichert. Da die Schmähung der Messe nicht als Ketzerei, sondern als Aufruhr hingestellt wurde, waren die deutschen Protestanten nicht betroffen. Den Unionsverhandlungen schienen die Wege in jeder Weise geebnet zu sein. Da trat am 23. August 1535 Calvin mit einem Schreiben an Franz I. an die Öffentlichkeit, in dem er der Verleumdung der französischen Protestanten entgegentrat. Der Brief ist seinem „Unterricht in der christlichen Religion" (Institutio Christianae Religionis) vorangestellt. In einem kleinen Zimmer der Baseler Vorstadt Sankt Alban hatte der unbekannte Franzose das Buch verfaßt, das ihn mit einem Schlag berühmt machen sollte. Noch ist es ein handliches Büchlein von nur sechs Kapiteln. In der letzten Fassung (1559) wird es zu einem umfassenden Werk von 80 Kapiteln angewachsen sein. Gedankengang und Inhalt werden zuletzt eine tiefgreifende Wandlung erfahren haben, jeder Auflage aber wird Calvin die Verteidigung der französischen Protestanten fast unverändert voransetzen. Er, der sein Vaterland verlassen mußte, fühlte sich ihm bis zu seinem Tod verpflichtet. Der Brief ist ein rhetorisches Meisterwerk. Er verrät in seinem Stil den Einfluß der Verteidigungsrede des Sokrates und der Anklagen Ciceros vor dem römischen Senat. Dem Vorwurf des Aufruhrs begegnet Calvin, indem er sich von allen Aufständen unter dem Vorwand, dem Evangelium zu dienen, distanziert. 1534 war in Münster das Wiedertäuferreich errichtet worden, das nun Gegenstand ständiger Angriffe auf die Reformation war. Die Evangelischen in Frankreich verbreiteten keinen Aufstand, versichert Calvin, sie gehorchten nur Gottes Wort. Calvin proklamiert die Königsherrschaft Jesu
Institutio Christianae Religionis
27
Christi, der auch der König unterstehe. Dann widerlegt er ein Argument der Gegner nach dem anderen - des königlichen Festpredigers Ceneau, Bischof von Avranches, des Humanistenhauptes Wilhelm Bude und des liebenswürdigen Kardinals Sadolet, die den König gegen die Protestanten aufgehetzt hatten. Es sind die gewohnten Vorwürfe: neue Lehre, Abspaltung von der alten Kirche, Abweichen von den Kirchenvätern usw. Es „liegt eine Tragik darin, daß der humanistisch geschulte Reformator sein erstes systematisches Werk mit einer Polemik gegen den Humanismus eröffnen m u ß t e . . . nicht gegen den Humanismus als s o l c h e n . . . sondern gegen ihre (der Humanisten) feindliche Stellung zur Reformation" (J. Bohatec). Die Vorrede an den französischen König datiert vom 23. August 1535, doch erschien die lateinische Ausgabe der Institutio erst im März 1536 bei dem Baseler Drucker Thomas Platter. Es ist eine verbreitete Ansicht in der Calvinforschung, daß ihr im Herbst 1535 eine französische Ausgabe vorangegangen sein muß. Der zeitliche Abstand der Vorrede vom Druck der lateinischen Fassung und der Nutzen einer Ausgabe für die französischen Protestanten in der Landessprache lassen diese Annahme zwingend erscheinen. Später ist die Institutio in stetem Wechsel lateinisch und französisch gedruckt worden. Dann aber wird jene früheste französische Ausgabe auch nicht Calvins Namen getragen haben, sondern ein Anagramm, das das Buch in Frankreich unverdächtig erscheinen ließ. Seit seiner Flucht aus Frankreich nennt er sich in seinen Briefen „Martianus Lucanius". Für die lateinische Ausgabe von 1539 wird er ein anderes Anagramm wählen, nämlich „Alcuinus". Im Gedankengang folgt die Institutio 1536 - die Zeitgenossen bezeichnen das Buch als „Katechismus" - den Katechismen Luthers. Sie beginnt mit dem Dekalog, lehrt das Evangelium an Hand des Apostolischen Glaubensbekenntnisses und läßt dann das Herrengebet und die Sakramente folgen. Das fünfte und sechste Kapitel widmet sich allerdings der Auseinander-
28
Institutio Christianae Religionis
Setzung mit der römischen Kirche. Sie sind überschrieben „Von den fünf Sakramenten, die keine sind, obwohl man sie allgemein bisher für solche gehalten hat", und „Über die christliche Freiheit, die Kirchengewalt und das weltliche Regiment". In späteren Jahren wird Calvin, abweichend von Luther, das Gesetz am Schluß behandeln, weil seine vornehmliche Aufgabe nicht die Sündenerkenntnis sei, sondern die Anleitung zum christlichen Leben. Der frühe Calvin erweist sich als selbständiger Schüler Luthers. Zwingiis Abendmahlslehre, gesteht er in einer späteren Schrift, habe er schon vor dem Marburger Gespräch (1529) gekannt und abgelehnt. Weitere theologische Veröffentlichungen folgen. Noch im Jahre 1535 verfaßt er eine Vorrede für die französische Bibelübersetzung seines Vetters Olivetan. Das Werk war im Jahre 1532 von der Waldensersynode in Chanforan beschlossen, für die Druckkosten waren unter schweren Opfern 500 Goldtaler aufgebracht worden. Calvins lateinisches Vorwort „An alle Kaiser, Könige, Fürsten und Völker, die unter Christi Herrschaft stehen", führt aus, daß andere Bücher der Erlaubnis eines Fürsten bedürften, dieses Buch nicht, denn es enthalte die Offenbarung des höchsten Fürsten, des Königs der Könige. In dieser Weise fährt er fort, die Einzigartigkeit der Bibel aufzuzeigen. Mit dem Wunsch, daß den Gläubigen gestattet sei, sich aus Gottes Wort zu unterrichten, schließt er. Vor dem Neuen Testament findet sich eine zweite Vorrede. Sie enthält eine Abhandlung über die Einheit des Alten und Neuen Testamentes in Christus. In den Bibeln des 16. und 17. Jahrhunderts ist sie um ihrer Klarheit und Eindrücklichkeit willen oft abgedruckt worden. Im Frühjahr 1536 besuchten Calvin und du Tillet die Herzogin Renata von Ferrara. Die Italienreise konfrontiert Calvin erneut mit dem Problem der Teilnahme Evangelischer an der römischen Messe; er äußert sich nun literarisch dazu. Renata, die einzige Tochter des verstorbenen französischen Königs Ludwig XII. und Schwägerin Franz I., hatte im Jahre 1527
Institutio Christianae Religionis
29
Ercole d'Esté, Herzog von Ferrara, geheiratet. Ihr Hof war den evangelischen Flüchtlingen aus Frankreich geöffnet, unter ihnen dem Liederdichter Clément Marot. Durch eine Hofdame ließ sie Calvin wissen, sie würde ihn gerne empfangen. Beza berichtet, Calvin habe die Herzogin im Eifer für die wahre Frömmigkeit gestärkt, setzt aber hinzu: Soweit es die Umstände zuließen. Denn zu dieser Zeit setzte die Inquisition in Ferrara ein. Verhaftungen in der Umgebung der Fürstin erfolgten. Nur den Interventionen des Pariser Hofes war es zu verdanken, daß der Herzog schließlich einlenkte. Es ist anzunehmen, daß Calvin nur kurze Zeit in Ferrara geblieben ist; er trat dort unter dem Namen Charles d'Espeville auf. In Italien verfaßte er zwei Briefe - es sind kleine Abhandlungen - über das Verhalten Evangelischer unter katholischer Herrschaft. Sie sind im nächsten Jahr ohne Angabe der Adressaten in Basel gedruckt worden. Der erste ist an Calvins Freund du Chemin in Orleans gerichtet, dem er auf Anfrage schreibt, es gäbe erträgliche und unerträgliche Zeremonien und Satzungen in der römischen Kirche. Zu den letzteren zählt er die Bilderverehrung, den Empfang der Ölung, Kauf des Ablasses, Gebrauch des Weihwassers und Teilnahme am Meßopfer, weil es den Kreuzestod Christi aufhebe. Calvin spart nicht mit heftigen Worten über die Mißbräuche. Er will aber keine Gesetze aufstellen, sondern die Entscheidung den Gewissen der Einzelnen überlassen. Selbst die Anwesenheit im römischen Gottesdienst (nicht die Teilnahme an den genannten Zeremonien) will er freistellen, wenn nur das offene Bekenntnis zu Christus abgelegt wird. Zu bedenken sei auch, daß man sich am Nächsten versündige, wenn man sich den Irrtümern anpasse. Calvin stellt sich auch dem Einwurf, er rede von sicherem Ort aus. In dem zweiten Brief wendet er sich an Gérard Roussel, der gerade die Bischofswürde angenommen hatte. Schritt für Schritt entwickelt er, was Wächteramt, Kirche und Wort Gottes eigentlich bedeuten. Eindringlich stellt er ihm vor Augen, wieviele
30
Erste Genfer Wirksamkeit
Seelen schon in den wenigen Monaten, da er das Bischofsamt inne habe, durch seine Mitschuld verlorengegangen seien. Daher fordert er ihn strikt auf, das Amt niederzulegen. Als Mystiker wird Roussel die Konsequenz der Gedanken Calvins nicht verstanden haben. Befolgt hat er den Rat nicht. Aus Italien zurückgekehrt, begab sich Calvin für kurze Zeit nach Paris, holte seinen Bruder Anton und seine Schwester Marie und verließ Frankreich nun für immer. Er wollte sich mit ihnen an einem ruhigen Ort niederlassen. Da ereilte ihn der Ruf Gottes und durchkreuzte seine Pläne. Hören wir ihn selbst: „In Genf hielt mich Wilhelm Farel zurück, nicht etwa durch Zureden und Ermahnen, sondern durch eine furchtbare Beschwörung, als ob Gott vom Himmel her gewaltsam seine Hand auf mich legte. Da mir der Krieg den direkten Weg nach Straßburg gesperrt hatte, hatte ich vorgehabt, rasch durch Genf zu reisen und mich nicht länger als eine Nacht in der Stadt aufzuhalten. Nun war hier vor kurzem durch die Wirksamkeit des genannten trefflichen Mannes (Farel) und Pierre Virets das Papsttum niedergeworfen worden, doch waren die Verhältnisse noch ungeordnet und die Stadt in schlimmer, gefährlicher Weise in Parteien gespalten. Ein Mann, der seither in schmählichem Abfall wieder ins papistische Lager zurückgekehrt ist, hatte gleich verraten, wer ich sei, und darauf bemühte sich Farel mit aller Kraft, wie er denn von einem unglaublichen Eifer zur Förderung des Evangeliums förmlich glühte, mich festzuhalten. Als er nun hörte, ich wollte mich stillen Privatstudien hingeben, und sah, daß er mit Bitten nichts ausrichtete, da ließ er sich zu der Verwünschung hinreißen, Gott möge meiner Ruhe seinen Fluch senden, wenn ich ihm in solcher Not nicht helfen wolle. Da erschrak ich und gab die begonnene Reise auf."
5. Erste Genfer Wirksamkeit Als Calvin im Juli 1536 nach Genf kam, hatte die Stadt gerade die einschneidendste politische und religiöse Umwäl-
Erste Genfer Wirksamkeit
31
zung in ihrer wahrlich turbulenten Geschichte erlebt: Die Anhänger der Reformation hatten gesiegt und der Abhängigkeit von Savoyen war ein Ende gesetzt worden. Die Stadt, am Ausfluß der Rhone aus dem Genfer See gelegen, zählte etwa 13 000 Einwohner - Zürich hatte zur Zeit Zwingiis nur 7000 - war aber keineswegs eine mächtige Stadt, wenn auch Handwerk und Handel blühten. Von allen Seiten vom Herzogtum Savoyen umgeben, vermochten die Bürger Genfs in der Vergangenheit ihre ständische Verfassung nur mit Mühe vor dem Zugriff des Turiner Hofes zu retten. Im Jahre 1526 kam es zum Bruch mit Savoyen; Genf schloß sich der Eidgenossenschaft an. Durch Burgrechtsverträge mit Bern und Neuenburg verbündet, war es nun ganz auf den Schutz der beiden Kantone angewiesen. Denn da die Stadt kein nennenswertes Hinterland besaß, war sie plötzlichen Überfällen durch die westlichen Nachbarn - seit 1536 war es Frankreich - ausgesetzt. Genau genommen hatte man die Abhängigkeit von Savoyen gegen die von Bern eingetauscht. Der Machtwechsel wirkte sich auch kirchlich aus. Ohne den energischen Beistand des evangelischen Bern hätte sich die Reformation in Genf kaum durchsetzen können, denn Bischof und Domherren unterdrückten gewaltsam die evangelische Bewegung. Erst als ein Komplott zwischen dem Bischof und dem Herzog von Savoyen aufgedeckt wurde und der Bischof Genf verlassen hatte, gewann die protestantische Partei schnell die Mehrheit des Volkes. Es war aber nicht zu verkennen, daß auch der Patriotismus zum Sieg der Reformation in Genf beigetragen hatte. Die Reformatoren waren sich bewußt, daß im Fall eines politischen Umschwungs die religiöse Entscheidung schnell rückgängig gemacht werden konnte. Beim Eintreffen Calvins in Genf war die Reformation daher keineswegs gesichert; vor allem war sie in der Überzeugung der Bevölkerung noch nicht verwurzelt. Nur wenn alle diese Umstände beachtet werden, sind Calvins und Farels Wirken in Genf und ihre Vertreibung verständlich.
32
Erste Genfer Wirksamkeit
Eine Versammlung der Gesamtbürgerschaft Genfs hatte am 21. Mai 1536 einmütig und unter Eid die Einführung der Reformation bekräftigt. Die Ablösung der Stadt von Savoyen war bereits vorher durch den Einzug der Berner Truppen in das Waadtland besiegelt worden; Savoyen hatte keinen Widerstand geleistet. Das Gebiet Berns reichte nun bis vor die Tore Genfs. Beinahe hätte die reformatorische Bewegung in der Stadt einen schweren Rückschlag erlitten, weil die Berner Truppen auch Genf besetzt hatten. Nur durch die eindringlichen Vorstellungen Farels, der Berner Bürger war, wurde die Annektion der Stadt verhindert. Die Abhängigkeit von Bern konnte nicht augenscheinlicher sein. Einschneidender für die kirchliche Situation der Stadt war es, daß sich die evangelische Partei nach errungenem Sieg gespalten hatte. Eine Minderheit protestierte gegen den Befehl, den Sonntagsgottesdienst zu besuchen. Jene Männer hatten sich die Entledigung des römischen Jochs anders vorgestellt. Der Ruf nach „Freiheit" wurde laut. War die evangelische Freiheit oder bloße Ungebundenheit gemeint? Calvin war überzeugt, jene seien Verfechter eines zügellosen Lebens, „Libertiner", wie er sie später nennt. Als er seine Wirksamkeit in Genf begann, bildeten sich die Gegensätze erst langsam heraus. Die heftigen kirchlichen Auseinandersetzungen der beiden nächsten Jahrzehnte bahnten sich an. Verschiedentlich ist die Ansicht geäußert worden, Farel habe Calvin in Genf festgehalten, weil er sich den organisatorischen Aufbau der Kirche nicht zutraute. Anlaß zu dieser Vermutung könnte Farels ungestümes Verhalten sein. Oekolampad hatte den Feuerkopf schon früher mahnen müssen: „Du bist gesandt, das Evangelium zu verkünden, aber nicht um zu schmähen." „Es ist leicht, den Hörern ein paar Dogmen beizubringen und den Ohren einzuprägen. Die Seele aber zu ändern, das ist ein göttliches Werk." Inzwischen hatte Farel nun die Dringlichkeit erkannt, die Genfer von der evangelischen Lehre zu überzeugen.
Erste Genfer Wirksamkeit
33
Dazu bedurfte er der Mitarbeit Calvins. Das Amt des Organisators verblieb zunächst Farel. Calvin wirkte auf dem Gebiet, auf dem er sich schon ausgezeichnet hatte; er übernahm das neutestamentliche Lektorat am Genfer Gymnasium (College). Abweichend von der üblichen Unterrichtsform wurde dort Latein, Griechisch und Hebräisch gelehrt und auf diese Weise das Studium der Heiligen Schrift mit dem der antiken Schriftsteller verbunden. Ein neues, protestantisches Unterrichtsprogramm war entwickelt worden. Calvin fiel die Aufgabe zu, den Fortgeschrittenen mittags von zwei bis drei Uhr in der Kirche Sankt Peter die Paulusbriefe auszulegen. Er erklärte zuerst die griechischen Formen und legte den Schülern dann den Text aus, indem er ihn in den Zusammenhang des Neuen Testamentes stellte. Der Unterricht war geeignet, künftige Pastoren auf ihren Beruf vorzubereiten. Eine führende Stelle nahm Calvin damit in Genf noch keineswegs ein. Als Farel am 5. September beim Rat seine Anstellung durchsetzte, wußte der Schreiber nicht einmal seinen Namen. Ille Gallus - jener Franzose - heißt es im Ratsprotokoll. Am 13. Februar 1537 mußte Farel drängen, daß Calvin endlich ein Gehalt ausgezahlt wurde. Der Name des unbekannten Franzosen sollte jedoch bald bekannt werden, in Genf als Prediger und Verfasser der Kirchenordnung, des Katechismus und des Glaubensbekenntnisses im Waadtland und darüber hinaus durch sein Hervortreten auf der Disputation zu Lausanne. Zuerst erregte der neue „Lektor der Heiligen Schrift" außerhalb der Rhonestadt Aufmerksamkeit. Die Berner standen vor der Aufgabe, im Waadtland die Reformation einzuführen. Es hätte ein Befehl der Regierung genügt, um das katholische Kirchenwesen abzuschaffen. Doch legte man in den Städten und Kantonen Wert darauf, die Rechtmäßigkeit der neuen Ordnung zuvor in öffentlichen Disputationen zu beweisen. Daher erließ der Berner Rat eine Einladung zu einer Disputation nach Lausanne, für die Farel zehn Thesen verfaßte. Der 3
Neuser, Calvin
34
Erste Genfer Wirksamkeit
Bischof von Lausanne erschien nicht, da er jedes Religionsgespräch ablehnte, das nicht unter römisch-katholischer Leitung stand. Zudem bedeutete die Beweisführung alleine aus der Heiligen Schrift eine Vorentscheidung. In der vollbesetzten Kathedrale von Lausanne wehrten sich die katholischen T h e o logen trotzdem nach Kräften. Erst am fünften Tage, als sie die Autorität der Kirchenväter gegen die reformierte Abendsmahlslehre anführten, meldete sich Calvin zu Worte. Z u m Erstaunen der Anwesenden zitierte er aus dem Gedächtnis die Ansichten Tertullians, Augustins und des Chrysostomos und bewies die Übereinstimmung der evangelischen Lehrer mit ihnen. Doch ging er noch weiter: Bedeutete nicht die Berufung auf die Kirchenväter eine Beschränkung der Schriftautorität? Calvin verwies darauf, daß die Evangelischen sich aus ihren Schriften gerne belehren ließen, sich ihrem Urteil aber nicht unterwerfen könnten, weil das W o r t Gottes es verbiete. Den Einwand, daß der jede Autorität verwerfe — selbst die der Gesetze und der Obrigkeit - der ihre Autorität nicht annehme, lehnte er ab. Die Väter hätten nie die Autorität für sich in Anspruch genommen, die der Papst für sich fordere. Das amtliche Protokoll vermerkt: „Die Gegner, die eben noch trotzige Gesichter gemacht hatten, da Farel ihnen nicht zu antworten wußte, waren wie zu Boden geworfen vor der Kraft dieser Beweise; sie verstummten ohne Erwiderung." W e n n man Calvins Rede im Auge behält, wird der Streit mit Caroli verständlich, der im Januar 1 5 3 7 ausbrach und bei den Zeitgenossen viel Aufsehen erregte. Pierre Caroli, wie Calvin ein französischer Flüchtling, war in Lausanne als Pfarrer eingesetzt worden. Als er die Gebete für die T o t e n verteidigte, befürchteten die Genfer Theologen einen Rückfall in den Katholizismus und entsandten Calvin zur Klärung des Falles nach Lausanne. Caroli bezichtigte nun seinerseits die Genfer des Arianismus, was besagte, daß sie die volle Gottheit Christi leugneten. Zur Begründung führt er an, in dem neuen Genfer Katechismus fehlten die Begriffe „Trinität" und göttliche „Per-
Erste Genfer Wirksamkeit
35
son". Calvin konnte beweisen, daß im Katechismus nichts anderes gelehrt sei, als was diese Begriffe besagten, wenn auch die Worte fehlten. Caroli stieß nach und verlangte die Anerkennung der drei altkirchlichen Bekenntnisse, insbesondere des Athanasianums, durch Unterschrift. Wer diese Glaubensbekenntnisse nicht annehme, sei kein Christ. In seiner Entgegnung wies Calvin daraufhin, daß der Kirchenvater Athanasius nicht der Verfasser sei. Einen Zwang, die altkirchlichen Lehrbegriffe und Symbole zu verwenden und anzuerkennen, lehnte er ab. Offensichtlich wollte er jede Verpflichtung auf eine kirchliche Tradition vermeiden. Den Prinzipien des römischen Katholizismus, den man noch im eigenen Land nicht besiegt hatte, durfte kein Vorschub geleistet werden; die Autorität der Heiligen Schrift duldete keine Einschränkung. Nun hätte Calvin auf seine Institutio von 1536 verweisen können, doch war sie in Genf nicht offiziell angenommen. Schließlich beriefen sich die Genfer auf das Zweite Baseler Bekenntnis (1536), das die gewünschten Begriffe enthielt und der Heiligen Schrift der „Richtschnur des Glaubens und der Liebe", die Kirchenlehrer unterordnete. Caroli verlor sein Amt; er ist zum Katholizismus zurückgekehrt. Sicherlich war sein Verdacht gegen Calvins Christologie nicht völlig grundlos. Der Reformator hat immer die Einheit Gottes stärker betont als die Dreiheit. Im Servetprozeß (1553) sollte die Frage erneut gestellt werden, nun an Servet. Der rechtliche Hintergrund ist in beiden Fällen der gleiche: Das Reichsrecht forderte für die Antitrinitarier die Todesstrafe. Der Genfer Katechismus bietet eine Zusammenfassung der Institutio. Seine sechs Teile sind überschrieben: Von Gott und vom Menschen, vom Gesetz des Herrn, vom Glauben, vom Gebet, von den Sakramenten, von der Ordnung in Kirche und Staat. Die Ausführungen im letzten Teil enthalten einen Vorstoß in den politischen Raum. Auffällig ist die große Autorität, die den Inhabern des Predigtamtes zugesprochen wird. Da der Katechismus nicht in Frage und Antwort gefaßt ist, scheint 3*
36
Erste Genfer Wirksamkeit
er uns nicht die Form eines Jugendkatechismus zu haben. Indessen wurde die Bevölkerung dringend ermahnt, die Kinder zur Unterweisung zu schicken. Diese Bestimmung findet sich in der neuen Kirchenordnung, in den „Artikeln über die Organisation der Kirche und des Gottesdienstes" (1537). Den größten Raum nimmt in ihnen die Regelung der Kirchenzucht ein. Diese für Calvin und Farel zentrale Lehre — sie wird auch in der Institutio und im Katechismus behandelt - will die „Gemeinschaft der Heiligen" schützen und fördern. Calvin ist überzeugt, daß die Kirche der Glaubenden um der Ehre Gottes willen rein erhalten werden muß. Der verderbliche Umgang mit den Bösen soll unterbunden und ihnen der Weg zur Besserung gewiesen werden. Nur offene Verletzung der zehn Gebote aber auch Trunksucht u. a. fielen unter die Kirchenzucht. Durch Christi Weisung Matthäus 18, 15 ff. war das Vorgehen gegen die Übertreter genau geregelt. Auf die zuerst geheime, dann öffentliche Ermahnung folgte der Ausschluß aus der Gemeinde (Exkommunikation), wenn sich keine Einsicht zeigte. Der Übeltäter durfte nun nicht mehr am Abendmahl teilnehmen; die Gemeinde sollte den „familiären" Umgang mit ihm meiden. Doch wurde der Ausgeschlossene ermahnt, fleißig zur Predigt zu kommen, damit er durch ständige Belehrung zu Besinnung gelange und wieder in die Gemeinde aufgenommen werden könne. Problematisch wird die Kirchenzucht durch das Selbstverständnis Genfs als christliches Gemeinwesen (civitas christiana). In jener Zeit sind ganz selbstverständlich die Stadt- und Staatsgrenzen zugleich die Grenzen der Kirche; jeder Bewohner ist (abgesehen von den Juden) Christ. Daher erscheint bei Calvin ein doppelter Kirchenbegriff: Kirche sind die Glaubenden, zugleich aber alle Einwohner der Stadt. Neben dem biblischen Kirchenverständnis steht die mittelalterliche Bezeichnung des Staates als christlicher Leib (corpus christianum), während der Apostel Paulus nur die Kirche ,Leib Christi' nennt. Daher ist die christliche Obrigkeit verpflichtet, den Anordnungen der
Erste Genfer Wirksamkeit
37
Kirche Geltung zu verschaffen. Sie muß die Ehre Gottes schützen. Wenn daher ein öffentlicher Sünder aus der Kirche ausgeschlossen worden war und keine Besserung zeigen wollte, zog er sich staatliche Strafen zu. Zwar betont Calvin, daß die Kirchenzucht ohne Gewaltanwendung erfolgen müsse. In den „Artikeln" wird sie auf Ermahnung und Ausschluß aus der Gemeinde beschränkt. Fehlt aber nicht gerade das Moment der Freiwilligkeit, wenn der Ausgeschlossene mit staatlichen Strafen rechnen muß? Für die praktische Durchführung wird der Vorschlag gemacht, Männer mit gutem Leumund in den einzelnen Stadtbezirken einzusetzen, die den Predigern alles Tadelnswerte melden sollten. Wenn die Ermahnungen nicht fruchteten, sollte die Angelegenheit vor die versammelte Gemeinde gebracht und die Exkommunikation beschlossen werden. Älteste (Presbyter) und Kirchenzuchtsbehörde (Konsistorium) erscheinen noch nicht. Die Kirchenzucht fand jedoch nicht die Billigung des Genfer Rates. Am 27. Juli 1537 bestimmte er, daß die Vorsteher der Stadtbezirke die Sünder erst allein, dann im Beisein anderer Männer ermahnen und sie schließlich der Obrigkeit melden sollten, die sie mit Strafe belegt. Statt Kirchenzucht also staatliche Sittenzucht. Da Farel und Calvin nicht nachgaben, mußte es zum offenen Zusammenstoß mit dem Rat kommen. Anlaß gab der Vorschlag in den „Artikeln", die Reformation in Genf durch einen Eid aller Bürger zu sichern. Einen Reformationseid hatte es auch vorher schon in Genf und Basel gegeben. Beeidet werden sollte ein von Calvin verfaßtes „Glaubensbekenntnis" von 21 Artikeln, das einen Auszug aus dem Katechismus darstellt. Im 19. Artikel wird die Exkommunikation behandelt. Der Rat stimmte dem Eid zu, aber die Bürger erschienen nicht vollzählig zur Eidesleistung. Ein Beschluß vom 19. September 1537, die Verweigerer aus der Stadt zu verbannen, konnte wegen deren großer Zahl nicht durchgeführt werden. Der Widerstand gegen eine neues Joch, nachdem das alte abgeworfen war, war
38
Erste Genfer Wirksamkeit
zu mächtig. Bei den Ratswahlen im Frühjahr 1538 siegte die Opposition. Eingriffe des Rates in die Rechte der Pfarrer kamen vor. Auch wurde die Einführung der sogenannten Berner Riten (Oblaten beim Abendmahl, Taufstein, vier Wochenfeste), befohlen, die in Genf gerade abgeschafft worden waren. Daraufhin verweigerten Calvin und Farel am Ostersonntag 1538 (21. April) in den Kirchen Sankt Peter und Sankt Gervais der ganzen Gemeinde das Abendmahl - „die großartigste Exkommunikation, welche die Geschichte kennt: eine ganze Stadt wurde vom Abendmahl ausgeschlossen von zwei Prädikanten, wer hätte das je gewagt!?" (W. Köhler). Auch ein Predigtverbot des Rates nach Bekanntwerden ihrer Absicht hatte sie nicht hindern können. Später hat Calvin erklärt, es seien nicht die Zeremonien gewesen, die sie zur Abendmahlsverweigerung veranlaßt hätten, sondern die sittlichen Mißstände im Volk, die Verspottung des Evangeliums und die Weigerung des Rates, gegen die Mißstände einzuschreiten. Binnen drei Tagen mußten Farel, Calvin und der blinde Courault die Stadt verlassen. Im Ratsprotokoll heißt es: „Genannte Prediger haben daraufhin erwidert: Nun wohlan! Wenn wir Menschen gedient hätten, wären wir übel belohnt worden. Aber wir dienen einem großen Herrn, der uns belohnen wird. So hat Calvin geantwortet. Herr Farel hat entgegnet: Wohlan! Es ist gut, denn es kommt von Gott." Farel und Calvin haben ihre Absetzung nicht anerkannt, wenn sie sich auch der Ausweisung nicht widersetzten. Weiterhin bezeichneten sie die Genfer Kirche zum Ärger ihrer Widersacher als „ihre" Kirche. Da sie einer ganzen Stadt im Namen ihres himmlischen Herrn Widerstand geleistet hatten, konnte ihrer Meinung nach weder der Rat noch die Bürgerversammlung sie von ihren Pflichten als Pfarrer entbinden. Der Auftrag ihres Herrn blieb bestehen. Daher wandten sie sich nach Bern, um ihre Rehabilitation zu erreichen. Der Berner Rat war über die Geschehnisse in Genf erschrocken, drohte doch jetzt die Rekatholisierung der Stadt und der Anschluß an Frankreich.
Calvin in Straßburg
39
Obgleich er den Genfer Pfarrern im Zeremonienstreit entgegengearbeitet hatte, setzte er sich nun in Genf für die Rückkehr ein. Vielleicht hätte die Intervention des mächtigen Bern Erfolg gehabt. Calvin und Farel waren aber nicht bereit, unter den alten Bedingungen in Genf ihre Arbeit wiederaufzunehmen. Sie setzten Artikel auf, in denen sie eine festgeordnete Kirchenzucht forderten. Zu diesem Zweck sollte die Stadt in Bezirke eingeteilt, genügend Pfarrer angestellt und vor allem die von ihnen geforderte Exkommunikation eingeführt werden. Auch der Psalmengesang und monatliche (wenn schon nicht sonntägliche) Abendmahlsfeiern gehörten zu den Forderungen. Es gelang den beiden Reformatoren, die Unterstützung der gerade in Zürich tagenden Synode zu gewinnen. Der Berner Rat fand sich nun bereit, sie durch Gesandte in die Stadt Genf bringen zu lassen und ihre öffentliche Anhörung durchzusetzen. Der zum Luthertum neigende Berner Pfarrer Kunz hintertrieb jedoch den Plan. Den Genfern wurden die von der Synode gebilligten Artikel zugespielt. Mit Leidenschaft wandten sich nun viele in der Stadt gegen die „Tyrannei" und das „neue Papsttum" - wie die Kirchenzucht genannt wurde. Den Ausgestoßenen verwehrten die Genfer mit Waffengewalt den Eintritt in die Stadt, so daß sie unverrichteter Dinge wieder umkehren mußten.
6. Calvin in Straßburg und seine Teilnahme an den Religionsgesprächen von Hagenau, Worms und Regensburg (1538-1541) Etwa ein Vierteljahr weilte Calvin im Hause des bekannten Baseler Theologen Simon Grynäus. Während dieser Zeit sträubte er sich hartnäckig, in einer schweizer oder oberdeutschen Stadt einen ebenso schwierigen Dienst wie in Genf zu übernehmen. Schließlich gab er dem Drängen der Straßburger nach, die ihm mit der Sammlung einer französischen Flücht-
40
Calvin in Straßburg
lingsgemeinde beauftragten. Konnte er nun in einer Gemeinde wirken, die sich ernstlich um die Heiligung des Lebens bemühte? In Straßburg galt die Kirchenordnung von 1534. In ihr wird einer Kommission, bestehend aus sieben Männern, die Beaufsichtigung der Kirche übertragen. Auf Vorschlag Martin Bucers werden sie sogar den neutestamentlichen Ältesten gleichgesetzt und erhalten so biblische Autorität. Dieser Schritt hätte zur Selbständigkeit der Kirche in Bezug auf die Kirchenzucht führen können; er vermochte jedoch die Kirchenhoheit des Straßburger Rates nicht zu schmälern. Die Siebenerkommission zwei Ratsherren, drei Kirchspielpfleger und zwei Prediger war hauptsächlich f ü r die Lehre verantwortlich u n d konnte ohne Ratsbeschluß nicht eingreifen. Den Lehrfragen kam innerhalb der Kirchenzucht große Bedeutung zu, denn in Straßburg hatten sich in der Vergangenheit Antitrinitarier und Täufer niedergelassen. In der deutschen Öffentlichkeit war die Rechtgläubigkeit der Stadt bereits in Zweifel gezogen worden. Die Sittenzucht lag in den Händen der 21 Kirchspielpfleger. Doch beschränkte sich ihre Befugnis auf die seelsorgerliche Ermahnung. Der Ausschluß vom Abendmahl und andere geistliche Strafen werden in der Kirchenordnung nicht erwähnt. Der Rat der Stadt wollte so einem neuen Papsttum begegnen. Das Siebenergericht hatte nur Verstöße gegen die Sonntagsheiligung, unziemliches Verhalten im Gottesdienst bzw. während der Gottesdienstzeit und ähnliches zu strafen, Vergehen, die sich gegen die Sittengesetze der Stadt als civitas christiana richteten. Endlich bestand die Konvokation („Convocatz"), eine Zusammenkunft der Prediger und drei Kirchenpfleger, die alle 14 Tage donnerstags stattfand. In der Folgezeit haben sich die Pfarrer oft über das Versagen der Kirchenzucht beim Rat beklagt. Da die Entscheidungen letztlich beim Rat lagen, dieser aber nur an einer christlichen Sittlichkeit im landläufigen Sinne gelegen war, kam es in Straßburg zu keiner wirksamen Kirchenzucht.
Calvin in Straßburg
41
Die kleine französische Flüchtlingsgemeinde fand in der Straßburger Öffentlichkeit wenig Beachtung. Calvin besaß daher größere Bewegungsfreiheit als die Stadtpfarrer, um das Leben seiner Gemeinde zu ordnen. Aus den wenigen Nachrichten, die wir besitzen, geht hervor, daß Calvin eine strenge Kirchenzucht aufzurichten versucht hat. Er führte die monatliche Abendmahlsfeier ein und verlangte wegen der vielen Unwürdigen vor dem Osterabendmahl im Jahre 1540 die vorherige Anmeldung aller Teilnehmer beim Pfarrer. Sie werden bei dieser Gelgenheit geprüft. Calvin versteht die Prüfung als Unterricht, Ermahnung und Tröstung - je nach dem besonderen Fall. Dem Einwand, die „papistische" Beichte werde auf diese Weise erneuert, begegnet er mit der Feststellung, es gebe auch eine christliche Beichte. Calvin wird sich kaum bewußt gewesen sein, daß er sich mit dieser Praxis dem lutherischen Brauch näherte. Wenn das spätere Abendmahlsformular der Straßburger Fremdengemeinde tatsächlich in allen Einzelheiten auf Calvin zurückgeht, so hat der Reformator zwölf Älteste zur Seite gehabt, die von der Gemeinde gewählt wurden. Wöchentlich wurde zum Kirchenkonvent eingeladen, auf dem alle dringenden Fragen der Gemeinde behandelt wurden. Trotz mancher Auseinandersetzungen muß ein idealer Zustand geherrscht haben. Der Rat der Stadt machte seine Kirchenhoheit nicht geltend; die Flüchtlinge aber stellten, durch ihre Herkunft bedingt, fast eine Freiwilligkeitsgemeinde dar, die ihre Streitigkeiten nicht vor den Rat gelangen ließ. Die kleine Zahl der Gemeindeglieder scheint Calvin einen engen seelsorgerlichen Kontakt erlaubt zu haben. Zum Neubau der Gemeinde gehörte, daß Calvin auch den Gottesdienst neu ordnete. Es ist umstritten, ob er die Predigtund Abendmahlsordnung selbständig umgestaltet hat. Vielleicht ist die Liturgie der französischen Fremdengemeinde lediglich der Straßburger Ordnung angepaßt worden. Wie dem auch sei, es bedurfte gründlicher Überlegungen, Verkündigung, Gebet, Bekenntnis und Lobpreis den rechten Platz im Gottesdienst
42
Calvin in Straßburg
zu geben. Hinzu kam, daß in den evangelischen Gemeinden der Gesang eingeführt wurde. Es mußten neue Lieder gedichtet und vertont werden. Im Jahre 1539 erschien ein französisches Gesangbuch mit dem Titel „Einige Psalmen und Lieder in Musik gesetzt", das sich ganz eng an biblische Texte hielt. 18 Psalmen und der Lobgesang des Simeon, die zehn Gebote und das Glaubensbekenntnis waren in Verse gefaßt worden. Einen Teil der Psalmen hatte der berühmte Dichter Clement Marot verfaßt, sieben stammten von Calvin. Eine allzu hohe Meinung scheint er von seinem Werk nicht besessen zu haben, denn er hat sie später zurückgezogen. In seiner Gemeinde predigte Calvin viermal in der Woche. Hinzu kam der wöchentliche Kirchenkonvent und die umfangreiche Einzelseelsorge. Zu Beginn seiner Straßburger Tätigkeit erhielt er jedoch monatelang keine Bezahlung. Bucer und Capito hatten ihn, wie es scheint, aus eigener Initiative gerufen; sie besorgten ihm Kost und Logis. Um seine Anstellung scheint sich Calvin auch nicht gesorgt zu haben. Ihm genügte, daß er von der „Kirche zu Straßburg" berufen worden war. Freimütig berichtete er, daß er den Kollegen nicht zur Last fallen wolle und darum von Ersparnissen und dem Verkauf seiner Bibliothek lebe. „Ich hoffe, der Herr wird mir, wenn's nötig ist, wieder einmal andere Bücher geben", schreibt er du Tillet. Im Januar 1539 begann er, von Capito dazu aufgefordert, Vorlesungen am Gymnasium zu halten. Nun erst empfing er für seinen Schul- und Pfarrdienst eine Besoldung von einem Taler wöchentlich. Im Sommer 1540 sollte der geringe Betrag verdoppelt werden, doch zerschlug sich das Vorhaben, weil das Geld nicht verfügbar war. Wie in Genf übernahm Calvin die Erklärung des Neuen Testamentes. Zuerst legte er das Johannesevangelium aus, darauf die Korintherbriefe. Die Erklärung des Römerbriefes scheint sich angeschlossen zu haben, denn im März 1540 erschien sein Kommentar zu diesem Paulusbrief in Straßburg im Druck. Unter den evangelischen Theologen jener Zeit galt der
Calvin in Straßburg
43
Römerbrief als die schwierigste und wichtigste neutestamentliche Schrift, geradezu als ein Schlüssel zur Bibel. Calvin ist sich des Wagnisses, mit einer Auslegung dieses Briefes an die Öffentlichkeit zu treten, wohl bewußt, wie sein Widmungsschreiben an Simon Grynäus vom 18. Oktober 1539 beweist. Vorher hatte er bereits unter dem Anagramm Alcuinus die Institutio in neuer Fassung ausgehen lassen. Der Bezeichnung Institutio christianae religionis war hinzugesetzt, „die erst jetzt wirklich ihrem Titel entspricht". Calvin hat das Werk keineswegs neu geschrieben, wie der Zusatz vermuten lassen könnte. Der bisherige Text war nach Möglichkeit beibehalten worden - diesem Grundsatz folgt Calvin auch in den späteren Ausgaben. Und doch war das Buch kaum wiederzuerkennen. Aus dem Büchlein von sieben Kapiteln ist ein Werk von siebzehn Kapiteln geworden. Dementsprechend erscheinen neue Überschriften: Buße, Glaubensgerechtigkeit und Verdienst auf Grund der Werke, Altes und Neues Testament, Prädestination und Vorsehung. Es liegt auf der Hand, daß Calvin die Themen des Römerbriefes aufgenommen und breit ausgeführt hat. Die Institutio erhielt nun ihren berühmten Eingangssatz von der Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis des Menschen, die einander entsprechen. In diesen beiden Teilen, heißt es, bestehe die Summe christlicher Weisheit. Die Erweiterung, aber auch der neue Aufriß und Inhalt lassen diese Ausgabe nun doch als ein neues Buch erscheinen. Kardinal Sadolet hatte im März 1539 ein Schreiben an die Genfer gerichtet, mit dem er sie zur Rückkehr zur römischen Kirche zu bewegen suchte. Als geschultem Humanisten fiel es ihm nicht schwer, sich auch für evangelische Leser überzeugend über Gott, Religion und Bibel zu äußern. Wie selbstverständlich führen seine Darlegungen zur Kirche Roms und trachten Liebe zu ihr zu wecken. Er selbst nennt sie fast durchgehend die allgemeine Kirche (ecclesia catholica). Die Schuld an der Zerstörung der kirchlichen Einheit gibt er „einigen schlauen Männern", die vorher schon in anderen Schweizerstädten ihr
44
Calvin in Straßburg
Wesen getrieben hätten. Die Worte zielen auf die Genfer Pfarrer hin, allen voran Farel. Sie werden als Betrüger und Neuerer beschimpft. Die Antwort, die der Genfer Rat zu geben beschloß, kam nicht zustande. Es überrascht nun, daß die Berner auf Vorschlag ihrer Pfarrer Calvin auffordern, eine Entgegnung abzufassen. Jener verhielt sich zunächst ablehnend. Er unterhielt noch briefliche Beziehungen zu seinen Genfer Anhängern, die er als „Übriggebliebene aus der Zerstörung der Kirche in Genf" anredete. Wer aber erwartet, Calvin werde sie aufstacheln, seine und Farels Rückkehr zu betreiben, verkennt sein seelsorgerliches Denken. Vielmehr fordert er sie auf, das Geschehene demütig als Gericht Gottes zu begreifen, vom Herrn nun alles zu erwarten, und sich den falschen Ideen der Gegner zu widersetzen. Als seine Getreuen die neuen Genfer Pfarrer nicht anerkennen wollen, mahnt er sie energisch zur Eintracht. In Genf werde das Predigtamt auch durch die neuen Pfarrer evangelisch versehen, mögen jene auch Eindringlinge sein. „Es darf euch durchaus nicht unwichtig erscheinen, daß in der Kirche Spaltungen und Sekten entstehen und begünstigt werden. Kein Christenherz kann das ohne Erschrecken hören." „Die Ruhe der Kirche gilt mir mehr, als daß ich sie meinetwegen gestört haben will." Schließlich läßt er sich durch die Straßburger zum Schreiben bewegen. Nur sechs Tage benötigt er für seine Antwort. Es gibt wohl keine Schrift Calvins, die so mitreißend und scharfsinnig zugleich ist. Auf wenigen Seiten ist die Reformation der Kirche umfassend beschrieben und begründet. Ohne Schwierigkeit entreißt er Sadolet den Kirchenbegriff. Kirche sei da, wo Christus verkündigt und geglaubt werde - nicht im Papsttum. Neuerer seien nicht sie, sondern die römischen Theologen, die sich nicht an die Heilige Schrift gehalten hätten. Daher könnten die Evangelischen auch nicht die Kirche gespalten haben, denn sie hätten sich lediglich dorthin gestellt, wo das Banner Christi wehe. So geht es Schlag auf Schlag. Eine Lehre nach der ande-
Calvin in Straßburg
45
ren wird in dieser Weise besprochen. Ein Gebet von tiefer Glaubensüberzeugung und dichterischer Schönheit schließt die Schrift. Nirgends ist Calvins feuriger Geist und seine Sprachgewalt besser zu erfassen als in der Responsio ad Sadoletum. Bei ihm bedingen einander Stil und Temperament. Dem Betrachter muß er im allgemeinen kühl und nüchtern erschienen sein; dieses Bild spiegelt beispielsweise die Institutio wider. Die wissenschaftliche Arbeit mit ihrer strengen Logik zügelten sein Temperament. Ein ganz anderes Bild bot Calvin in seinen Predigten. Dort galt es Stellung zu nehmen und zu überzeugen. Calvin muß ein feuriger, mitreißender Prediger gewesen sein. Von dieser Art ist auch seine Entgegnung an Sadolet. Es kam aber auch vor, daß Calvin seine Haltung verlor und heftig wurde. In Straßburg überkam ihn einmal ein Wutanfall, als Pierre Caroli, auf seine Rehabilitierung dringend, Calvin die Schuld an seinem Rücktritt zum Katholizismus gab. Jahre später muß er eingestehen, gegenüber Westphal in einer Schrift ausfallend geworden zu sein. Er selbst bedauert diese Schwäche. „Ich gebe zu, ich bin reizbar, und wie sehr auch dieser Fehler mir mißfällt, habe ich doch in seiner Bekämpfung nicht solche Fortschritte gemacht, wie ich wohl wünschte." Noch aufschlußreicher ist sein Eingeständnis, er sei „von Natur aus ängstlich, weich und kleinmütig". Aus ihm wird die Selbstüberwindung deutlich, zu der er sein Lebenlang gezwungen war. Von Natur aus kein Kämpfer, mußte er ständig im Kampf stehen, seitdem er Genfer Boden betreten hatte. Nur weil er von seiner Aufgabe völlig ergriffen war, blieb er im Streit unnachgiebig. Er vermochte es, weil er nicht in eigener Sache handelte, sondern sich von seinem himmlischen Herrn berufen wußte. Das Sendungsbewußtsein und die Leidensbereitschaft der Calvinisten gehen auf Calvin selbst zurück. Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, nahm Calvin Studenten ins Haus. Mit seiner Haushälterin hatte er aber viel Schwierigkeiten. Schon bald dachte er in Straßburg ans Heiraten. Nach
46
Calvin in Straßburg
der Sitte der Zeit halfen ihm die Freunde suchen. Auf diese Weise erfahren wir, wie sich Calvin seine Frau dachte. An Farel schreibt er: „Ich gehöre nicht zu den törichten Liebhabern, die, wenn sie einmal von der Gestalt (einer Frau) hingerissen sind, auch ihre Fehler preisen. Die einzige Schönheit einer Frau, die mich anlockt, ist, wenn sie züchtig ist, willfährig, nicht hochmütig, sparsam, geduldig, und ich hoffen darf, daß sie für meine Gesundheit Sorge trägt." Mehrere Heiratsprojekte zerschlugen sich, bis er im August 1540 die Witwe Jean Stordeurs, eines früheren Wiedertäufers heiratete. Calvin hatte jenen, der mit seiner Familie aus Lüttich hatte fliehen müssen, von der Richtigkeit der evangelischen Lehre überzeugen können; im Frühjahr 1540 starb er jedoch an der Pest. In Straßburg konnte Calvin viele Täufer gewinnen. Zu ihm brachten sie ihre Kinder zur Taufe. Idelette de Bure, wie Calvins Frau mit Mädchennamen hieß, brachte ihm zwei Kinder mit in die Ehe. Nur wenig erfahren wird durch Calvin über seine Frau. Er war, wie überhaupt seine Zeit, sehr zurückhaltend mit Berichten über sein Familienleben. Von der Lebenslust Luthers ist bei ihm kaum etwas zu spüren. Man wird dafür keine theologischen Gründe suchen müssen. Allein die Tatsache, daß Calvin schon früh von Krankheiten geplagt wurde (Magenschwäche, Nierenleiden, Gicht u. a.), kann sein Verhalten genügend erklären. Schon im Jahre 1549 starb Idelette. Calvin hat sehr um sie getrauert. „Genommen ist mir die beste Lebensgefährtin. Wäre mir etwas Schlimmes widerfahren, sie hätte nicht nur willig Verbannung und Armut mit mir geteilt, sondern auch den Tod. Solange sie lebte, war sie mir auch eine treue Helferin in meinem Amt." Aber beide verband nicht nur der gleiche Glaube und der gemeinsame Dienst. Calvins Bericht von ihren letzten Tagen zeigt, welch inniges Verhältnis zwischen beiden herrschte. Die Kinder, die ihnen geboren wurden, starben alle bald nach ihrer Geburt. „Gott hatte mir ein Söhnlein gegeben; er hat es wieder genommen. (Mein Gegner Balduinus) zählt dies unter seinen Beschimpfungen auf: ich hätte keine Kinder.
Calvin in Straßburg
47
Aber ich habe Zehntausende von Söhnen in der ganzen christlichen Welt", schreibt Calvin zwei Jahre vor seinem Tode. In der Straßburger Zeit konnte Calvin auch auf einem ihm noch fremden Gebiet Erfahrungen sammeln. Er lernte die oekumenische Weite der Theologie und Kirche kennen. Von seiner Schweizerzeit her waren ihm die Waldenser in den südlichen Alpentälern wohlbekannt. In Straßburg begegneten ihnen zwei Abgesandte, die auf dem Weg zu den Böhmischen Brüdergemeinden waren. Er konnte sich aber mit ihnen nicht über die Rechtfertigung einigen, denn er gewann den Eindruck, jene schrieben sie dem eigenen Verdienst zu. Durch Matthias Czervenka, der damals in Straßburg weilte, kam er mit den Böhmischen Brüdern in Berührung. Er forschte ihn über die Sprache, Geschichte und Lehre seiner Kirche aus. Als Calvin sich über den Namen Pikharden verwunderte, erfuhr er, daß er ein Schimpfname sei, der keineswegs auf die Herkunft der Böhmischen Brüder aus der Pikardie hinweise. Mit dem Brüderbischof Johannes Augusta trat er in Briefwechsel. Die nachhaltigsten oekumenischen Eindrücke gewann er jedoch durch die Religionsgespräche von Hagenau, Worms und Regensburg. Dort begegnete er den berühmtesten protestantischen Theologen und beteiligte sich an ihren Diskussionen. Während er bisher die katholischen Theologen nur als Verfolger der Protestanten kennengelernt hatte, erlebte er nun, daß Gespräche mit ihren Führern möglich waren. Aus seinen Äußerungen ist zu entnehmen, daß er in Hagenau, Worms und Regensburg vor allem drei Ziele verfolgte, die Einheit zwischen den Schweizern und deutschen Lutheranern herzustellen, die Annäherung an die gemäßigt denkenden Katholiken zu fördern und den verfolgten Glaubensbrüdern in Frankreich Hilfe zukommen zu lassen. Einen ersten Vorstoß zur Einigung der Protestanten hatte Calvin schon bald nach seiner Übersiedlung nach Straßburg unternommen. Als Bucer Anfang Oktober 1538 nach Wittenberg reiste, gab er ihm für Melanchthon zwölf Abendmahls-
48
Calvin in Straßburg
artikel mit. Aus eigenem Entschluß reiste er dann im Februar 1539 nach Frankfurt, um den berühmten Wittenberger Theologen persönlich kennenzulernen und zu sprechen. Da die Schmalkaldener dort ihren Bundestag hielten, hoffte er bei dieser Gelegenheit wirksamen Beistand für die französischen Protestanten finden zu können. Melanchthon stimmte Calvins Abendmahlslehre grundsätzlich zu, wies aber darauf hin, daß es Lutheraner gäbe, die die Präsenz Christi im Abendmahl gröber lehrten. Jener fürchtete neue Streitigkeiten. Für einen Unionsversuch zwischen Wittenberg und Zürich waren die Abendmahlsartikel Calvins daher ungeeignet. Bei diesem Gespräch schnitt Calvin auch die übrigen kontroversen Themen an: Die Notwendigkeit einer evangelischen Kirchenzucht, die Überfülle der gottesdienstlichen Zeremonien im Luthertum und insbesondere die Bilder in den Kirchen. Melanchthon zeigte für Calvins Anliegen zwar Verständnis, hielt aber einschneidende Maßnahmen auf diesen Gebieten teils für unwichtig teils für wünschenswert wenn auch jetzt nicht durchführbar. Es kann sein, daß dieser Teil des Gespräches der dringenden politischen Notwendigkeit entsprang, die Einheit des deutschen Protestantismus zu festigen. Denn Calvin hatte am 25. Februar in Frankfurt die Bekanntgabe des kaiserlichen Beschlusses miterlebt, ein Unionsgespräch zwischen Katholiken und Protestanten zu veranstalten. Die Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes waren sich darüber einig, daß man den Kaiser dieses Mal mit einem einheitlichen Bekenntnis gegenübertreten müsse. Das Schauspiel evangelischer Zwietracht auf dem Augsburger Reichstag im Jahre 1530 sollte sich nicht wiederholen. Wie zerbrechlich der Abendmahlsfriede war, sollte Calvin noch im gleichen Jahr persönlich erfahren. Als Straßburger Pfarrer stand er im Schutz der Wittenberger Abendmahlskonkordie, die im Jahr 1536 Luther und seine Anhänger mit den oberdeutschen Reformierten abgeschlossen hatten. Zugleich mit der Konkordienformel hatte Calvin die Augsburger
Calvin in Straßburg
49
Konfession und deren Apologie anerkannt, die in dem Dokument ausdrücklich genannt werden. Obgleich er in der Schweiz Pfarrer gewesen war, traf ihn unter diesen Umständen nicht das Mißtrauen der Lutheraner. Das änderte sich sofort, als im Herbst 1539 die Neufassung der Institutio und der Brief an Sadolet im Druck erschienen. Die Nürnberger Theologen beschwerten sich bei Martin Bucer über die in beiden Schriften enthaltene Abendmahlslehre. Um den Abendmahlsfrieden besorgt, entschuldigte dieser Calvins Lehre mit dem Hinweis, jener sei ein Ausländer, die Adressaten seien Franzosen, und sein Bestreben wäre, auf die Zwinglianer einzugehen und einzuwirken. Er konnte wahrheitsgemäß beteuern, daß Calvin die Wittenberger Konkordie voll anerkenne. Schließlich wies er noch daraufhin, daß Luther Calvins Eigenart gelten lasse, er habe ihn brieflich grüßen lassen. Es waren offensichtlich wieder die Nürnberger, die sich bei Luther über Calvin beklagten. Der Reformator las daraufhin Calvins Ausführungen über das Abendmahl durch und erklärte, in der Tat werde hier seine Lehre angegriffen. Er entschied aber: „Ich hoffe, Calvin wird einst besser von uns denken. Aber es ist nur billig, daß wir uns von einem tüchtigen Geist etwas gefallen lassen." Luthers gleichzeitiger Brief an Bucer läßt erkennen, was ihm an Calvin so sehr gefallen hat. Er hatte die Antwort an Sadolet gelesen und sich ihrem Eindruck nicht entziehen können. Durch Luthers Anerkennung Calvins und durch seine Friedensliebe wurde ein erneuter Abendmahlsstreit verhindert. In Hagenau konnte das Religionsgespräch noch nicht beginnen; die Diplomaten mußten sich dort über die Form des Gespräches einigen. Jede Seite erhielt elf Stimmen. Die Protestanten bestanden auf einer Diskussion über die Augsburger Konfession und deren Apologie. Zu diesem Zweck legte Melanchthon mit Einverständnis der Schmalkaldischen Bundesmitglieder eine überarbeitete Form des Bekenntnisses vor, die sogenannte Confessio Augustana Variata. Sie nähert sich den 4
Neuser, Calvin
50
Calvin in Straßburg
oberdeutschen Reformierten, besonders in der Abendmahlslehre, und hebt den Abstand zur römischen Lehre mehr hervor. Calvin besuchte Ende Juli 1540 für einige Tage den Konvent im benachbarten Hagenau. Einen Monat später befand er sich mit Bucer, Capito und Johannes Sturm, dem Leiter des Straßburger Gymnasiums, auf dem Weg nach Worms. Dort leiteten die Protestanten mit einem feierlichen Akt ihre Beratungen ein. Am 8. November 1540 versammelten sich die namhaftesten evangelischen Theologen Deutschlands - nur Luther fehlte in Melanchthons Herberge, wo sie der sächsische Vizekanzler im Namen der evangelischen Stände begrüßte. Drei Fragen legte er jedem Einzelnen vor. So wurde auch Calvin gefragt, ob er der „Lehrweise" des Augsburger Bekenntnisses zustimme und sie im bevorstehenden Gespräch mit allen Kräften festhalten werde, ob er sich dem Anspruch des päpstlichen Legaten, den Vorsitz zu führen, widersetzen werde, und ob er sich an den vorbereitenden Gesprächen der evangelischen Theologen eifrig beteiligen werde. Die Zusammenkünfte zur Vorbereitung des Hauptgespräches mit den katholischen Theologen fanden zwischen dem 9. und 18. September statt. Die behandelten Themen lassen erkennen, in welchen Lehrstücken man die entscheidenden Auseinandersetzungen erwartete. Rechtfertigung, Messe, Mönchsgelübde und Primat des Papstes werden erörtert. Calvin hat sich zu allen Punkten vor der Versammlung ausführlich geäußert. Ohne den Ruhm der übrigen, zum Teil berühmten Theologen herabsetzen zu wollen, muß festgestellt werden, daß er einige Male die überzeugendsten und durchschlagendsten Argumente gegen die römische Lehre vortrug. Er tat sich gleichermaßen als Exeget wie als Systematiker hervor. Melanchthon, der den Vorsitz führte, hat ihn in Worms mit dem Ehrentitel „der Theologe" ausgezeichnet. Ihn wird die Überlegenheit beeindruckt haben, mit der der erst 31jährige Franzose den theologischen Stoff beherrschte.
Calvin in Straßburg
51
Wie hoch Calvin geschätzt wurde, drückt sich auch darin aus, daß er zu den Theologen zählte, denen die elf Stimmen der evangelischen Partei anvertraut wurde. Die elf protestantischen Fürsten und Städte, denen eine offizielle Stimme zufiel, besetzten jede Stimme mit einem Politiker und zwei Theologen. Straßburg benannte Capito und Simon Grynäus, der als einziger Schweizer teilnahm. Die übrigen Straßburger Theologen mußten daher auf den Listen der übrigen Städte und Fürsten untergebracht werden. Bucer übernahm der Landgraf von Hessen, Calvin war anfänglich für Ulm vorgesehen. In der offiziellen Liste finden er und Johann Sturm sich als Vertreter des lutherischen Herzogs von Lüneburg. Dieser Entschluß hat in unserer Zeit immer wieder Aufsehen erregt. Es ist jedoch bereits ausführlich dargelegt worden, daß Calvin damals von den Lutheranern noch nicht als Sakramentsfeind angesehen wurde. Beachtenswerter ist, daß er in Worms den erstrangigen Theologen zugezählt wurde. Die Stimmenverteilung war auch der Grund, warum es im Jahr 1540 in Worms nicht mehr zum Gespräch kam. Die katholische Seite war drei ihrer elf Stimmen nicht mehr sicher. Jülich, Brandenburg und Pfalz neigten der evangelischen Lehre zu. Das Gespräch wurde darum unter offensichtlichen Vorwänden immer wieder hinausgeschoben. Als es im Januar 1541 endlich begann, vertagte es der Kaiser schon bald auf den April nach Regensburg. Beim Abschied der Straßburger erklärte Melanchthon, die übrigen lasse er ziehen, Calvin aber müsse mit nach Regensburg kommen. Er setzte sich auch bei den Straßburger Gesandten in diesem Sinne ein. Daraufhin ernannte der Rat Bucer und Calvin zu Vertretern der Stadt in Regensburg. Das Regensburger Religionsgespräch schien nun die langersehnte Einheit zu bringen. Am 27. April begann es, schon am 2. Mai hatten sich beide Seiten in der Rechtfertigungslehre geeinigt. Eine Sensation schien sich anzubahnen. Obgleich die erarbeitete Formel noch einiger Erklärungen bedurfte, hat 4»
52
Calvin in Straßburg
Calvin sie begrüßt. Er wunderte sich, daß die Gegner so sehr nachgegeben hätten. Erst als der sächsische Kurfürst und Luther auf ihre Zweideutigkeit hinwiesen, wurden auch andere evangelische Theologen in Regensburg bedenklich. Calvin hat seine Meinung aber nicht revidiert; er fand in ihr die Summe der evangelischen Lehre festgehalten. Immerhin hat auch Luther sie eine Zeit lang zulassen wollen, wenn Johann Eck, sein alter Gegner, eingestehe, nicht mehr im früheren Sinn zu lehren. Man wird die unterschiedliche Stellungnahme Luthers und Calvins zum Rechtfertigungsartikel des Regensburger Buches nicht überbetonen dürfen. Indessen trifft zu, daß Calvin eine doppelte Rechtfertigung lehrte, in der auch die "Werke - allerdings nur die des Glaubens - ihren Platz finden. Luther blieb allen Werken gegenüber mißtrauisch. In Regensburg konnte es zur Einigung kommen, weil sich auf beiden Seiten Humanisten befanden. Auf katholischer Seite lehrten Erasmus von Rotterdam und seine Schüler die doppelte Rechtfertigung. Die übrigen katholischen Theologen schwiegen, weil der päpstliche Legat Contarini zustimmte. Würde der humanistische Geist seine einigende Kraft auch in den übrigen Lehrstücken beweisen können? Schon drei Tage später kam die Ernüchterung, als man die Messe zu diskutieren begann. Es zeigte sich, daß die katholische Seite bei der Lehre von der Verwandlung des Brotes in den Leib Christi (Transsubstantiation) nicht nachgeben konnte. Dem aufmerksamen Beobachter mußte an dieser Stelle bereits deutlich werden, daß eine unüberbrückbare Kluft im Kirchenbegriff bestand. Während nämlich in der Rechtfertigungslehre kein direktes Dogma Roms vorlag, waren die katholischen Theologen in bezug auf das Messeverständnis an die Lehrentscheidung des 4. Laterankonzils (1215) über die Transsubstantiation gebunden. Am 8. Mai versammelten sich die evangelischen Theologen zur Beratung. Da auch die Fürsten und die Abgesandten der Städte anwesend waren, mußte Deutsch gesprochen werden, das Calvin nicht verstand. Einmütig wurde
Calvin in Straßburg
53
die vorgelegte Lehrformel abgelehnt, nur Bucer versuchte sie zu retten. Mit der Transsubstantiation waren nämlich die Aufbewahrung der Hostie im Sakramentshäuschen, ihr Herumtragen in der Prozession „und andere abergläubische Bräuche" verbunden, wie Calvin erklärte. Er hatte, ohne die Entscheidung der übrigen zu kennen, entschieden widersprochen. Damit war das Religionsgespräch gescheitert. Es wurde zwar noch weiterverhandelt, doch blieben Beichte, Satisfaktion und Kirchenautorität unverglichen. Calvin wartete das Ende nicht ab, er reiste nach Straßburg zurück. Die Hilfe für die französischen Glaubensbrüder hatte er in Regensburg nicht in dem erhofften Umfang zu erreichen vermocht. Im Dezember 1540 war Farel von Neuenburg nach Worms gereist - sicherlich nicht ohne Zutun Calvins - um über die jüngsten Verfolgungen in Frankreich zu berichten. Die evangelischen Stände fanden sich aber nur zu einem Protestschreiben an den französischen König bereit. Calvin verfolgte mit einigen anderen Männern hochfliegende politische Pläne: Die evangelischen Stände sollten das französische Angebot annehmen und mit Frankreich gegen den Kaiser paktieren. Den französischen Glaubensbrüdern hätte dieses Bündnis das Ende der blutigen Verfolgungen gebracht. Am 9. Mai lud der Landgraf Philipp von Hessen, nachdem am Vortag in der Zusammenkunft der Protestanten das bevorstehende Scheitern des Religionsgespräches sichtbar geworden war, Melanchthon, Bucer und Calvin, dessen Urteil ihm gefallen hatte, zum Mittagessen ein. Es deutet alles daraufhin, daß bei dieser Gelegenheit auch über die Anlehnung an Frankreich beraten worden ist. Die antihabsburgische Politik fand jedoch nicht die Zustimmung des Schmalkaldischen Bundes. Calvins Rolle in diesem politischen Spiel muß nicht unbedeutend gewesen sein, denn die Schwester Franz I., Margarete von Valois, sandte ihm am 25. Juli ein Dankesschreiben für die dem König geleisteten Dienste.
54
Calvin in Straßburg
Nach viermonatlicher Abwesenheit langte Calvin am 25. Juni 1541 wieder in Straßburg an. Am 2. September verließ er die Stadt, um nach Genf zurückzukehren. Wie kam es, daß die Genfer den Verjagten zurückriefen? Ursache dieses überraschenden Schrittes ist die Entschlossenheit und Unnachgiebigkeit der Guillermins, wie Farels und Calvins Anhänger in Genf genannt wurden; sie hatten ihren Namen von Farels Vornamen Guillaume abgeleitet. Es bezeichnet übrigens Calvins damalige Stellung, daß man noch nicht von Calvinisten sprach. Die Guillermins hatten Erfolg, weil ihnen die politische Lage zustatten kam. Sie besaßen ihre theologischen Führer in dem Leiter des Genfer Gymnasiums, Antoine Saunier, und in Cordier, Calvins altem Lehrer. Politisch zählten zu ihnen die bei den Wahlen des Jahres 1538 unterlegene Partei unter ihrem Führer Michel Sept. Es wurde bereits erwähnt, daß die neuberufenen Prediger von ihnen abgelehnt wurden. Farel und Calvin mußten ihren ganzen Einfluß aufbieten, damit es in Genf nicht zum Schisma kam. Sie argumentierten: Auch wenn in Genf die Kirche „verstümmelt und zerstreut" sei, hinge die Rechtmäßigkeit des Abendmahls nicht von der ordnungsgemäßen Berufung der austeilenden Pfarrer ab. Die Freunde in Genf sollten daher dem Abendmahl nicht fernbleiben. Im Blick auf die neuen Pfarrer genüge es, daß Saunier das ihm angetragene Pfarramt ausschlage. Trotzdem verschlossen sich die Angesprochenen zum Teil diesen Gründen. Saunier und andere Lehrer am Gymnasium weigerten sich, bei der Austeilung des Weihnachtsabendmahls zu helfen, und das um so mehr, als es vor dem Fest zu neuen Zusammenstößen zwischen beiden Parteien kam. Calvin hatte allerdings nicht vorausgesehen, daß jene zur Austeilung des Abendmahls herangezogen wurden. Saunier und der übrigen Opposition wiederum war nun der Unterschied zwischen ihrer Situation und Calvins und Farels Verweigerung des Osterabendmahls nicht mehr einsichtig. Der Genfer Rat schlug zurück und verbannte die beiden Ausländer Saunier und Cordier aus der Stadt. Die übrigen mußten ge-
Calvin in Straßburg
55
loben, sich künftig der Ordnung gemäß zu verhalten. Damit war die Partei der Guillermins zunächst zerschlagen. Die Aussicht auf erneute Unruhen bei der nächsten Abendmahlsfeier zu Ostern 1539 machte jedoch die Genfer Pfarrer nachgiebig. Am 12. März kam es zur Versöhnung zwischen Farel und den Genfer Pfarrern, die ihre Fehler eingestanden, vor ihrem Amtsantritt nicht mit den verbannten Pfarrern Kontakt aufgenommen zu haben. Jene wurden als „treue Pastoren" Genfs bezeichnet, was einer Rehabilitierung nahe kam. Die Genfer Pfarrer gelobten außerdem, dem Verfall der Zucht, der Schulen usw. entgegenzuwirken. Calvin trat der Abmachung bei. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, daß sich sein Verhältnis zu Genf nun wandelte. Er konnte sich als von seinen Pflichten der Genfer Kirche gegenüber entlastet fühlen. Im darauffolgenden Jahr trat nun in Genf ein grundlegender politischer Umschwung ein. Anlaß war, daß Genf im Waadtland einige Gebiete besaß, in denen auch Bern bestimmte Rechte ausübte. Ende März 1539 ließen sich nun drei Genfer Abgeordnete in Bern bereden, entgegen ihrer Instruktion einen Zusatzvertrag abzuschließen, der die Interessen ihrer Heimatstadt schwer verletzte. Erst nach einiger Zeit kam der Verrat ans Licht. Ein Sturm der Entrüstung erhob sich im Volk gegen die herrschende Partei, die man nun die „Artikulanten" nannte oder spottend die „Artischocken" (Artichauds). Beide Parteien besaßen nun ihren Namen. Angesichts des empfindlichen Nationalsgefühls der Genfer und Berns Pochen auf seine neuen Rechte standen für die regierende Partei schwere Kämpfe nach innen und außen bevor. Da reichte im Februar 1540 Michel Sept den Gegnern die Hand zur Versöhnung. Der drohende Krieg mit Bern veranlaßte ihn zum Einlenken. Eine große Freudenfeier wurde aus diesem Anlaß veranstaltet. Bei den anschließenden Wahlen gewannen die Guillermins einige Sitze dazu. Doch war der Verrat noch keineswegs bereinigt. Berns Unnachgiebigkeit ließ das Volk bald nach Bestrafung der Schuldigen schreien. Ihnen drohte die Todesstrafe. Als nun die
56
Calvin in Straßburg
drei Gesandten sich ihrer Verhaftung durch die Flucht entzogen, besetzten die Guillermins ihre Plätze im Rat. Die Artikulanten hatten nun ihre Mehrheit verloren. Ihr Untergang war besiegelt, als es Jean Philipp und seine Freunde am 5. Juni, einem Sonntag, zu einem Zusammenstoß mit ihren Gegner kommen ließen, bei dem es zwei Tote gab. Der Rat beschloß Jean Philipp den Prozeß zu machen. Er wurde überstürzt wegen Aufstandes zum Tode verurteilt und schon am 10. Juni hingerichtet. Die ungewöhnlich zahlreichen Volksversammlungen und die in ihr erhobenen radikalen Forderungen zeigen an, daß der Regierung die Macht entglitt. Es drohte eine Pöbelherrschaft. Erst als Bern einlenkte, beruhigten sich die Geister. Die neuen Prediger fühlten nun, daß ihre Stellung unhaltbar geworden war. Im Juli 1540 verließ Morand ohne Abschied die Stadt, im September folgte ihm Marcourt. Schon am 21. September beschloß der Rat, sich um die Rückkehr Calvins zu bemühen. Eine Gesandtschaft traf Calvin nicht mehr in Straßburg an, da er sich bereits zu den Verhandlungen nach Worms begeben hatte. Das bevorstehende Religionsgespräch gab ihm die Möglichkeit, die Entscheidung hinauszuschieben. Viele Monate lang bemühte sich nun der Rat von Genf in immer neuen Bittschreiben, Calvin zurückzugewinnen. „Von der Stunde an, als unsere Prediger vertrieben worden sind, haben wir nichts als Mühen, Feindschaften, Zank, Streitigkeiten, Zügellosigkeiten, Aufstände, Parteiungen und Totschlag gehabt." Mit diesem durchaus zutreffenden Eingeständnis suchte der Rat im Mai 1541 die Züricher zur Fürsprache in Straßburg zu bewegen. Fast mit den gleichen Worten („freventliche Lästerungen und Spottreden gegen Gott und sein Evangelium, sowie Unruhen, Parteiungen und Spaltungen") hatte Calvin an jenem denkwürdigen Ostertag der Gemeinde das Abendmahl verweigert. Zunächst wollte Calvin dem Ruf nicht folgen. Er glaubte nicht, daß die Sinnesänderung der Genfer von Dauer sei. Schon
Die Neuordnung der Genfer Kirche
57
als sich der Umschwung in Genf abzuzeichnen begann, beschwor er Farel, sich den Rückkehrplänen zu widersetzen. „Hundertmal lieber will ich andere Todesarten erleiden, als mich an dieses Kreuz schlagen zu lassen, an dem man täglich tausendmal verenden müßte." Den Genfern legt er den inneren Zwiespalt dar, in dem er steht. Er will Genf helfen, aber ihn halten auch seine Aufgaben in Straßburg. Zunächst will er nach Worms reisen. Man möge sich erst einmal um Viret bemühen. Hinzu kam, daß der Straßburger Rat ihn nicht ziehen lassen wollte. Calvin hatte inzwischen das Straßburger Bürgerrecht erworben und sich der Zunft der Schneider angeschlossen. Er war daher auf die Zustimmung des Rates angewiesen. Es bedurfte noch vieler Briefe aus der Schweiz, um alle Beteiligten umzustimmen. Noch am 1. März 1541 schrieb Calvin: „Es gibt keinen Ort unter dem Himmel, vor dem ich mehr zurückschrecke." Der Zwiespalt, in dem er steht, entspringt nicht der Wahl zwischen Genf und Straßburg, sondern der Scheu vor erneuten, zermürbenden Kämpfen und seinem Gehorsam gegenüber Gott. Es hat im Frühjahr 1541 wieder der „Blitze" Farels bedurft, um ihn willig zu machen. An seiner anfänglich Farel gegenüber geäußerten Meinung hat sich bis zuletzt nichts geändert. „Hätte ich die Wahl, ich täte lieber alles andere als dir hierin zu gehorchen. Aber da ich weiß, daß ich nicht mir selbst gehöre, so bringe ich mein Herz gleichsam geschlachtet dem Herrn zum Opfer dar." Am Regensburger Religionsgespräch nahm er noch teil. Am 13. September traf er wieder in Genf ein, von einem Herold geleitet, die allgemeine Hochstimmung gewiß nicht teilend.
7. Die Neuordnung der Genfer Kirche nach der Rückkehr Calvins (1541-1545) Als Calvin zum ersten Mal wieder die Kanzel betrat, horchten die Genfer erwartungsvoll auf. Würde er nun mit seinen Gegnern gründlich abrechnen? In Straßburg hatte er sich in
58
Die Neuordnung der Genfer Kirche
der T a t vorgenommen, Farels und sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen und die Feinde anzuprangern. Doch unterließ er es, weil der Volksbeschluß über seine Rückberufung und die Selbstanklagen der Volksvertreter eine Strafpredigt überflüssig machte. „Was wäre es anderes gewesen, als ein Herumtreten auf Feinden, die bereits am Boden lagen", schreibt er an Farel. Nur durch eine kleine Geste tut er kund, daß er durch die Vertreibung sein Amt nicht verloren habe, seine Amtsführung vielmehr nur unterbrochen worden sei. An eine fortlaufende Auslegung biblischer Bücher gewohnt, schlägt er die Bibel an der gleichen Stelle auf, an der er drei J a h r e zuvor stehen geblieben war. Ein Diener Gottes, der sein Amt treu versieht, sollte das heißen, kann nicht dieser T r e u e wegen entlassen werden. W e r eine Sensation erwartet hatte, wurde enttäuscht. In der gewohnten Weise legte er die Heilige Schrift aus. Ebenso entbehrte sein erstes Erscheinen vor dem R a t am 13. September jeder Dramatik. Das Ratsprotokoll besagt: J o h a n n Calvin „ist von Straßburg angekommen und hat Schreiben der Stadt und ihrer Prediger, auch von Basel, überreicht. Sie sind verlesen worden. Dann hat er eine ausführliche Entschuldigung wegen der Verzögerung (seines Eintreffens) vorgetragen. Danach hat er darum ersucht, der Kirche eine Ordnung zu geben, die schriftlich abgefaßt wird, und M ä n n e r aus dem R a t zu bestimmen, um mit ihnen (den Predigern) zu beraten und im R a t darüber zu berichten. W a s ihn betreffe, erbiete er sich, immer ein Diener (serviteur) Genfs zu sein." Auch vor dem R a t knüpft Calvin dort an, w o das Gespräch abgebrochen worden war. Er forderte als erstes eine wirksame Kirchenzucht. D e m Antrag wurde sofort entsprochen und eine Ratskommission eingesetzt. Und nun entsteht die Genfer Kirchenordnung (Ordonnances ecclesiastiques) von 1541. Sie ist kurz und knapp gehalten. Im ersten Teil wird ausgeführt, welche Aufgaben die Pfarrer, Doktoren, Ältesten und Diakone haben. Der zweite Teil befaßt sich mit den Gottesdiensten und übrigen kirchlichen Hand-
Die Neuordnung der Genfer Kirche
59
lungen. Die Vier-Ämter-Lehre hatte Calvin von Bucer in Straßburg übernommen, sie aber selbständig gestaltet. Die Doktoren werden auch Lehrer genannt. Da der damalige Unterricht auf religiöser Grundlage aufgebaut war, sind nicht nur die Religionslehrer gemeint. Das Gymnasium, dessen (Wieder-)Errichtung als dringende Aufgabe hingestellt wird, soll der Kirche Pfarrer und dem Staat Beamte ausbilden. Neuartig, ja revolutionär ist das Amt des Ältesten. Ihre ausschließliche Aufgabe ist die Kirchenzucht. Mittels dieses kirchlichen Amtes wollte Calvin nun endlich die Heiligung der christlichen Gemeinde und die strikte Beachtung der Ehre Gottes im öffentlichen Leben durchsetzen. Seit seiner ersten Wirksamkeit in Genf hatten Farel und er, wie berichtet, dieses Ziel verfolgt, darum gekämpft und dafür gelitten. Nun sollten ihre Wünsche erfüllt werden, denn die Einführung der Kirchenzucht war Bedingung für Calvins Rückkehr nach Genf gewesen. Indessen stieß er auch jetzt auf nicht geringen Widerstand. Mit zwei Einwänden mußte er sich auseinandersetzen: Einmal war noch der katholische Mißbrauch der Exkommunikation in der Erinnerung der Genfer lebendig. Hatte Calvin diesen Mißstand nicht selbst bei seinem Vater erleben müssen? Doch ,Der Mißbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf', sagt ein Sprichwort. Calvin drang selbst auf scharfe Unterscheidung der weltlichen Gewalt des Staates von der geistlichen Gewalt der Kirche. Von Seiten des Rates wurde am Entwurf der Kirchenordnung kritisiert, daß die Pfarrer einer besonderen Zensur unterworfen würden. Der Verdacht regte sich, die Pfarrer sollten entsprechend den päpstlichen Gesetzen den weltlichen Gerichten entzogen werden. Calvin hatte jedoch nur einen strengeren Maßstab an ihre Lehre und ihren Lebenswandel legen wollen als an den der übrigen Gemeindeglieder. Aus dem gleichen Grund erfolgte Einspruch gegen die Auffassung, das Eherecht gehöre sowohl in den staatlichen wie in den kirchlichen Bereich. Die Ordonnance ecclesiastique erhält den Schlußsatz: „Und all dies soll in der Art geschehen, daß
60
Die Neuordnung der Genfer Kirche
die Pfarrer keine bürgerliche Jurisdiktion besitzen und nur das geistliche Schwert des "Wortes Gottes handhaben, wie St. Paul ihnen befiehlt, . . . daß vielmehr die Zivilgewalt in vollem Umfang bestehen bleibe." Noch schwerwiegender war der Einwand gegen die Übernahme des Ältestenamtes durch gewöhnliche Gemeindeglieder, das heißt, durch Privatpersonen. In der vorreformatorischen Zeit gab es nur ein Kirchenregiment durch den Bischof und sogenannte ,Geistliche', also geweihte Personen. Die Obrigkeit hatte das Recht und die Pflicht (ius advocatiae), der Kirche zur Durchführung ihrer Belange beizustehen. Wie sollte nun in den Reformationskirchen verfahren werden? Es gab weiterhin ,Geistliche', das heißt, ordinierte Pfarrer. Aber die Kirche stellte sich nicht mehr in dem Bischof oder im Klerus dar. Kirche ist nun die Gemeinde der Glaubenden. Die Ältesten, die mit den Pfarrern die Kirchenzucht durchführen sollten, hätten dementsprechend in ihrer Eigenschaft als Christen und Gemeindeglieder für ihr Amt ausgesucht oder durch die Gemeinde gewählt werden müssen. Dann aber wären Funktionen des Kirchenregiments Privatpersonen übertragen worden. Das war dem 16. Jahrhundert unvorstellbar und unterblieb daher. Es war aber keineswegs nur vorreformatorisches Denken, das sich hier behauptete. Die Praxis widersprach gleichfalls einer Berufung von Privatpersonen zum Kirchenregiment. Die Kirche war bisher Staats- und Volkskirche gewesen. Als Gemeinde der Glaubenden konnte sie aber nicht mehr als Institution verstanden werden, die wie selbstverständlich das ganze Volk umfaßte. Vor allem aber verbot sich eine gewaltsame Durchführung der Reformation, weil Zwang sich mit Glauben nicht vereinbaren läßt. Wenn eine Reformationskirche sich daher durchsetzen und Volkskirche bleiben wollte, so mußte die Obrigkeit die Neuordnung der Kirche durchführen, denn sie besaß allein die Zwangsmittel, ein Territorium zu reformieren. Ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen lag nahe, denn sie war im 16. Jahrhundert selbstverständlich christliche Obrigkeit,
Die Neuordnung der Genfer Kirche
61
wie auch alle Staatsbürger Christen waren, sieht man von den Juden ab. Daher hatten die evangelischen Obrigkeiten die Reformation in ihren Gebieten durchgeführt und die kirchliche Oberaufsicht behalten, sei es als landesherrliches Kirchenregiment in Sachsen oder als Staatskirche in Zürich. Luther und Zwingli hatten dem zugestimmt, wenngleich ersterer nur widerwillig, wie seine Bezeichnung des Kurfürsten als „Notbischof" erkennen läßt. Da die Kirche auf staatliche Gewaltmittel angewiesen war, verbot sich die Heranziehung von Gemeindegliedern zum Kirchenregiment von selbst. Die Obrigkeit war nicht gewillt, ihre Schwertgewalt an Gemeindeglieder abzutreten. Durch Oekolampads kirchengeschichtlich bedeutsame Rede vor dem Basler Rat im Jahre 1530 über die Wiedereinführung des Kirchenbanns (De reducenda excommunicatione apostolica) war dargelegt worden, daß eine Kirchenzucht durch die Gemeinde selbst ausgeübt werden sollte. Christi Anordnung einer Gemeindezucht Matthäus 18, 15 ff. laute: „Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, auf daß alle Sachen bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so halte ihn als einen Heiden und Zöllner." Die „ein oder zwei" Männer waren offensichtlich nicht Pfarrer oder staatliche Beamte, sondern Gemeindeglieder. Dann aber mußte ein kirchliches Amt auch durch Gemeindeglieder übernommen werden können, die nach bisheriger Anschauung lediglich Privatpersonen waren, also kein Amt der Obrigkeit oder eines Pfarrers oder Lehrers bekleideten. Die Versuche in Basel und anderwärts scheiterten jedoch. Erst Calvins Genfer Kirchenordnung von 1541 brachte eine kirchliche, obrigkeitsfreie Kirchenzucht, die er allerdings erst Jahre später und nach heftigen Kämpfen durchzusetzen vermochte. Es entstand das imponierende Bild einer christlichen Gemeinde, die ernsthaft
62
Die Neuordnung der Genfer Kirche
um Heiligung ringt - die Gegner sprachen von Theokratie und Tyrannei. Doch davon später! Die gegensätzlichen Ansichten finden sich auch in der Genfer Kirchenordnung. Der Rat hatte nämlich stets das Wort „Ältester" mit dem Zusatz „als Ratsabgeordneter" versehen. Er hatte die Herausforderung genau verstanden, die darin lag, daß Calvin die mit der Kirchenzucht Beauftragten mit dem biblischen Titel „Älteste" versah. Seine und Farels früheren Vorstöße in dieser Richtung kannten diese Benennung noch nicht. Durch sie verpflichtete Calvin die Kirchenzuchtspfleger allein für die Kirche. Wie hat sich Calvin zu dieser wohl bedeutsamsten Korrektur des Rates an der Kirchenordnung gestellt? Er hat sie hingenommen. Der Grund lag weniger in der Haltung seiner drei Mitpfarrer, die sich hinter seinem Rücken gegen eine unabhängige Zucht der Gemeinde aussprachen. Vielmehr war er Realist genug, einzusehen, daß die Gemeinde in einer Staatskirche immer der Mithilfe der Obrigkeit bedarf. Er ließ es daher auf eine Kraftprobe ankommen. Es mußte sich nun erweisen, ob jene Ratsherren, die in die Kirchenzuchtsbehörde gewählt wurden, sich als ,Älteste' und Repräsentanten der Gemeinde oder als Ratsherren verstanden. Kaum in Genf angekommen, trat Calvin damit schon wieder in die Kämpfe ein, die ihm doch in innerster Seele zuwider waren. Auf welche Weise wurde die Kirchenzucht in Genf durchgeführt, nachdem sie im November 1541 vom Großen und Kleinen Rat und von der Volksversammlung gebilligt worden war? Ihre Seele war das Konsistorium (consistoire), in dem zwölf Älteste und die Pfarrer Sitz hatten. Die Ältesten wurden vom Rat nach Beratung mit den Pfarrern gewählt, und zwar zwei aus dem Kleinen, vier aus dem Mittleren und sechs aus dem Großen Rat. Einer der vier Bürgermeister (syndicts) führte den Vorsitz. Jährlich wurde nach den Ratswahlen geprüft, ob die Ältesten im Amt bleiben sollten. Wechsel sollten möglichst selten vorgenommen werden. Calvin wollte, daß das Konsistorium die ganze Gemeinde repräsentiere. Darum drang er dar-
Die Neuordnung der Genfer Kirche
63
auf, daß nicht nur Altbürger (citoyens), denen allein alle Regierungsämter offenstanden, wählbar seien, sondern auch Neubürger (bourgeois). Es wurde ihm zugestanden. Seine Forderung, die Geeignetsten für das Ältestenamt aus dem ganzen Volk wählen zu können, blieb unerfüllt. Sie entsprach seinem Kirchenbegriff, hätte aber die Bestimmung gesprengt, die Ältesten aus der Reihe der Ratsherren zu nehmen. Das Konsistorium versammelte sich an jedem Donnerstag. Gemäß der Trennung von weltlicher und geistlicher Gewalt wurde ihm zwar ein Ratsbeamter für die Vorladungen zur Verfügung gestellt, doch blieben die Verhandlungen auf Verhör und Ermahnung beschränkt. Strafen verhängen konnte nur der Rat. Der Ausschluß vom Abendmahl galt nicht als Strafe, sondern als Heilmittel. Wer Reue zeigte, wurde wieder zugelassen. Mußten aber nicht doch in einer Staatskirche, aus der damals kein Bürger austreten konnte, die Ermahnungen, der Ausschluß vom Abendmahl und die Meldung der Verfehlungen an den Rat wie Strafen wirken? Gewiß, die Befugnisse des Konsistoriums waren, an weltlichem Gerichtswesen gemessen, klein und das Privatleben der Genfer sollte ausdrücklich nicht an die Öffentlichkeit gezerrt werden. In Befolgung des Herrenwortes Matthäus 18, 15 ff. hieß es in der Kirchenordnung: „Die verborgenen Vergehen soll man insgeheim tadeln und ein Gemeindeglied darf seinen Nächsten erst dann vor die Gemeinde bringen, . . . wenn sich dieser gegen seine Ermahnungen aufgelehnt hat" (usw.). Aber wurde das Konsistorium nicht zu einer Vorinstanz des Rates und also doch zu einem verkappten weltlichen Gericht? Als Vorstufe zur Ratsverhandlung und auf Grund der Identität von Bürger- und Christengemeinde in Genf konnte das Konsistorium nicht als eine rein kirchliche Instanz und rein seelsorgerliche Institution angesehen werden. Trotz aller Bemühungen des Rats und Calvins behielt es eine Zwittergestalt. Die Ordonnances ecclesiastiques schufen noch eine zweite Institution, die geschichtliche Bedeutung erlangen sollte, die Bibel-
64
Die Neuordnung der Genfer Kirche
Besprechung der Genfer Pfarrer und der Lehrer am Gymnasium (conferance des Ecritures). Sie fand am Freitag jeder Woche statt und sollte die Reinheit der Lehre und die einheitliche Verkündigung in Genf bewahren. Calvin schuf mit dieser Konferenz ein Instrument, durch das alle Lehrstreitigkeiten sofort ausgeräumt wurden. Die Einrichtung war einzigartig im damaligen Protestantismus. Ob Calvin die früheren Meinungsverschiedenheiten der Genfer Pfarrer dazu veranlaßt hatten? Auch seine Erfahrungen im Carolistreit und die innerprotestantischen Lehrgespräche in Worms und Regensburg können ihn inspiriert haben. Durch die gemeinsame wöchentliche Bibelbesprechung war nicht nur die Lehreinheit und Lehrreinheit der Genfer Kirche gesichert, Calvin schuf auch eine in sich geschlossene Pfarrerschaft, die dem Rat energisch entgegenzutreten vermochte. Später wurde die Bibelbesprechung zum öffentlichen Gottesdienst. Im Anschluß an ihn versammelte sich die Pfarrerschaft, die Venerable Compagnie des Pasteurs. Unter dem Vorsitz Calvins wurde die Predigt besprochen, die von den Mitgliedern abwechselnd gehalten wurde. Bei dieser Gelegenheit fand vierteljährlich auch die schon in der Kirchenordnung von 1541 vorgesehene brüderliche Ermahnung (censura fratrum) statt, der sich jeder einzeln stellen mußte. Sebastian Castellio, der Rektor des Genfer Gymnasiums, scheiterte an den strengen Maßstäben der Venerable Compagnie des Pasteurs. Im Jahre 1543 wollte der befähigte Humanist, den Calvin von Straßburg mitgebracht hatte, ein Pfarramt übernehmen. Bei der Prüfung seiner Lehre ergab sich, daß er das Hohelied Salomos für ein erotisches Liebeslied hielt, das nicht in den Kanon der Heiligen Schriften gehöre, und daß er die Auslegung des Satzes „niedergefahren zur Hölle" im Genfer Katechismus mißbilligte. Calvin hatte diese schwierige Stelle des Apostolischen Glaubensbekenntnisses dort als die höchste Gewissensnot Christi am Kreuz interpretiert, das heißt, er hatte die Höllenfahrt nicht als Christi Predigt in der Totenwelt ( l . P e t r . 3,19) ausgelegt, sondern mit dem Kreuzeswort „Mein
Die Neuordnung der Genfer Kirche
65
Gott, mein Gott, w a r u m hast du mich verlassen" (Matthäus 27,46) erklärt. Natürlich konnte Castellio als Humanist gute Gründe für seine Ansichten anführen. Den Schriftkanon wollten die Genfer Pfarrer aber nicht angetastet haben; das Hohelied sei ein Hochzeitslied wie Psalm 45. Sie wollten auch jene Kirchen nicht tadeln, die die Höllenfahrt Christi anders als sie verstünden. Das Glaubensbekenntnis müsse aber ihrer Meinung nach so erklärt werden, d a ß es das Volk über die notwendigsten Dinge zur Seligkeit unterrichte. In Genf könnten sie nicht verschiedene Auslegungen zulassen, weil daraus Unheil entstünde. Der letzte Satz zeigt, wie streng in Genf auf Lehreinheit geachtet wurde. Castellio verließ unter Beschimpfung der Genfer Pfarrer und mit Klagen über ihre Intoleranz die Stadt und begab sich nach Basel. Calvin sollte seine Gegnerschaft nach dem Servetprozeß noch schmerzlich erfahren. Die Lehreinheit in Genf war gesichert. Konnte sie aber auf die Dauer bestehen, wenn die Genfer Kirche in der Lehre nicht auch mit den Nachbarkirchen und dem deutschen Protestantismus übereinstimmte? Wenn hier Differenzen auftraten, konnte es gar zu leicht in der Stadt immer wieder zu Auseinandersetzungen kommen. Auch der Kampf gegen die Papstkirche konnte nur erfolgreich geführt werden, wenn die römischen Theologen nicht auf die Zwietracht im protestantischen Lager hinweisen und die unterschiedlichen evangelischen Lehren gegeneinander ausspielen konnten. Calvin war hiervon besonders betroffen. Gemeint ist weniger der Streit um das Abendmahl und die Kirchenzucht. Vielmehr m u ß t e Calvins Prädestinationslehre als eine Sonderlehre erscheinen, die die Lehrgegensätze im Protestantismus aufdeckte, und das um so mehr, als Calvin sie unerbittlich vertrat. Zwingiis Nachfolger äußerten sich, wie sich im Bolsecstreit zeigen wird, zurückhaltender als ihr großer Lehrer, und Luther hatte die Lehre in der Schrift „Über den unfreien Willen" (De servo arbitrio, 1525) vertreten, sie aber seitdem ruhen lassen. Das Feld beherrschte damals mehr und mehr Melanchthon, der in den Loci commu5
Neuser, Calvin
66
Die Neuordnung der Genfer Kirche
nes 1535 ausdrücklich vor „dem albernen Geschwätz von einem stoischen Fatum" warnte. Als Calvin im Jahre 1542 eine „Defensio" gegen die zehn Bücher „De libero arbitrio et gratia divina" des katholischen Theologen Albert Pighius ausgehen ließ, widmete er die Schrift Melanchthon, dessen Lehrweise allgemein bekannt war. So sollte die Widmung offensichtlich die protestantische Einheit hervorheben. Die gleiche Absicht verfolgt Calvin mit dem Druck der Loci communes Melanchthons in Genf in französischer Sprache im Jahre 1546. Man wird fragen: Verschaffte er auf diese Weise nicht gerade einer Lehrweise, die von der seinen abwich, Eingang ins französische Sprachgebiet? Nun waren die lateinischen Loci den Gebildeten in Europa längst allenthalben bekannt. Erasmus von Rotterdam hatte sie bereits nach ihrem ersten Erscheinen studiert, Heinrich Bullinger und andere erhielten durch sie entscheidende Anstöße zum Übertritt zur Reformation. Zur Verbreitung des Buches konnte Calvin daher nicht beitragen, es sei denn bei dem des Lateinischen unkundigen Volk. Ist dies seine Absicht? In der Calvinforschung ist immer wieder die Toleranz und Größe des Genfer Reformators gepriesen worden. „Es ist dies unseres Wissens das einzige Beispiel, daß einer der Reformatoren in solcher Weise das Werk eines anderen vertrat und es in dem Kreis seiner Anhänger hinüber pflanzte, zumal ein Werk, das in einigen der wichtigsten Punkte ziemlich deutlich von seinem eigenen Lehrbegriff abwich" (E. Stähelin). Aber empfiehlt er es wirklich seinen Anhängern? In der Vorrede ist die Kritik an dem Buch, von wieviel Lobsprüchen auch immer begleitet, nicht zu übersehen. Er kleidet sie in eine einführende Inhaltsangabe „für die Ungelehrten in unserer Nation". Als er zur Lehre vom freien Willen kommt, notiert Calvin, daß Melanchthon dem Menschen eine eigene Freiheit in äußeren Handlungen, ja, im bürgerlichen Verhalten, einräume. Er meint, diese Ausführungen könnten vielleicht nicht jeden Leser befriedigen. In der Prädestinationslehre lasse Melanchthon vieles im Dun-
Die Neuordnung der Genfer Kirche
67
kein, obgleich wir doch keinen Buchstaben unterdrücken dürften von dem, was Gott uns über diese Lehre offenbart habe. Endlich nenne Melanchthon als drittes Sakrament die Absolution, die doch kein Sakrament sei. Auf die Kritik folgt sogleich die Entschuldigung: Melanchthon habe Gott nichts nehmen wollen, wenn er dem Menschen in einigen Dingen einen freien Willen zuspreche. In der Prädestinationslehre trachte er aller unnützen Neugierde zu wehren. Und die Absolution bezeichne er nur als Sakrament, weil er sie für eine nützliche Einrichtung halte; er wünsche nicht dem allgemeinen Brauch in Wittenberg entgegenzutreten und Streit hervorzurufen - eine unzutreffende Darstellung! Die Lehrunterschiede, meint Calvin, seien aus Melanchthons Bestreben zu erklären, nur das Hauptsächliche zu lehren und unnütze Disputationen zu vermeiden. Es zeigt sich, daß stets neben der Kritik die Entschuldigung steht, neben der Betonung der Lehrreinheit die der Lehreinheit. Die Differenzen werden nicht verschwiegen, verlieren aber angesichts der grundsätzlichen Einheit beider Theologen sogleich ihre Bedeutung. Calvin versucht sich auf diese Weise gegen künftige Auseinandersetzungen zu wappnen. Als sich im Jahre 1552 in Genf Trolliet, ein ehemaliger Eremit, zur Verteidigung des freien Willens auf Melanchthons Loci communes berief, wiederholte Calvin ebendiese Gedanken. Ein wesentlicher Teil der kirchlichen Neuordnung ist endlich der Genfer Katechismus aus dem Jahre 1542. Calvin hatte ihn schon bald nach seiner Rückkehr in französischer Sprache abgefaßt und drucken lassen. Im Unterschied zum Katechismus von 1537 ist er in Frage und Antwort gefaßt. Nicht weniger als 373 Fragen werden in ihm gestellt. Er ist in 55 Abschnitte eingeteilt, die in der Katechismusunterweisung sonntags um 12 Uhr fortlaufend behandelt wurden. Die Genfer waren durch die Kirchenordnung gehalten, ihre Kinder zu diesem Unterricht zu schicken. Der Ausgabe der Institutio von 1539 folgend hat Calvin die lutherische Reihenfolge Gesetz - Evangelium nun 5»
Die Neuordnung der Genfer Kirche
68
aufgegeben. Der Katechismus beginnt mit der Frage nach der Erkenntnis Gottes, der sogleich die Auslegung des Glaubens an Hand
des
Apostolischen
Glaubensbekenntnisses
folgt.
Das
Gesetz (Dekalog) wird unter dem Gesichtspunkt der Heiligung ausgelegt. Auf Sonderlehren hat Calvin verzichtet; die Prädestinationslehre etwa fehlt. Für ihn zählt sie offensichtlich nicht zu den unbedingt notwendigen Lehren. Im Laufe der J a h r e hat der Genfer Katechismus über den Unterricht hinaus Bedeutung erlangt. In der Kirchenordnung von 1561 wird er als Lehrnorm für die Pfarrer aufgeführt. Er gilt also als öffentliches Bekenntnis. Diese Eigenart teilt er mit Luthers Katechismen (1529) und dem Heidelberger Katechismus (1563). Calvin hat ihn im J a h r e 1545 ins Lateinische übertragen. Er hat noch erlebt, daß der Katechismus in italienischer, spanischer, englischer, deutscher und griechischer Sprache (für den Schulunterricht)
übersetzt
worden ist. Seine Hoffnung war, er werde in der Pfalz eingeführt werden. Heidelberger
Doch
arbeiteten
Katechismus
aus,
die Pfälzer dessen
Theologen
den
Geschlossenheit
und
Ausdruckskraft der Genfer Katechismus nicht erreicht. D e r Aufbau der Genfer Kirche kam zum Abschluß mit der Sichtung und Erneuerung der Pfarrerschaft. Calvin hatte, wie erwähnt, seine beiden Kollegen nach seiner Rückkehr
trotz
ihrer Unzuverlässigkeit ertragen. In den nächsten Jahren versuchte er, Farel und Viret für Genf zu gewinnen, doch vergeblich. Die ihm mißliebigen Pfarrer schob er auf die Landpfarrstellen ab. Sie gingen zumeist ohne Widerrede, offensichtlich froh, dem Reformator und seinen hohen Anforderungen entronnen zu sein. Viele Pfarrernamen tauchten in diesen Jahren auf und verschwanden wieder. Selbst ein Kritiker Calvins wie C. A. Cornelius
gibt zu, daß viele der Prediger
untauglich
waren. Im J a h r e 1545 waren die Genfer Pfarrstellen mit Abel Poupin, Nicolas des Gallars und anderen nach Calvins Wunsch besetzt. Die Geistlichkeit bildete nun eine Einheit, eine schlagkräftige Waffe Calvins gegen Übergriffe des Rates. Es wurde
Die Neuordnung der Genfer Kirche
allerdings mit Mißtrauen Franzosen waren.
vermerkt,
daß viele der
69 Pfarrer
Auf den Predigtbesuch der Genfer wurde streng geachtet. In den Landgemeinden überwachten ihn besondere Wächter. Der Rat, die vier Bürgermeister, der Justizleutnant usw. nahmen laut Verordnung vom 23. März besondere Plätze im Gottesdienst ein. Dem Volk sollte ein Vorbild gegeben und die Christlichkeit Genfs öffentlich dokumentiert werden. Die Kirche Genfs war neu geordnet; am 20. November 1541 hatte die Volksversammlung die Kirchenordnung gebilligt. Es war kein Zufall, daß der Rat am nächsten Tag Calvin beauftragte, auch an der Neufassung der Staatsverfassung (ordonnances sus le régime du peuple) mitzuarbeiten. Denn die Reformation in Genf war nur gesichert, wenn die gewählte Regierung dem wiederentdeckten Evangelium treu ergeben war und sie genügend Macht besaß, ihren Willen durchzusetzen. Die evangelische Gesinnung lebendig zu erhalten, war die ständige Aufgabe vor allem der Prediger; die Machtbefugnisse des Rates mußten gesetzlich festgelegt werden. Wie leicht die Bürgerversammlung (conseil général) zum Sprachrohr ungezügelter Volksleidenschaft werden konnte, hatte sich nach Calvins und Farels Vertreibung erwiesen. Dem wurde in der neuen Ordnung gewehrt. In der Bürgerversammlung durfte nun kein Antrag mehr gestellt werden, der nicht vorher im Kleinen und Großen Rat zur Sprache gebracht worden war. Um plötzliche unbesonnene Beschlüsse zu verhindern, hatte man dieses Gesetz bereits früher, wenn auch vergeblich, gefordert. Es sind daher böswillige Verdächtigungen, wenn man Calvin unterstellt, er habe als weltlicher Gesetzgeber fungieren und antidemokratische Pläne durchsetzen wollen. Insbesondere die überarbeitete Zivilprozeßordnung zeigt, daß der Rat die Dienste Calvins in Anspruch nahm, weil er ausgebildeter Jurist war. In meisterhafter Kleinarbeit waren Gesetze neugefaßt worden, die zumeist keinen Bezug zur Reformation hatten. In ihnen wird das
70
Die Neuordnung der Genfer Kirche
Bestreben sichtbar, den Prozeßablauf zu verkürzen; das Kanonische Recht wird abgebaut. Der Bürgerversammlung blieb die Aufgabe, im Frühjahr von den vier Bürgermeistern zwei neu zu wählen und im Herbst den Justizleutnant zu benennen. Dem Kleinen Rat, an dessen Spitze die Bürgermeister standen, fiel die Regierung, Verwaltung und das Strafrecht zu, dem Großen Rat die Gesetzgebung. Der Justizleutnant leitete den Gerichtshof für die Zivilprozesse; ihm war auch die Polizeigewalt übertragen und die Untersuchung in Strafsachen. Nach wie vor beschloß die allgemeine Bürgerversammlung die Gesetze. Am 28. Januar 1543 genehmigte sie auch die neue Staatsverfassung. Calvin war für die Zeit seiner Mitarbeit von den Wochenpredigten befreit. Ihm wurde vom Rat für seine große Mühe gedankt und ein Faß Wein verehrt. Die Vielseitigkeit Calvins bei der Wahrnehmung öffentlicher Belange ist erstaunlich. In den Jahren nach seiner Rückkehr setzte er sich für die Häuser- und Straßenreinigung ein. Besonders in Pestzeiten mußte aller Unrat unbedingt entfernt werden. Er bewog den Rat, den Verkauf der Lebensmittel zu überwachen und alle verderbliche Ware in die Rhone werfen zu lassen. Weil wiederholt kleine Kinder aus den Fenstern stürzten, regte er an, die Fenster mit Geländern zu versehen; der Rat erließ eine entsprechende Verordnung. Am 29. Dezember 1544 erschien er vor dem Rat und legte die Notwendigkeit dar, Arbeitsplätze zu beschaffen. Mit staatlicher Unterstützung wurde daraufhin in Genf eine Tuch- und Sammtweberei eingerichtet. Die Konkurrenz Lyons hat später diese Industrie wieder zum Erliegen gebracht. Selbstverständlich kümmerte sich Calvin auch um den Bettel, die Versorgung der Armen und um das Spital. Wiederholt wird er zu den Ratsitzungen herangezogen, in denen über die Beilegung des Streites mit Bern beraten wurde. Die Auseinandersetzung um die Genfer Rechte im Waadtland wurden oben erwähnt. Calvins politischer Weitsicht war es mit zu verdanken, daß im Jahre 1544 in einem Vertrag die Differenzen beigelegt wurden.
Auflehnung gegen das Joch Christi'
71
8. Auflehnung gegen das Joch Christi' die Prozesse Ameaux, Perrin, Gruet, Bolsec, Servet (1546-1555) Damals mehrten sich die Stimmen im Rat, die tadelten, daß Calvin zu den politischen Verhandlungen hinzugezogen wurde. Der Unmut wuchs, als im Laufe des Jahres 1545 beschlossen wurde, die Unzuchtsfälle hart zu bestrafen und die Bußgelder wesentlich zu erhöhen. Betroffen waren besonders die oberen Schichten der Bürgerschaft, in denen Fehltritte dieser Art nicht ernstgenommen wurden. Der Widerstand verstärkte sich, als Calvins Antrag durchdrang, die Sünder nach vollzogener Strafe einer Zurechtweisung im Konsistorium zu unterziehen. Der erste größere Zusammenstoß erfolgte im Januar 1546. Pierre Ameaux, der einigen Anhang in der Stadt besaß, war im Vorjahr in den Kleinen Rat gewählt worden. Er hatte ein Geschäft mit Spielkarten betrieben, bis es ihm 1543 aus ethischen Gründen untersagt wurde. Bei einer Gasterei in seinem Hause machte er seinem Unmut Luft; seine Ausfälle richteten sich gegen die Ratsmehrheit, einzelne Ratsherren, die Prädikanten und namentlich gegen Calvin. Calvin sei ein böser Mensch, nichts als ein Pikarde, und predige falsche Lehre. Drei seiner Gäste zeigten ihn an; er wurde verhaftet. Da Calvin nicht als rachsüchtig erscheinen wollte, setzte er sich als der Beleidigte beim Rat für ihn ein. Doch dem Ersuchen, ihn freizubitten, widersetzte sich Calvin, denn er wollte nicht den Vorwurf der falschen Lehre auf sich sitzen lassen. Nach langem Hin und Her im Rat wurde Ameaux verurteilt, barhäuptig, im Büßerhemd, mit einer brennenden Fackel in der Hand durch die Stadt zu gehen, Gott und das Gericht um Gnade anzurufen und die Erde zu küssen. Es war dies die strengere Form der Abbitte, die in Genf üblich war. Calvin hatte sich geweigert, vor dem Rat eine Abbitte Ameaux's entgegenzunehmen.
72
Auflehnung gegen das Joch Christi'
Lag es nun an der Verschärfung der Gesetze oder an der Zurechtweisung der Sünder nach der Bestrafung durch das Konsistorium, das auf diese Weise als die oberste Instanz erschien, es bildete sich jedenfalls eine Opposition gegen die Kirchenzuchtsbehörde. Fälle von Widerspruch und Widerstand gegen das Konsistorium ereigneten sich. Am kühnsten gebärdete sich die Familie Favre. Francois Favre, ein angesehener Mann und bekannter Patriot, führte ein lockeres Leben, das öffentliches Ärgernis erregte. Bei der Vernehmung schmähte er das Konsistorium. Als man ihn daraufhin ins Gefängnis führte, rief er: „Freiheit, Freiheit! Calvin plagt uns mehr als vier Bischöfe." Seine Tochter, die wegen ihrer Teilnahme an einer verbotenen Tanzgesellschaft vorgeladen wurde, beklagte sich heftig über die offensichtliche Feindseligkeit gegen ihre Familie. Calvin entgegnete: „Ihr müßt euch eine neue Stadt gründen, in der ihr für euch leben könnt, wenn ihr euch nicht hier mit uns unter Christi Joch beugen wollt. . . . Wären so viele Kronen in der Familie Favre wie unruhige Köpfe, so hindert das doch nicht, daß der Herr noch höher steht." Ihr Bruder Gaspar Favre wurde angeklagt, am Ostertag, während die Gemeinde in der nahegelegenen Kirche das Abendmahl feierte, in einem Garten mit seinen Gesellen Kegel gespielt zu haben. Bei der Vernehmung machte er die zahlreichen fremden Pfarrer Genfs für alles verantwortlich. Ein anderer äußerte, man sollte die französischen Prediger in ein Boot setzen und die Rhone hinab in ihr Vaterland zurückschicken. Wie er dachten viele Unzufriedene in Genf. Favres Tochter war die Gattin des Befehlshabers der Genfer Truppen, Ami Perrin. Bisher ein Anhänger Calvins, schloß dieser sich im Jahre 1546 der Gegenpartei an. Die zahlreichen Aussöhnungsversuche fruchteten nicht. Der ehrgeizige Perrin - Calvin nannte ihn den „kleinen Cäsar" - trat an die Spitze der Opposition. Er setzte durch, daß es dem Rat überlassen blieb, zu entscheiden, wer halsstarrig sei und daher nach der
73
Auflehnung gegen das Joch Christi* Bestrafung
nochmals
dem
Konsistorium
vorgeführt
werden
müsse. Der Wortlaut der Kirchenordnung sprach für ihn. Allem Anschein nach hat Perrin im J a h r e 1 5 4 6 anläßlich des Schützenfestes versucht, einen Umsturz herbeizuführen.
Sein
Aufruf, beim Fest gegen das Luxusverbot zu verstoßen und aufgeschlitzte, in den Falten mit Seide gefütterte Hosen
zu
tragen, gab Calvin Anlaß, vor dem R a t auf die Einhaltung der Gesetze zu drängen. Das Fest wurde abgesagt. Dann aber entstanden
Gerüchte, Perrin
habe bei einer
Gesandschaft
am
französischen H o f Verhandlungen gepflogen, die dem Nachbarland Rechte in Genf eingeräumt hätten. Nun stand Perrins Kopf auf dem Spiel. Während des Prozesses k a m es zu wilden Auseinandersetzungen im R a t . Die Zeiten des Aufruhrs und der Parteikämpfe vor Calvins Rückkehr schienen
wiederzu-
kehren. Auch die Berner mischten sich wieder ein. W ä r e nicht offenkundig geworden, daß der Zeuge der Anklage, Laurent Maigret, selbst verbotene Beziehungen nach Frankreich unterhielt, wären Todesstrafe und Umsturz wohl unvermeidbar gewesen. So wurden beide Prozesse niedergeschlagen. Die Fronten aber hatten sich verhärtet. Z u m Freundeskreis der Favre gehörte auch Jacques Gruet. Am 2 7 . Juni 1 5 4 7 heftete er unbemerkt an die Kanzel von St. Peter einen Zettel, der schwere Drohungen gegen die Prediger enthielt. Sofort schwirrten Gerüchte durch die Stadt, eine Verschwörung bestehe und Aufstand drohe. D e r Verdacht fiel auf Gruet, der auf der Folter gestand.
Eine
Haussuchung
brachte Papiere zum Vorschein, die von Gruets H a ß gegen Calvin und die Kirchenzucht Zeugnis gaben. Von Gruets Hand geschrieben fanden sich drei J a h r e später sogar Schmähungen der Bibel, Christi, Marias und anderer biblischer Gruet gehörte zu den eingangs beschriebenen
Personen.
französischen
Libertinern; er stand in Verbindung mit Etienne Dolet. Der Plan, den französischen König zu einem Drohschreiben an die Genfer zu veranlassen, machte das M a ß
voll. Am 26. Juli
74
Auflehnung gegen das Joch Christi'
wurde er wegen Beleidigung Gottes, Handlungen gegen die Obrigkeit und Bedrohung der Diener Gottes hingerichtet. Perrin war wieder in sein Amt eingesetzt worden. Seine Partei, die „Kreuzler" (Croisés), wie sie nach ihrem Parteizeichen, einem eidgenössischen Kreuz, genannt wurden, gewann bei den Wahlen des Jahres 1548 die Ratsmehrheit. Calvins Anhänger, bezeichnenderweise „Französier" (Francillons) beschimpft, büßten im folgenden Jahr erneut Sitze ein. Ein Vorstoß, die Predigtfreiheit der Pfarrer zu beschränken, scheiterte; der Rat wurde die störenden Mahner nicht los. In dieser Zeit klagte Calvin: „Der Rat ist sehr kühl und träge in der Bestrafung der Frechheit der Bösen, und diese Trägheit mißbrauchen die Gönner der Bösen, alles zu hintertreiben." Kleinigkeiten wurden nun hochgespielt. Ein Brief Calvins an Viret in Lausanne wird abgefangen, in dem der Genfer die Zustände in der Stadt offen kritisiert. Über die vier Bürgermeister hatte Calvin geschrieben: „Unter dem Schein des Christentums wollen sie doch ohne Christus regieren." Calvin verteidigte sich, so gut er konnte. Um die Gemüter zu beruhigen, mußten Farel und Viret nach Genf kommen. Im Jahre 1551 kam es zu einem neuen Lehrprozeß. Der Bericht der Genfer Pfarrer bietet ein anschauliches Bild von den Vorgängen und dem Gegenstand des Streites. „Es lebt hier ein gewisser Jerôme (Bolsec), der, nachdem er die Mönchskutte abgeworfen, einer der herumziehenden Ärzte geworden ist, die sich durch Lug und Trug eine solche Freiheit erwerben, daß sie zu jedem Wagnis schnell bereit sind. Schon vor acht Monaten hat er versucht, in einer öffentlichen Versammlung unserer Kirche die Lehre von der Gnadenwahl Gottes, die wir nach Gottes Wort annehmen und mit Euch lehren, ins Wanken zu bringen. Damals wurde der freche Mensch mit möglichster Mäßigung zur Ruhe gebracht. Seither hat er nicht aufgehört, überall daraufhin zu arbeiten, den Einfältigen diesen Glaubenssatz zu zerstören. Neulich aber (am 16. Oktober) hat er (in der Bibelbesprechung) mit offenem Maul sein Gift ausgespieen.
Auflehnung gegen das Joch Christi'
75
Denn als nach unserem Brauch einer der Brüder das W o r t im Johannesevangelium (8, Vers 47) auslegte: W e r von G o t t ist, der hört Gottes W o r t ; darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott, - und sagte, wer nicht aus dem Geiste Gottes wiedergeboren sei, der widerstrebe G o t t hartnäckig bis ans Ende, weil der Gehorsam ein besonderes Geschenk Gottes sei, dessen er nur seine Erwählten würdige, da erhob sich dieser windige Geselle und sagte, diese falsche, gottlose Meinung, daß Gottes Wille aller Dinge Ursache sei, die Lorenzo Valla aufgebracht habe, sei in unserem Jahrhundert wiederaufgetaucht. Dadurch würden aber die Sünde und die Schuld an allem Bösen G o t t zugeschrieben und ihm tyrannische Willkür angedichtet, wie die antiken Dichter von ihrem Jupiter fabelten. Er kam dann zu dem anderen Punkt, nicht darum kämen die Menschen zur Seligkeit, weil sie erwählt seien, sondern sie würden erwählt, weil sie glaubten, und keiner werde verworfen bloß auf Gottes Beschluß hin, sondern nur die, die sich selbst der allgemeinen Erwählung entzögen. Bei Behandlung dieser Frage fuhr er mit viel groben Schimpfreden gegen uns los. D e r Stadtpolizeihauptmann ließ ihn ins Gefängnis führen, als er von der Sache hörte, besonders weil er das V o l k aufgehetzt hatte, es solle sich nicht von uns betrügen lassen." D a Bolsec sich auch auf die Nachbarkirchen berufen hatte, wurden von Bern, Zürich und Basel Gutachten eingeholt. Sie fielen jedoch nicht nach Calvins Wunsch aus. Bolsecs Lehrweise wurde zwar abgewiesen, Calvins Prädestinationslehre fand jedoch keine volle Zustimmung. Den Genfer Reformator hat diese Kritik tief getroffen. Bolsec wurde zur Strafe aus der Stadt verbannt. Im Bolsecprozeß hatte sich der R a t ohne Zögern hinter die Pfarrer gestellt. Die Pfarrerschaft widmete ihm daraufhin als Neujahrsgabe die von Calvin verfaßte Schrift „De aeterna praedestinatione", in der ihre Lehre nochmals vorgetragen wurde. Es war aber seit Bolsecs Angriff noch kein J a h r vergangen, als Trolliet Calvin beim Rat verklagte, er lehre, Gott
76
Auflehnung gegen das Joch Christi'
sei die Ursache der Sünde. Geschickt vermied er es, sich auf die Prädestinationslehre einzulassen. Er folgerte vielmehr aus Calvins Lehre, die Menschen seien zum Sündigen gezwungen. Die Grundlage der öffentlichen Moral schien gefährdet zu sein. Es bedurfte wieder des Eingreifens Virets und Farels, um Calvin zu rechtfertigen. Die Auseinandersetzungen mit dem Rat waren keineswegs beendet. Im Herbst 1553 kam es zu einer erneuten Kraftprobe. Philibert Berthelier, seit anderthalb Jahren wegen seines unordentlichen Lebenswandels vom Abendmahl ausgeschlossen, wandte sich an den Rat mit der Bitte, den Spruch des Konsistoriums aufzuheben. Da er aus einer bekannten Familie stammte und viele Gönner im Rat hatte, wurde seinem Gesuch stattgegeben. Dieser Entscheid bedeutete ein schwerer Eingriff in die Rechte des Konsistoriums. Calvins Einspruch vor dem Rat stieß indessen auf taube Ohren. Seine Gegner, an der Spitze Perrin, wollten offensichtlich die Macht der Pfarrer brechen. Der Abendmahlssonntag, der 3. September, stand bevor. Würde Calvin dem Rat trotzen? In der vollbesetzten Kirche legte er zunächst in der Predigt die Grundsätze der Kirchenzucht dar und erklärte dann: „Ich folge dem (Kirchenvater) Chrysostomus und will lieber den Tod erleiden, als daß diese meine Hand den verurteilten Verächtern Gottes die heiligen Zeichen des Herrn reichen!" Perrin soll daraufhin Berthelier bewogen haben, nicht zum Abendmahl vorzutreten; die Gegner ließen es nicht zum Äußersten kommen. Calvin, der von ihrem Einlenken nichts wußte, erwartete seine erneute Verbannung. Im Nachmittagsgottesdienst verabschiedete er sich von der Gemeinde. Da gerade die Abschiedsrede des Paulus in Ephesus an der Reihe war, sagte er: „Es sei auch mir, liebe Brüder, erlaubt, euch gegenüber die Worte des Apostels zu gebrauchen: ,Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade' (Apg. 20, Vers 22)." Als Calvin am nächsten Tag mit allen Pfarrern vor dem Rat erschien, nahm dieser seinen Beschluß zurück.
Auflehnung gegen das Joch Christi'
77
Der Fall Berthelier fällt in die Zeit des Servetprozesses. Et wirft daher Licht auf die damalige Machtverteilung in Genf. Calvins Einfluß auf den Rat hat einen Tiefpunkt erreicht. Am 7. September schreibt er: „Wenn ich z. B. behauptete, es sei um Mittag hell, würden sie es gleich in Zweifel ziehen." Urteile wie „Calvin ließ Servet hinrichten", die man so oder ähnlich noch heute lesen kann, erweisen sich schon aus diesem Grund als unsinnig. Sie sind auch aus anderen Gründen unzutreffend. Die dürren Fakten sehen wie folgt aus: Michael Servet, ein gelehrter Spanier, lebte in Vienne in Frankreich als Arzt. Er hatte den Namen Michel de Villeneuve (nach seinem Geburtsort Villanova) angenommen, weil er im Jahre 1531, erst zwanzigjährig, in Deutschland ein Buch „Uber die Irrtümer der Dreieinigkeit" (De Trinitatis erroribus) veröffentlicht hatte. Seitdem suchte ihn die Inquisition. Calvin, selbst auf der Flucht, verabredete im Jahre 1534 mit ihm ein Gespräch in Paris, doch erschien jener nicht. Viele Jahre später, 1546, kam es zu einem Briefwechsel zwischen beiden Männern. Servet sandte nicht weniger als 30 Briefe nach Genf. Es ergibt sich die seltsame Lage, daß bereits im Jahre 1546 die Fronten zwischen ihnen völlig geklärt waren: Servet will nach Genf kommen, Calvin aber lehnt ab. An Farel schreibt er: „Wenn Servet kommt, werde ich nicht dulden, daß er lebend wieder geht, wenn meine Autorität nur etwas gilt." In seinen Briefen bezeichnet Servet das christliche Gottesbild als „dreiköpfigen Höllenhund", schmäht die Lehre von der Erbsünde, Prädestination und Glaubensgerechtigkeit. Er selbst ist apokalyptischer Schwärmer geworden, denn er versteht sich als Waffenträger des Erzengels Michael. Der Endkampf (Offenbarung 12) stehe bevor, er selbst werde darin umkommen. Wie verträgt sich damit die heute noch vielbeachtete Tatsache, daß Servet der Entdecker des kleinen Blutkreislaufes ist? Wichtig ist, daß er beim Sezieren der Leichen die Ansicht des Galenus über den Blutkreislauf nicht bestätigt fand. Doch darf man sich von ihm trotzdem nicht das Bild eines modernen
78
Auflehnung gegen das J o c h Christi'
Forschers machen. Seine Entdeckung entspringt eben der Theologie, die ihn schließlich auf den Scheiterhaufen brachte. Sein Gedankengang ist folgender: Der Mensch hat nicht nur eine unsterbliche Seele, vielmehr ist seine Seele das Göttliche im Menschen. Servet ist Mystiker und Pantheist. Nach alttestamentlicher Auffassung befindet sich aber die Seele im Blut (1. Mose 9, Vers 4; 3. Mose 17, Vers 11). Diese Ansicht kommt Servets Denken entgegen, denn Gott ist ebenso wie das Blut Bewegung. Gott durchströmt und belebt den ganzen Körper. Diesen Gedanken hat er anatomisch bestätigt gefunden. Servets Lehre von der Vergottung des Menschen führte ihn zur Entdeckung des kleinen Blutkreislaufes. Übrigens hatte der Araber Ibn An-Nafis im 13. Jahrhundert bereits diese Erkenntnis gewonnen. Im Jahre 1553 veröffentlichte Servet seine Entdeckung in der Schrift „Die Wiederherstellung des Christentums" (Christianismi Restitutio). In ihr wiederholt er seine Angriffe auf die kirchliche Trinitätslehre. Da das Buch geheim gedruckt worden war, und Servet in Vienne unter einem Pseudonym lebte, war der Verfasser nicht aufzuspüren. Erst mit Hilfe Calvins konnte die Inquisition ihn fassen. Doch gab der Genfer sein Wissen nur widerwillig preis. Folgendes hatte sich ereignet: Ein Freund Calvins, Guillaume Trie, hatte in Lyon einen katholischen Vetter. Als jener in einem Brief die Genfer der Zuchtlosigkeit zieh, hielt Trie ihm entgegen, in Frankreich bleibe sogar Servet ungeschoren. Das Wissen um dessen Identität hatte er von Calvin. Vor der Inquisition leugnete Servet aber alles ab; eine Haussuchung blieb ergebnislos. Von seinem Vetter wurde Trie nun ersucht, Beweise für die Verdächtigung zu liefern. Dieser bedrängte Calvin so lange, bis er eigenhändige Briefe Servets herausgab, die jene Ketzereien enthielten. Trie betont im Brief an seinen Vetter: „Es war keine Kleinigkeit, das alles von Calvin zu bekommen, was ich euch schicke. Nicht etwa, weil er solche verruchten Gotteslästerungen nicht unterdrücken will, sondern weil er es für seine Pflicht hält, Ketzer besser durch die
Auflehnung gegen das Joch Christi'
79
Lehre als durch andere Mittel zu überzeugen, denn er führe nicht das Schwert der Gerechtigkeit." Durch Flucht aus dem Gefängnis vermochte Servet mit knapper Not der Verurteilung zu entgehen. Er begab sich nach Genf. Da er wissen mußte, was ihn in Genf erwartete, sind seine Beweggründe nur schwer auszumachen. Es gibt Anzeichen dafür, daß er mit Ami Perrin, dem Führer der calvinfeindlichen Partei, Beziehungen unterhielt. Am wahrscheinlichsten ist, daß er, von apokalyptischen Ideen verblendet, die Entscheidung in Genf suchte. Am 13. August, einem Sonntag, wurde er im Gottesdienst von Franzosen aus Lyon erkannt. Calvin erhob selbst Anklage gegen ihn, weil er dem Rat kein schnelles Eingreifen zutraute. Nun geht alles seinen vorgeschriebenen Weg. In Genf galt die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl V., die sogenannte Carolina. Der Angeklagte und sein Kläger müssen ins Gefängnis (Art. 12). Als Geistlicher durfte Calvin einen Vertreter schicken (Art. 14), seinen Sekretär. Am 24. August übernahm der öffentliche Ankläger die Klage; Calvin war nun im Prozeß nicht mehr Kläger, sondern nur noch theologischer Gutachter. Der Rat hat schließlich Gutachten der evangelischen Schweizerstädte eingeholt, die alle Servet zum Ketzer erklärten. Es muß beachtet werden, daß Servet nicht wegen seiner Ablehnung evangelischer Lehrstücke verurteilt worden ist. Aus den zahlreichen Anklagepunkten nahm das Gericht nur die Schmähung der göttlichen Trinität und der Kindertaufe auf. Sie mußten nach dem Reichsrecht streng bestraft werden. Artikel 106 der Carolina besagt, daß Gotteslästerung „an Leib, Leben oder Gliedern" zu strafen sei. Das Corpus Iuris Civilis, geltendes Recht, schützt ausdrücklich die Trinitätslehre (I, 1,1) und fordert scharfe Bestrafung der Wiedertäufer (I, 5,2). Am 26. Oktober wurde Servet zum Feuertod verurteilt. Calvin hat vergebens versucht, das Urteil in Enthauptung zu verwandeln. Vergebens waren seine Versuche, Servet zur Einsicht zu bewegen. Am nächsten Tag starb der Verurteilte in den
80
Auflehnung gegen das J o c h Christi'
Flammen mit dem Ruf: „O Jesu, Sohn des ewigen Gottes, erbarme dich meiner!" Farel, der ihn auf seinem letzten Weg begleitete, bemerkt zu Recht, er hätte durch eine kleine Änderung der Wortfolge widerrufen können: „O Jesu, ewiger Sohn Gottes." Servet beharrte bis zuletzt in seiner Überzeugung. Wer war schuld an diesem Ketzerprozeß? Nicht Calvin allein, sondern seine ganze Zeit, die bis auf wenige Ausnahmen Toleranz in Glaubensfragen nicht kannte. Doch scheint auch Calvin bei alledem nicht wohl gewesen zu sein. Als Castellio und andere im nächsten Jahr mit dem Buch „Über die Ketzer, ob man sie verfolgen soll" (De Haereticis, an sint persequendi) Calvin angriff, antwortete der mit einer „Defensio orthodoxae fidei de Trinitate". Warum aber stritt er ab, an der Verhaftung Servets in Vienne beteiligt gewesen zu sein? Sein Mitwirken - wenn auch indirekt - ist eine Tatsache. Castellios Buch fand ein unerwartet starkes Echo. Der Gedanke der Toleranz setzte sich nach dem Servetprozeß mehr und mehr durch. Calvins Name ist aber bis heute unlösbar mit dem Odium der Intoleranz behaftet. Zu Unrecht! Das 16. Jahrhundert hat noch viele ähnliche Ketzerprozesse erlebt. Im Jahre 1555 endeten die Auseinandersetzungen über die kirchlichen Rechte zwischen der Genfer Pfarrerschaft und dem Rat. Auch kommt es — wohl nicht zufällig - zu keinen Lehrprozessen mehr. Der Umsturzversuch einiger ,Libertiner' führte zur Entmachtung der führenden Ratspartei, die Anhänger Calvins behielten von nun an die Mehrheit im Rat. Bei der Betrachtung des Regierungswechsels im Jahr 1540 hatte sich bereits gezeigt, welch geringfügigen Ursachen in Genf zu Empörungen und Umsturz führen konnten. Die Umstände des Putsches vom 16. Mai 1555 sind ebenfalls nur schwer zu durchschauen. Soviel ist deutlich, die Aufnahme einer großen Zahl französischer Flüchtlinge in die Bürgerschaft gibt den äußeren Anlaß, denn naturgemäß sind sie Anhänger Calvins. Auch in den vorausgehenden Jahren waren immer wieder Aufnahmen ins Bürgerrecht erfolgt. Es war verständlich, daß eine Stadt ihre
Auflehnung gegen das Joch Christi'
81
Bewohner durch den Bürgereid in Recht und Pflicht nahm. Auch brachten die Einbürgerungen der Stadt finanzielle Einnahmen. Calvin gesteht, daß seine Anhänger den Stimmenzuwachs betrieben hätten. Die Gegenpartei scheint im Jahre 1553 ähnlich taktiert zu haben. Perrin und seine Gesinnungsfreunde erkannten nun, daß sie keine Aussichten hatten, je wieder an die Macht zu kommen, wenn die Flüchtlinge das Bürgerrecht behielten. Sie versuchten daher, das Volk gegen die Franzosen aufzuhetzen und nationale Leidenschaften zu wecken. Am 16. März 1555 kam es nachts zu einem Auflauf. Drohungen gegen die Franzosen wurden laut. Entscheidend wurde, daß Perrin einem Bürgermeister das Zeichen seiner Regierungsgewalt, den Amtsstab, entriß. Ebenso erging es dem Bürgermeister Aubert, als er eine Verhaftung vornehmen wollte. Der Auflauf zerstreute sich, das heimliche Aufgebot der Wehrpflichtigen und die Gewaltanwendung gegenüber den Bürgermeistern aber wurde als Aufruhr ausgelegt. Perrin und fünf andere flohen, zwölf Beteiligte wurden zum Tode verurteilt, vier von ihnen wurden hingerichtet, die anderen entkamen. Wer diese Strafe für zu hart hält, muß bedenken, daß das 16. Jahrhundert keine langen Gefängnisstrafen kannte. Den heutigen Zuchthausstrafen entsprach die Verbannung oder die Todesstrafe. Die calvinfeindliche Ratspartei war nun für immer zerschlagen. Für Calvin begannen die Jahre der Festigung seines Werkes in Genf, der verstärkten wissenschaftlichen Arbeit und des intensiven Einflusses auf die Kirchen in ganz Europa. Bevor diese Wirksamkeit des Reformators hier zur Sprache kommt, soll die Bezeichnung „Genfer Theokratie" - wie durchgängig Calvins Herrschaft in Genf bezeichnet wird - auf ihre Berechtigung hin geprüft werden. Nun fällt eine sachliche Beurteilung des Genfer Alltags dem heutigen Betrachter schwer, weil er nur zu leicht seine persönliche Freiheit durch die Genfer Gesetze bedroht fühlt. Emotionale Urteile wie „elendes Spionier- und Denunziantenwesen" oder „despotische Herrschaft 6
Neuser, Calvin
82
Auflehnung gegen das Joch Christi'
der Theologen im politischen Gemeinwesen" (K. Heussi) verraten lediglich eine moderne Betrachtungsweise. Richtig erkannt ist dabei, daß Theokratie immer Priesterherrschaft, das heißt in Genf, Theologenherrschaft bedeutet. Wenn statt Theokratie andere Begriffe gewählt worden sind wie Bibliokratie oder Christokratie, so besagen auch sie nichts anderes. Keiner der Begriffe trifft für Genf zu! Die Darstellung der Kirchenzucht hat deutlich gemacht, in welchem M a ß der Rat dem Konsistorium - in dem bekanntlich auch Ratsvertreter Sitz und Stimme hatten - strafrechtliche Befugnisse eingeräumt hatte. Eine Strafgewalt bestand nicht. Der Einfluß des Konsistoriums beruhte letztlich ganz und gar auf seinem entschiedenen Auftreten, seiner Hartnäckigkeit und Furchtlosigkeit. Seine Macht hing immer überwiegend von der Überzeugungskraft seiner Mitglieder ab; sie ist geistliche Macht gewesen. Keiner der Pfarrer war Angehöriger des Rates und auch Calvin gehörte keinem Regierungsgremium an. Erst im Jahre 1559 trug man ihm das Bürgerrecht an, das die Voraussetzung dazu gewesen wäre. Wie oft haben Farel und Viret ihm gegen den Rat zu Hilfe kommen müssen! Um so höher muß man Calvins Rednergabe und Überzeugungskraft und also die Macht seiner Persönlichkeit einschätzen. Ernst Pfisterer hat ein Bild des geselligen Lebens in Genf aus den Akten zusammengestellt. Es verdeutlicht, wie die sogenannte Genfer Theokratie in Wahrheit aussah. Zuerst einmal fällt auf, daß Tanzen in der Öffentlichkeit, Glücksspiele, Spiele während der Gottesdienstzeit, jegliche Maskeraden und Vermummungen und der Kleiderluxus bereits in den Genfer Gesetzen aus dem 15. Jahrhundert oder in den Reichspolizeiordnungen verboten waren. Das völlige Tanzverbot stammt allerdings aus der Zeit Calvins und führte etwa zum Zusammenstoß mit Perrins Frau. Es ist möglich, daß der Verstoß gegen den Anstand der Anlaß war. Die Glücksspiele - Karten- und Würfelspiele um Geld - waren verboten. Kegeln und andere Spiele im Freien erlaubt. Calvins Grundsatz ist: „Was ich für das
Auflehnung gegen das J o c h Christi'
83
Spiel wünsche, ist die Mäßigung. Mögen die Spiele weder das M a ß an Ausgaben noch an Häufigkeit überschreiten!" Einem freudlosen Leben ohne Lachen, Scherz und Witz widersetzte er sich. Zu Unrecht ist ihm auch das Verbot der im Volk beliebten dramatischen Aufführungen angelastet worden. Geistliche Stücke, sogenannte Mysterien, wurden seit 1546 nicht mehr aufgeführt, weil sie sich offensichtlich überlebt hatten. Die Zeit der Schuldramen begann. Das Genfer Gymnasium führte nun römische Komödien und Fabeln oder Stücke mit reformatorischer Kritik am Papsttum auf. Auch Volksfeste fehlten nicht. Das wichtigste war das jährliche Vogelschießen, das im Jahr 1552 der Pest wegen ausfallen mußte. Der Fortfall der Fastnachtsmaskeraden wird vorwiegend militärische Gründe gehabt haben. Sie spielen auch bei der Beaufsichtigung der Wirtshäuser eine Rolle. Die mißglückte Reform des Schankwesens im Jahre 1546 fand jedenfalls nicht allein auf kirchliches Betreiben hin statt. Der Rat beschloß damals, neue Gaststätten, „Abteien" genannt, einzurichten, in denen Fluchen und Lästern und unerlaubte Spiele verboten sein sollten. Der Wirt hatte darauf zu achten, daß das Tischgebet gesprochen, geistliche Lieder gesungen und erbauliche Gespräche über Gottes Wort geführt würden. Die Genfer Bürger sollten die Wirtshäuser für die durchreisenden Fremden nicht mehr aufsuchen. Doch schon nach vier Wochen wurde der Versuch abgebrochen, weil er undurchführbar war. Auch ein Verbot des Wirtshausbesuches im Jahre 1560 scheiterte. Das Konsistorium mahnte den Rat im folgenden Jahr lediglich, die Wirtschaften besser zu beaufsichtigen. Die Luxusbeschränkung endlich muß als soziale T a t gewertet werden. Die geschlitzten, mit Seide gefütterten Hosen, die Schnabelschuhe und das Vergolden der Haare waren unnötiger Luxus. Ein Gastmahl durfte drei Gänge mit je vier Gerichten nicht überschreiten - selbst nach heutigen Maßstäben kein geringer Aufwand! Die Begrenzung des Gold- und Silberschmuckes auf zwei Ringe und auf Goldfäden in der Kleidung 6*
84
Calvins Verhältnis zu Deutschland u. d. Ostschweiz
wird heute dagegen als einschneidend empfunden werden. Mit alledem wollte der Rat der Verschwendung begegnen. Die Anzeigepflicht bei öffentlichem Fluchen und Gotteslästern hatte im Jahre 1532 noch der katholische Bischof verfügt. Die Denunziationspflicht ist also keine Erfindung Calvins; sie galt auch in allen Nachbarstädten. Das vielgenannte Genfer Spioniersystem aber diente nachweislich militärischen Zwecken. In dieser Weise wirkte sich die sogenannte Genfer Theokratie auf das Leben aus. War sie wirklich despotisch?
9. Calvins Verhältnis zu Deutschland und der Ostschweiz Obgleich sich die Schweiz seit dem Ende des 15. Jahrhunderts politisch von Deutschland gelöst hatte, gibt es Gründe, Calvins Beziehungen zu den beiden deutschsprachigen Nachbarländern zusammengefaßt darzustellen. Durch den Abendmahlsstreit wurde er nämlich wider Willen zum Anschluß entweder an den Zürcher und Berner Zwinglianismus oder an das deutsche Luthertum gedrängt. Calvin hat sich einer einseitigen Bindung widersetzt, er suchte den Ausgleich mit beiden Parteien. Seine zahlreichen Versuche, den Protestantismus wieder auszusöhnen, schlugen jedoch fehl. Seine Bemühungen um den Frieden sind nicht verstanden worden; seine Stimme ging im Kampfeslärm unter. Die nachfolgende Geschichtsschreibung hat ihn als Antilutheraner abgestempelt. Doch verdient sein Ringen um die Einheit festgehalten zu werden. Martin Bucers Versuche im Jahre 1536, die evangelischen Schweizerstädte zum Anschluß an die Wittenberger Konkordie zu bewegen, waren gescheitert. Sie hatten ihm viel Mißtrauen und Verdächtigungen eingetragen. Calvin machte sich in Straßburg Bucers Anliegen zu eigen. Als er im Jahre 1541, von den deutschen Lutheranern als einer der Ihren betrachtet, nach Genf zurückkehrte, unternahm er sogleich einen weiteren Konkordienversuch. Er veröffentlichte die „Kurze Abhandlung über
Calvins Verhältnis zu Deutschland u. d. Ostschweiz
85
das heilige Abendmahl" (Petit Traicté de la Saincte Cène). Offen erklärte er darin: „Von Fehlern ist keine der beiden Parteien freizusprechen, weder Luther noch Oekolampad und Zwingli." Er entwirft eine neue Einigungsformel. Der Erfolg blieb aus, obwohl im Jahre 1545 die Schrift in lateinischer Sprache erschien und nun allen Theologen zugänglich war. Stattdessen wurden im Jahr 1548 seine Anhänger im Waadtland des „Calvinismus und Bucerianismus" bezichtigt. Ihr „Calvinismus" bestand in der Ablehnung des zwinglischen Staatskirchentums, das in Bern kompromißlos praktiziert wurde. Die waadtländischen Pfarrer forderten nämlich eigene Kirchenzucht, Anhörung in kirchlichen Angelegenheiten (z. B. bei der Pfarrwahl) und das Recht, zu eigenen Beratungen zusammenzutreten. Calvin war denn auch nicht bereit, über die „Tyrannei" der Berner Obrigkeit zu verhandeln. Darum trat er in briefliche Verhandlungen mit Bullinger in Zürich über den „Bucerianismus", das heißt, über die vermeintliche Hinneigung zur lutherischen Abendmahlslehre. Eine Übereinkunft sollte den benachbarten Pfarrern mehr Handlungsfreiheit verschaffen. Der lange Briefwechsel mit Bullinger erbrachte endlich Übereinstimmung. Calvins Drängen auf eine schriftliche Besiegelung begegnete der Zürcher jedoch mit Hinhalten. Unter einem Vorwand erschien Calvin schließlich Ende Mai 1549 in Zürich. Dort wurde der Consensus Tigurinus aufgesetzt und unterzeichnet. Aber Calvin hat diesen Erfolg mit erheblichen Zugeständnissen in der Lehre bezahlen müssen. Zudem blieben die erhofften Erleichterungen für seine Anhänger im Waadtland aus. Die Züricher Einigungsformel ist das große Einheitsband des entstehenden Reformiertentums geworden; sie hat ein Auseinandergehen der Zwinglianer und Calvinisten für alle Zeiten verhindert. Die Trennung vom Luthertum ist durch sie indessen beschleunigt worden, wie noch zu zeigen sein wird. Die Verbindung nach Deutschland, die Calvin in Straßburg und auf den Religionsgesprächen angeknüpft hatte, hat er zu-
86
Calvins Verhältnis zu Deutschland u. d. Ostschweiz
nächst nach Kräften aufrecht erhalten. „Wenn man seine Briefe durchgeht, erstaunt man, mit welcher fortgehenden Aufmerksamkeit er alles verfolgt, was in Deutschland sich zuträgt, welchen lebensfrischen Anteil er daran nimmt, wie unterrichtet er sich nach jeder Seite hin z e i g t . . . Nicht über die Angelegenheiten in seinem Genf, nicht über diejenigen des heimatlichen Frankreich drückt er sich teilnehmender, bewegter, eingehender aus" (E. Stähelin). Auch literarisch setzte er sich wiederholt für den in Worms und Regensburg betriebenen kirchlichen Ausgleich ein. Als Kaiser Karl V. den Reichstag nach Speyer (1544) berief und eine Nationalsynode ankündigte, verteidigte Calvin das Vorhaben gegen den Papst, der dem Kaiser öffentlich Vorwürfe gemacht hatte. Der lateinische Titel drückt sein Anliegen aus. „Väterliches Mahnschreiben des römischen Papstes Paul III. an den unüberwindlichen Kaiser Karl V., in dem er ihn dafür straft, daß er sich allzu gütig gegen die Lutheraner erweist, ferner daß er sich Macht anmaßt, eine Synode einzuberufen, um die Auseinandersetzungen um den Glauben einzuschränken, mit Anmerkungen Johann Calvins." Das Seitenstück zu dieser Schrift lautet, „Untertäniges Mahnschreiben an den unüberwindlichen Kaiser Karl V., an die erlauchten Fürsten und übrigen Stände auf dem Reichstag zu Speyer, sich mit rechtem Ernst an die Erneuerung der Kirche zu machen". Zu der angesagten Nationalsynode kam es nicht. Vielmehr wurde der deutsche Protantismus, in sich selbst uneinig, durch den Kaiser von den Verbündeten isoliert und im Jahre 1547 fast völlig geschlagen. Calvin erwartete nun das Vorgehen des Kaisers gegen die evangelischen Schweizerkantone und bemühte sich um eine gemeinsame Abwehrfront. Die deutschen Freunde wurden von ihm getröstet und gestärkt. Als der Kaiser, um seinen Sieg auszunutzen, mit Hilfe einiger evangelischer Theologen eine katholisierende Kirchenordnung, das sogenannte Interim, erarbeiten ließ, meldete sich Calvin mit einem flammenden Protest gegen „Das Bastard-Interim, verbunden mit
Calvins Verhältnis zu Deutschland u. d. Ostschweiz
87
einem wirklichen Vorschlag für eine christliche Friedensstiftung und kirchliche Reformation" (1548). Es war eine Ankündigung bevorstehender innerprotestantischer Auseinandersetzungen, daß in einem deutschen Nachdruck Calvins Ausführungen über die Taufe, insbesondere über ihre Heilsnotwendigkeit weggelassen waren. Der Druck ist allem Anschein nach in Magdeburg erfolgt, die Auslassungen von dem Genesiolutheraner Flacius Illyricus begründet worden. Luthers anerkennendes Urteil über Calvin aus dem Jahr 1539 wurde schon erwähnt. Begegnet sind sich die beiden Reformatoren nie. Der einzige Brief, den Calvin im Januar 1545 an Luther geschrieben hat, erreichte jenen nicht. Melanchthon wagte nicht, ihn abzugeben, weil Luther gerade eine Schrift gegen die Züricher hatte ausgehen lassen, und der Abendmahlsstreit wieder auszubrechen schien. Doch hat sich Luther nach einem späteren, vertrauenswürdigen Bericht im Frühjahr 1545 wohlwollend über Calvins Petit Traicté de la Saincte Cène geäußert. Calvin hat seinerseits immer mit großer Ehrerbietung von Luther, „dem ausgezeichnetem Apostel Christi", geredet. Als 1552 der Abendmahlsstreit wieder heftig ausbrach, fand sich Calvin bald in ihn verstrickt. Der Abschluß des Consensus Tigurinus erwies sich nun als folgenschwer. Johann a Lasco, Leiter der Londoner Flüchtlingsgemeinde, hatte ihn im Jahre 1552 zusammen mit anderen Schriften drucken lassen. Die Lutheraner in Antwerpen, die mit den dortigen Calvinisten im Streit lagen, wurden auf ihn aufmerksam. Ein Hilferuf um literarischen Beistand nach Hamburg hatte Erfolg. Joachim Westphal meldete sich als Verteidiger des anscheinend bedrohten Luthertums zu Wort. Auf diese unglückliche Weise wurden die deutschen und schweizerischen Kirchen in den Streit gezogen. Die Lage verschärfte sich noch mehr, als im nächsten Jahr nach dem Regierungsantritt der „katholischen M a r i a " a Lasco mit seiner Gemeinde England verlassen mußte. Seiner
88
Calvins Verhältnis zu Deutschland u. d. Ostschweiz
Abendmahlslehre wegen wurde er in Dänemark und in den lutherischen Städten Norddeutschlands nicht aufgenommen. Nun griff auch Calvin zur Feder. Von Jahr zu Jahr wuchs die Zahl der Schriften und der streitenden Theologen; die Schärfe der Auseinandersetzungen nahm zu, auch bei Calvin. Hatte er sein früheres Streben nach kirchlicher Einheit aufgegeben? Keineswegs, denn neben der Verteidigung der Wahrheit wie er sie verstand, stehen erneute Unionsversuche. Sowohl in seinen Veröffentlichungen wie in Privatbriefen hat er seine Übereinstimmung mit Melanchthon und dem Augsburger Bekenntnis bezeugt und erklärt. Sein Fehler war, daß er den Einfluß Melanchthons und seiner Anhänger überschätzte. Es ist ihm nicht gelungen, den Wittenberger zum Bundesgenossen zu gewinnen, obgleich dessen Abkehr von Luthers Lehre immer deutlicher wurde. Es scheiterten auch die Unionsverhandlungen mit den deutschen evangelischen Fürsten, die er durch Theodor Beza bei dessen Gesandtschaften zum Schutz der verfolgten französischen Protestanten im Frühjahr und Herbst 1557 und nochmals 1559 führen ließ. Das Mißtrauen Bullingers war zu groß, der Streit mit den Genesiolutheranern zu weit fortgeschritten. Seine Gegner haben ihn in diesen Jahren zum Sakramentsfeind gleich Zwingli abgestempelt. Seitdem steht er in diesem Ruf. Auch sein freundschaftliches Verhältnis zu Melanchthon erlischt. Als die Kurpfalz im Jahre 1561 zum reformierten Bekenntnis überwechselte, gewann er noch einmal Einfluß in diesem bedeutenden deutschen Territorium. Doch kam es auch dort zu Auseinandersetzungen mit den Zwinglianern um die Kirchenzucht. Erst nach seinem Tod hat Calvins Theologie in Deutschland größere Beachtung gefunden. Durch den niederländischen Freiheitskampf drang vom Westen her calvinische Theologie in die Gemeinden, und mehrere Melanchthonschüler wurden nach 1574 Anhänger und Verbreiter der Genfer Lehre. Es bildete sich das deutsche Reformiertentum, dessen Eigenart in der Verschmelzung zwinglischer, calvinischer und melanchthonischer Elemente liegt.
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
89
10. Die Ausbreitung der Reformation in Europa Die reformatorischen Bewegungen in den europäischen Ländern hat Calvin aufmerksam verfolgt. Nur in Frankreich wird er ihr theologischer Führer und Organisator. Auf die französische Reformation soll gesondert eingegangen werden, denn so direkt und umfassend wie in seinem Heimatland hat er in keinem anderen europäischen Lande gewirkt. Ein Blick auf Polen vermittelt ein gutes Bild vom Umfang seiner europäischen Korrespondenz, von seiner Meisterschaft des Briefschreibens und von dem Gehör, das er auch in fernen Ländern fand. Calvin war dort theologischer Ratgeber und eindringlicher Mahner, der seinen Adressaten Mut zu machen und sie nachhaltig aufzurütteln verstand. Er ist nur mit wenigen Polen persönlich zusammengetroffen. Die polnischen Studenten besuchten - im eigenen Lande stark vom Deutschtum bestimmt - wohl Wittenberg und Zürich, nicht aber Genf. Zunächst standen die Züricher in engerem Briefwechsel mit den polnischen Protestanten. Wenn Besucher oder briefliche Anfragen eintrafen, gingen sie nach Zürich und von dort aus nach Genf. Dann aber errang Calvin durch seine Institutio und seinen Briefwechsel eine eigene Anhängerschaft in Polen. Die Kontakte begannen, als der adelige Hochstapler Florian Susliga den Westen bereiste. Auf sein Drängen hin richtete Calvin ein erstes Schreiben an den polnischen König Sigismund August (1549), er widmete ihm seinen Hebräerbriefkommentar. Das Werk gibt ihm Gelegenheit, sich ausführlich über die römische Messe zu äußern. Es ist ein glänzend abgefaßtes Sendschreiben, in der Form ehrerbietig, in der Sache überlegen und im T o n eindringlich-seelsorgerlich. Als der Beichtvater des Königs, der Franziskaner Lismanino, im Jahre 1554 in Deutschland und der Schweiz für den polnischen Protestantismus warb, schien der Sieg in Polen fast errungen zu sein. Der König zeigte offensichtlich Neigungen zur Reformation. Zwei Jahre später schrieb der päpstliche Nuntius Lipomani nach Rom: „Polen ist
90
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
verloren und kaum noch Hoffnung, es wiederzugewinnen." Von Lismanino dazu aufgefordert, verfaßte Calvin 1554 ein zweites Lehrschreiben, das dem ersten an Eindrücklichkeit nicht nachstand. Nun gibt er Ratschläge für die Durchführung der Reformation im Lande. Dem Anspruch des Papstes auf die Leitung der Kirche stellt er die Autorität der Synode entgegen; das Bischofsamt könne aber beibehalten werden. Das Priesteramt bindet er an die Predigt und fordert auf, an die Stelle der Wölfe Hirten der Gemeinde zu setzen. Doch erfüllten sich die Hoffnungen auf eine baldige Reformation Polens nicht. Der König war nicht zu praktischen Reformen bereit. Als Lismanino die Kutte ablegte und heiratete, wandte er sich wegen Bruchs des Kirchenrechts von ihm ab. Es bleibt unklar, ob ihn dazu seine Uberzeugung oder außen- und innenpolitische Gründe leiteten. In Kenntnis der polnischen Situation hatte Lismanino Calvin bewogen, Mahnschreiben an eine große Zahl einflußreicher Adeliger zu richten. Der Briefwechsel des Genfer Reformators mit Polen besteht zu einem guten Teil aus Briefen dieser Art, nicht zufällig, denn der Adel besaß weitgehende politische Unabhängigkeit von der Krone. Seine Einstellung zur Reformation war so wichtig wie die des Königs. Damals trat Calvin in dauernde Verbindung zum Fürsten Radziwil, in dessen Gebiet die Schweizer Reformation den stärksten Anklang und Rückhalt fand. Er widmete ihm den Kommentar zur Apostelgeschichte, der einige Jahre zuvor noch ein Vorwort an den dänischen König enthielt. Doch hatte jener die Ehrung durch den Sakramentsfeind abgelehnt; Dänemark blieb dem Genfer Reformator verschlossen. Die Synode Pinczow (1556) rief Calvin und andere reformierte Theologen nach Polen, um für das in Aussicht genommene Nationalkonzil gerüstet zu sein. Doch kam es nicht dazu. Die evangelische Bewegung in Polen erlitt schwere Rückschläge. Ursache war zunächst ihre konfessionelle Zersplitterung. Drei Gruppen gab es im Lande, Lutheraner, Böhmische Brüder und
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
91
Anhänger des Schweizer Bekenntnisses. Kurze Zeit schien es, als könnte Johann a Lasco, der sich in Deutschland und England als Reformator bewährt hatte, die kirchliche Einheit zustande bringen. Die Reformation in Polen schien endlich den dringend notwendigen Führer zu erhalten, als a Lasco, der dem höchsten Adel angehörte, im Jahre 1556 in seine Heimat zurückkehrte. Auf der Heimreise hatte er sich in Frankfurt mit Calvin, in Wittenberg mit Melanchthon beraten und betrieb nun mit aller Kraft die Einigung der polnischen Protestanten. Er fand die Konfession der Böhmischen Brüder von 1535 vor, deren Annahme die Anhänger des Schweizerischen Bekenntnisses auf der Synode zu Kozminek 1555 zugesagt hatten. Auf sein Betreiben hin wurde die Abendmahlslehre verändert, doch waren auch andere Lehren umstritten: Privatbeichte, Verbot des Zehntennehmens, Zölibat der Priester und deren Verpflichtung zur Handarbeit. A Lascos Plan war, daß die geänderte Brüderkonfession das Bekenntnis aller Evangelischen in Polen werden sollte. Doch bestanden die Lutheraner auf dem Augsburger Bekenntnis. Sie versteiften sich um so mehr darauf, als der König im Jahre 1557 dieses Bekenntnis den Städten Danzig, Elbing und Thorn freistellte. Eine allgemeine Anerkennung war zu erwarten. Daher mußten a Lascos Unionspläne scheitern. Hinzu kam, daß die Gutachten der Züricher und Genfer Theologen über die Brüderkonfession ungünstig ausfielen. Sie waren von den Kritikern der Pläne a Lascos angefordert worden. Es zeugt für Calvins Weitblick und theologische Beweglichkeit, daß er der für den polnischen Protestantismus tödlichen Zwietracht zu begegnen suchte. Im Gegensatz zu Bullinger wollte er die Confessio Augustana anerkennen, doch „wie sie der Verfasser (Melanchthon) verstanden hat". Die Verhandlungen mit den Böhmischen Brüdern riet er unbedingt weiterzuführen. Ostrorog, den Führer der Lutheraner, mahnte er brieflich zur Einigkeit. Sein Ziel war in erster Linie die Durchführung der Reformation in Polen. Doch blieben seine Mahnungen ohne Erfolg.
92
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
Die Stammbucheintragung für einen polnischen Studenten drückt Calvins Entschiedenheit aus: „Christus will nicht, daß wir wähnen, er sei gekommen, Frieden zu senden auf Erden, sondern das Schwert (Matt. 10,34—36) . . . Die volle Wahrheit dieser Worte erfahren wir heute in der T a t . . . Dazu muß aber auch das unsere Überzeugung sein, daß Christus stets bei uns sein wird bis zum Untergang der Welt, und wenn wir das festhalten, so werden wir unsere Seelen schließlich auch noch eine Weile in Geduld fassen können. . . . Christus ist Sieger, Christus ist König, Christus ist Herrscher." Zum Verhängnis wurden der polnischen Reformation die antitrinitarischen Streitigkeiten. Es waren Italiener, die die Lehre ins Land brachten. Dem bereits genannten Lismanino waren weitere Landsleute nach Polen gefolgt: der redegewaltige Stancarus aus Mantua, Lelio Sozini, der Arzt Blandrata, Valentin Gentile und Alciati. Sie alle waren von der Philosophie des Neuplatonismus beeinflußt, die sie zu unorthodoxen Spekulationen über die Trinität veranlaßte, den Trinitarier Stancarus ebenso wie seine antitrinitarisch denkenden Landsleute. Sie alle hatten aus Italien fliehen müssen und hatten in Genf, Zürich oder Basel Zuflucht gefunden. Die Hoffnung auf neue Wirkungsstätten - die Königinmutter Bona war gebürtige Italienerin - zog sie nach Polen. Vielleicht wären die Gemeinden mit ihrer Lehre fertig geworden, wenn nicht Stancarus im Jahre 1559 aufgetreten wäre. Nun zerstritten sich die Protestanten über dessen Lehre, daß Christus nur nach seiner menschlichen Natur gelitten habe. Im Widerspruch zur altkirchlichen Trinitätslehre befanden sich beide Teile, ob sie nun mit Stancarus die Gottheit Christi (Homousie) überbetonten oder im Widerspruch zu ihm die Menschheit Jesu aus der Trinität herauslösten, indem sie sein Menschsein hervorhoben (Unitarismus). Da die Antitrinitarier im Schutze des polnischen Adels nicht das Schicksal Servets befürchten mußten, konnte der Streit in den ungefestigten evangelischen Gemeinden um so verheerender wirken. Dem polnischen Protestantismus fehlte wohl auch
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
93
die überragende Führergestalt. A Lascos Kraft war gebrochen, er starb nach nur dreijähriger Tätigkeit. Die zahlreichen Mahnschreiben und Gutachten der Schweizer fruchteten nicht. Calvin hatte schon in Genf Auseinandersetzungen mit Blandrata, Sozini und Gentile führen müssen. Mit Schrecken bemerkte er, daß sich selbst in der italienischen Fremdengemeinde in Genf antitrinitarische Gedanken breit machten. Die Gemeinde wurde einem Glaubensverhör unterzogen. Gegen Blandrata veröffentlichte er 1559 eine „Antwort". Seine Freundschaft mit Radziwil drohte darüber zu zerbrechen. Aber Calvin blieb fest. Noch kurz vor seinem Tode schrieb er eine „Kurze Ermahnung an die Brüder in Polen". Bullinger gegenüber äußerte er damals resignierend, nur sehr wenige meinten es in Polen aufrichtig. Er sollte mit seiner düsteren Prognose recht behalten. Die Vereinigung des polnischen Protestantismus im Consens zu Sendomir (1570) kam zu spät. In der Gegenreformation wurden die Evangelischen mit Hilfe der Jesuiten in die Defensive gedrängt. Im Jahr 1560 empfing Calvin einen Brief der Ältesten der Brüdergemeinde in Böhmen, in dem der Wunsch geäußert wird, die in Straßburg vor zwanzig Jahren geknüpfte Verbindung zu erneuern. Die Gesandtschaft, die das Schreiben überbrachte, hatte allerdings den heiklen Auftrag, die Schweizer Theologen wegen ihrer Kritik an dem Brüderbekenntnis zur Rede zu stellen, die sie drei Jahre zuvor nach Polen geschickt hatten. Es fällt auf, daß die Theologen in Zürich, Bern und Lausanne einlenkten, Calvin aber nicht. Die Gesandten mußten ihr Anliegen in Genf der versammelten Pfarrerschaft vortragen und erhielten mündlich und schriftlich Antwort. Calvin entschuldigte sich nur, die Kritik den Brüdern in Böhmen nicht mitgeteilt zu haben; es sei kein Bote zur Hand gewesen. So freundlich der Ton des Briefes ist, in der Sache nimmt Calvin nichts zurück. Die Abendmahlslehre sei in der Tat der Erklärung bedürftig, auch sei das Bekenntnis dunkel und zweideutig. Die der Konfession beigegebene Apologie sei teilweise zu heftig.
94
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
Wieder stellte sich Calvin an dieser Stelle vor das Augsburger Bekenntnis und ihren Verfasser. Er gibt klar zu erkennen, warum er so hart bleibt: die Eintracht zwischen den Evangelischen in Polen müsse hergestellt werden. Er wirft den Brüdern vor, bei der Bekämpfung der Antitrinitarier in Polen nicht geholfen zu haben. Der Gedankenaustausch der Böhmen mit Genf ist nicht fortgesetzt worden. Czervenka schrieb an den Rand des Briefes: „Du weißt nicht, was du schreibst. Du warst nicht in Polen, lieber Bruder, dort ist es anders, als du denkst." Einen Briefwechsel Calvins mit Theologen in Ungarn gibt es nicht. Nur einige ungarische Besucher Genfs meldeten sich brieflich wieder. Der Grund ist leicht zu finden: Ungarn ist Kriegsgebiet, Boten sind nur schwer zu finden. Auch der spärliche Briefwechsel der Züricher beschränkte sich in dieser Zeit auf einige Ungarn am Wiener Hof. In dieser Lage zeigte sich der Wert des gedruckten Wortes. Mehrere Briefschreiber bezeugen, daß Calvins und Bullingers Schriften im Lande gelesen würden und Anklang fänden. Die Bekenntnisbildung der reformierten Kirche in Ungarn verläuft sogar zunächst in enger Anlehnung an die Genfer Theologie. Die Türken hatten den Ostteil des Landes unterworfen. Da sie den christlichen Glauben nicht unterdrückten, bedeutete ihre Herrschaft für die Evangelischen das Ende der Verfolgung durch die katholische Kirche. Als König Ferdinand im Jahre 1556 seine Truppen aus Siebenbürgen und Ostungarn zurückziehen mußte, konnte sich die evangelische Bewegung ungehindert entfalten, hier vornehmlich das lutherische Bekenntnis, dort das reformierte. Sogleich zeigten sich die unheilvollen Auswirkungen der protestantischen Spaltung. Da die Lutheraner im Jahre 1557 nur ihre eigene Lehre anerkennen wollten und im folgenden Jahr die Augsburger Konfession annahmen, beschloß eine Pfarrerversammlung in Großwardein im September 1557 ein Abendmahlsbekenntnis, das ganz im Sinne Calvins lehrte. Es ist die erste gedruckte calvinische Bekenntnisschrift in Ungarn. Peter Melius, der gerade aus Wittenberg zurückge-
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
95
kommen war, ist ihr Initiator. Er wurde der Führer des ungarischen Calvinismus. Im Jahre 1559 kommt doch ein Consens zustande, das Abendmahlsbekenntnis von Neumarkt, der jedoch keinen Bestand hatte. Zur Verteidigung der reformierten Lehre gegen Katholiken und Lutheraner erschien 1562 das Erlauthaler Bekenntnis, das Calvins Lehre vertritt. In einigen Gebieten wird der Genfer Katechismus für den Unterricht vorgeschrieben. Um ein Gegengewicht zur Confessio Augustana zu schaffen, übernehmen ostungarische Synoden in den Jahren 1562/63 nur wenig abgeändert das Bekenntnis Theodor Bezas von 1560. Es galt, bis 1567 Bullingers Zweite Helvetische Konfession das gemeinsame Bekenntnis aller ungarischen Reformierten wurde. Bei ihrer Annahme wurde ausdrücklich darauf verwiesen, daß auch die Genfer Pfarrer es unterschrieben hätten. Den Einbruch des Antitrinitarismus in Siebenbürgen hat Calvin nicht mehr erlebt. Aus Polen ausgewiesen, kamen Stancarus und Blandrata ins Land. Blandrata wurde Leibarzt des Fürsten, dessen Mutter gleichfalls Italienerin war. Er wurde von ihm im April 1564 zum Leiter einer Synode bestellt. Die Reformierten legten auf ihr einen Abendmahlstraktat Calvins vor. Daraufhin gewährte der Landtag ihnen freie Religionsausübung. In den antitrinitarischen Streitigkeiten der folgenden Jahre wirkte erschwerend, daß Blandrata das Ohr des Fürsten besaß. Doch vermochten sich die Reformierten besser zu verteidigen als in Polen. Es kam zur Spaltung; die unitarische Kirche besteht noch heute. In Westungarn konnte sich das Reformiertentum nicht in gleichem Maße ausbreiten wie in Ostungarn, weil sich die Protestanten dort an das Augsburger Bekenntnis hielten, das ihnen seit dem Religionsfrieden von 1555 begrenzten Schutz gewährte. Die Lage in den Niederlanden ähnelt derjenigen Ungarns. Das Land war ebenfalls schwerzugängliches Kriegsgebiet, wenn auch in anderem Sinne. Karl V. hatte nämlich im Jahre 1550 in seinen Stammlanden harte Gesetze gegen die Ketzer erlassen.
96
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
Nach seinem Tode wurden sie von seinem Sohn Philipp II. erneuert (1559), die Kirche reorganisiert und die Inquisition gestärkt. Philipp II. war entschlossen, für die katholische Religion alles zu opfern, die Bewohner und die wirtschaftliche Blüte des Landes. Die Folge war, daß die Niederländer in Scharen das Land verließen. Im Jahr 1563 zählte man in und um London allein 1 8 - 2 0 000 Flüchtlinge, die der Wirtschaft ihres Heimatlandes verloren gingen. Flüchtlingsgemeinden bestanden in Emden, Wesel, Aachen, Köln, Frankfurt und anderen Orten. Erwähnt wurde bereits Calvins Eintreten für die Flüchtlinge in England und sein Besuch der Exulantengemeinde in Frankfurt im Jahre 1556. Erst in den fünfziger Jahren gewann er in den Niederlanden Einfluß. Es ist nur ein kurzer Briefwechsel mit Poppius und der französischsprechenden Gemeinde in Antwerpen erhalten geblieben. Menso Poppius, ein überzeugter Calvinist, wirkte im Norden des Landes unter steter Lebensgefahr. Er hatte eine Schrift zur Stärkung der Glaubensbrüder ausgearbeitet und schickte das Manuskript nach Genf. Er bat Calvin um Hilfe beim Druck. Jener erteilte ihm ausführliche Ratschläge für die Gemeindebildung in einer katholischen Umgebung. In Antwerpen bestanden bereits feste Gemeinden. Die Stadt war damals der größte Warenumschlagplatz Europas; eine große Zahl von Ausländern lebte in der Stadt, brachte reformatorische Schriften mit und verhinderte ein scharfes Durchgreifen der Inquisition. Trotzdem wurden zum Beispiel vom Januar 1559 bis April 1560 35 Ketzer in Antwerpen hingerichtet, 30 Täufer, 4 Häretiker und 1 Calvinist. Calvin spricht den Glaubensbrüdern brieflich Mut zu. Während seines Besuches in Frankfurt begegnet er Guy de Bray, der im Süden des Landes wirkte und 1567 den Märtyrertod erlitt. Von ihm stammt die Confessio Belgica (1561), die die calvinische Lehre vertritt. Den Niederländischen Freiheitskrieg, der zur Vorherrschaft des Calvinismus im Lande führte, hat Calvin nicht mehr erlebt. Doch war Philips van
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
97
Marnix, einer der führenden Calvinisten, sein Schüler in Genf gewesen. Calvins Briefwechsel mit England spiegelt die bewegte Geschichte des Landes wider. Er hatte die Kirchenpolitik Heinrich VIII. schnell durchschaut. Die Trennung von Rom sei nur halbe Klugheit, denn die Verbreitung des Wortes Gottes sei untersagt. Der König will „ein verstümmeltes und verdrehtes Evangelium, eine Kirche voll von vielen Possen", schreibt er 1539. Als die Verfolgungen der Protestanten zunahmen, setzte er sich für eine Schweizer Gesandtschaft nach England ein. Der Umschwung erfolgte, als im Jahre 1547 der junge Eduard VI. den Thron bestieg. Dessen Vormund, der Herzog von Somerset, war das Haupt der evangelischen Partei. So schienen alle Voraussetzungen für eine Reformation gegeben zu sein. Calvin griff wieder zu dem Mittel der Widmungsschreiben, um die Entwicklung zu beeinflussen. Dem Herzog dedizierte er 1548 den Kommentar zu den Timotheusbriefen und König Eduard VI. 1550 den Jesajakommentar; dann den Kommentar zu den katholischen Briefen und 1552 vier Predigten über die Standhaftigkeit in der Verfolgung. Die Häufung der Dedikationen zeigt die Bedeutung an, die er den beiden Fürsten beimaß. Über die kirchliche Lage ist er gut unterrichtet. Er äußert, daß die Gefahr ebenso von den Anhängern Roms wie von den Schwärmern drohe. Ein Bekenntnis müsse aufgestellt werden, auf das die Prediger verpflichtet würden. Für die Kinder und das ungebildete Volk sei ein Katechismus nötig. „Die Kirche Gottes kann sich nie halten ohne Katechismus; denn dieser ist gleichsam der Same, der verhindert, daß die gute Saat nicht ausstirbt, sondern sich mehrt von Geschlecht zu Geschlecht." Besonders stark setzte er sich dafür ein, daß die katholischen Mißbräuche abgeschafft wurden. Er wußte, daß einer halben Reformation gerade in England begegnet werden mußte. Gebete für die Verstorbenen, letzte Ölung usw. sollten abgestellt werden. Auf seinen Rat hin und mit Hilfe Martin Bucers und Petrus Martyrs, die mit anderen Theologen nach 7
Neuser, Calvin
98
Die Ausbreitung der Reformation in Europa
dem Interim in England eine neue Wirkungsstätte gefunden hatten, erschien das Common prayer book 1552 in gereinigter Form. Die 42 Artikel aus dem gleichen Jahr enthalten eine calvinisch-bucerische Sakramentslehre. Als 1553 die katholische Maria Königin wurde, mußten Martyr und a Lasco samt den Flüchtlingsgemeinden das Land verlassen. Die führenden evangelischen Geistlichen Englands erlitten den Märtyrertod. Doch 1558 folgte Elisabeth auf dem Thron. Ihr Verhältnis zu Calvin ist bezeichnend für die kirchliche Lage. Der Genfer Reformator hatte ihr gleich nach der Thronbesteigung die zweite Auflage des Jesajakommentars gewidmet, mußte aber eine schroffe Zurückweisung seines Geschenkes erfahren. Als Grund wurde angegeben, die Königin sei verärgert über John Knoxs Buch „Erster Trompetenstoß gegen das ungeheuerliche Weiberregiment", das jener in Genf trotz Calvins Bedenken gegen Maria von Schottland hatte ausgehen lassen. Doch kann die Schrift nicht der einzige Grund gewesen sein. Elisabeth verschloß sich vielmehr dem Drängen Calvins auf Reinigung der Kirche von allen römischen Zeremonien. Sie suchte den Mittelweg zwischen den Parteien und wurde die eigentliche Begründerin der anglikanischen Staatskirche und der ihr eigenen Kultusform. John Knox, der Reformator Schottlands und Schüler Calvins, gleicht in seinem Wesen dem „Feuerkopf" Wilhelm Farel. Nach einem Aufstand zur gewaltsamen Durchführung der Reformation wurde er auf die französischen Galeeren geschickt. Wahrscheinlich durch die Fürsprache Eduard VI. befreit, wirkte er nun in England und trat als Gegner der katholischen Zeremonien (Meßgewänder, Anbetung der Abendmahlselemente usw.) hervor. Nach dem Regierungswechsel im Jahre 1553 wandte er sich nach Genf, vervollständigte dort seine theologischen Kenntnisse und wirkte als Pfarrer der englischen Flüchtlingsgemeinde. Als entschiedener Calvinist kehrte er 1559 nach Schottland zurück, wo inzwischen die Evangelischen ganz in seinem Sinne den Bund (Convenant) zum Schutz des
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
99
Evangeliums geschlossen hatten. Mit der Annahme des Ersten Schottischen Bekenntnisses (Book of Discipline) durch das Parlament im Jahre 1560 hatte die Reformation gesiegt, wenn auch noch harte Kämpfe bevorstanden. Das Bekenntnis ist vornehmlich von Knox erstellt worden; es verrät den Genfer Lehrmeister. Calvin beriet Knox brieflich auch beim Aufbau des evangelischen Kirchenwesens, sah sich aber genötigt, dessen Rigorismus bei der Umstellung der Zeremonien zu tadeln. Schottland ist das einzige Land in Europa, in dem sich der Calvinismus völlig durchgesetzt hat. Durch die Widmung des Kommentars zu den zwölf kleinen Propheten an König Gustav Wasa von Schweden (1559) versuchte Calvin auch zu diesem lutherischen Land Verbindung anzuknüpfen. Es blieb beim Versuch. Es könnte so scheinen, als ob Calvin möglichst überall in Europa in Konkurrenz zum Luthertum hätte treten wollen. Seine positive Stellung zur Confessio Augustana, sein Verhalten den Polen gegenüber und seine immer wieder öffentlich bekundete Verehrung Luthers zeigen, daß ihm die Durchführung der Reformation höher stand als die Durchsetzung partikularer Lehren. Als Erzbischof Cramer 1550 eine allgemeine protestantische Synode vorschlug, antwortete er ihm: „Es gehört zu den Hauptübelständen unserer Zeit, daß die einzelnen Kirchen so auseinandergerissen sind, daß kaum die Zusammengehörigkeit als Menschen unter uns gilt, geschweige denn die heilige Gemeinschaft der Glieder Christi, — Ich persönlich wollte michs nicht verdrießen lassen, wenn man mich brauchte, zehn Meere, wenn es sein muß, zu durchqueren." 11. Das Ringen um die Reformation in Frankreich Die kirchliche Erneuerung seines Vaterlandes hat Calvin mit allen Kräften zu fördern gesucht. Seine Verteidigung der französischen Protestanten im Schreiben an Franz I. (1535) und sein Betreiben eines Bündnisses zwischen Frankreich und dem 7*
100
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
Schmalkaldischen Bund (1541) wurden bereits erwähnt. Nach Genf zurückgekehrt, hat er die französische Politik weiterhin zu beeinflussen versucht. Er verfolgte damit immer nur das eine Ziel: Durchsetzung der Reformation in Frankreich und Erleichterung für die verfolgten Glaubensbrüder. Calvin scheute sich nicht, der Reformation mit politischen Mitteln den Weg zu ebnen. Es war ein gefährliches Spiel, denn die Politik konnte sich unversehens auch zum Nachteil der Reformation auswirken. In Frankreich haben die Ereignisse diesen Verlauf genommen. Doch war Calvin an der „Politisierung des französischen Protestantismus" (R. Nürnberger), wie sich zeigen wird, nicht schuld. In Frankreich bestand ein erbliches Königtum, das mit Erfolg die Rechte des Adels einschränkte und die zentrale Macht des Pariser Hofes zu festigen suchte. Angesichts des Absolutismus der französischen Krone konnte Frankreich nur ganz oder gar nicht für die Reformation gewonnen werden. Eine Zwischenlösung gab es nicht - sie bestand übrigens auch in den einzelnen deutschen Fürstentümern nicht. Ein Eingreifen Calvins in die französische Politik schien unvermeidlich zu werden. Dem humanistischen Denken verhaftet, hatte Franz I. (1515-1547) lange Zeit geschwankt, wie er sich zur evangelischen Bewegung stellen sollte. Gegen Ende seines Lebens wurde jedoch deutlich, daß der römische Katholizismus die Staatsreligion bleiben sollte. Der Vorstoß zur Ausrottung der französischen Waldenser im Jahre 1545 zeigte die wahre Meinung des Pariser Hofes. 22 Waldenserdörfer gingen in Flammen auf, über 3000 Menschen kamen um, viele wurden auf die Galeeren geschickt. Calvin sandte sogleich einige zuverlässige Männer zu den Verfolgten, die von den grauenhaften Ereignissen berichteten. Er selbst schrieb an die evangelischen Schweizerkantone, reiste nach Bern und zu den nachfolgenden Beratungen nach Aarau. Zuvor sorgte er für die Aufnahme der Flüchtlinge in Genf. Doch er mußte erleben, daß die französischen „Pensionäre" wirkungsvolle Schritte verhinderten. Es
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
101
wurde lediglich ein Protestschreiben nach Paris gesandt, das nur wenig Erfolg brachte. Sein Nachfolger Heinrich II. (1547-1559) schuf die berüchtigte sogenannte chambre ardente, die zwischen 1547 und 1550 über 500 Urteile fällte „gegen die ketzerischen Gotteslästerungen und Ruhe- und Friedensstörer in diesem allerchristlichsten Königreich". Die Begründung macht deutlich, daß Staatsordnung und Kirchenlehre nicht getrennt wurden. Ketzer sind zugleich Aufrührer. Der König folgte bei der wiederholten Verschärfung der Ketzergesetze keineswegs nur dem Drängen der Kirchenführer. Die Erhaltung der kirchlichen Autorität sollte vornehmlich der Stärkung seines monarchischen Absolutismus dienen. Er verstand sich nicht nur als Schutzherr der Kirche, vielmehr wollte er auch ihr Beherrscher sein. Die Vertreter der Kirche protestierten gegen die Ketzerverurteilungen vor staatlichen Gerichten, so daß der König geistliche Richter beiziehen mußte. Nur Ketzer, die man nicht des Aufruhrs anklagte, kamen vor geistliche Gerichte - die Unterscheidung konnte nur willkürlich sein. Es verbitterte die Evangelischen, daß es für sie keine Berufung an höheren Gerichten gab. Der Besitz der flüchtigen Ketzer wurde eingezogen, die Verbreitung evangelischer Schriften besonders hart gestraft, Denunziation mit Freispruch belohnt. Trotzdem breitete sich der Calvinismus während der Regierungszeit Heinrich II. unaufhaltsam aus. Auf diesem Hintergrund muß Calvins Eingreifen in Frankreich gesehen werden. Unermüdlich sprach er in seinen Briefen den Verfolgten Mut und Trost zu. Es gehörte aber auch zur Eigenart der calvinischen Frömmigkeit und entsprach der politischen Lage, daß der Genfer Reformator beständig zum offenen Bekenntnis anspornte. Er wußte genau, daß Leiden und Martyrium die Verfolgten erwartete. Doch stand Calvin der Fortschritt des Reiches Gottes höher als das Geschick des einzelnen Christen. Immer wieder wies er auf die Pflicht hin, zur Ehre Gottes zu leben, und erinnerte an die Gewißheit, nach dem Tode ins ewige Leben einzugehen. Die Erwählungsgewiß-
102
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
heit der Calvinisten war Quelle ihrer Aktivität und Leidensbereitschaft. D e r gleiche Calvin zeigte in seinen Briefen aber auch ein Herz voller Mitgefühl und Verständnis für die persönliche Lage. M a n lese nur einmal seine Briefe an die fünf zum T o d e verurteilten Studenten von Lyon. Er geht auf ihre Ängste ein, versichert sie der Fürbitte der Gemeinde und mahnt sie, sich der Führung Gottes anzuvertrauen. Zugleich gibt er ihnen Ratschläge für ihre Verteidigung vor den Richtern. Alles setzte er daran, um mit den Gefangenen in Verbindung zu treten. Ein Katholik bezeugt: „Es ist wunderbar, wie seine Boten aller Wachsamkeit und Aufmerksamkeit zum T r o t z in unsere Gefängnisse drangen, die mit armen Verführten angefüllt waren, und wie es ihm gelang, unaufhörlich durch seine Briefe zu ermahnen und zu trösten, zu befestigen, auch die zaghaften Gemüter dahin zu bringen, daß sie dem schmerzlichen T o d mit Freuden entgegengingen." Doch propagierte er kein Heldentum. W e m die Kraft fehlte, zumeist waren es Frauen, bot er Zuflucht in Genf an. Er war niedergeschlagen, wenn die Kunde von erneuten Verbrennungen eintraf. Als die Nachricht von der Verhaftung der fünf Studenten von Lyon anlangte, bot er alles auf, um ihr Leben zu retten. Im J a h r e 1 5 5 2 reiste er nach Bern, damit die evangelischen Kantone in Paris vorstellig würden. Dreimal schickte er in den Jahren 1 5 5 7 und 1 5 5 9 T h e o d o r Beza nach Deutschland, um die evangelischen Fürsten zum Eingreifen zu bewegen. Die zweite Reise erfolgte wegen der Gefangennahme von über 1 4 0 Gemeindegliedern bei einem Gottesdienst in Paris. Wenn der Erfolg der Proteste auch gering war, der französische H o f vermied es, den Unwillen der östlichen Nachbarn allzusehr zu erregen, weil man sie vielleicht noch als Verbündete gegen den Habsburger Erbfeind benötigte. Das Drängen auf öffentliches Bekennen brachte Calvin notwendig in Konflikt mit der humanistischen Mittelpartei. Diese Kreise der Gebildeten hatten sich von der römischen Kirchenlehre getrennt und sympathisierten mit dem Gedanken eines
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
103
schlichten, biblischen Christentums, ohne Anschluß an die Reformation. Angesichts der blutigen Verfolgungen mußte ihre Kompromißbereitschaft die große Versuchung des französischen Protestantismus werden und eine Gefahr für die Reformation. Ein Fernbleiben vom katholischen Gottesdienst war kaum möglich. Eins der neuen Ketzergesetze verlangte, daß an den Festtagen jeder mit seiner Familie an der Messe teilzunehmen habe. Es bürgerte sich ein, zwar an den geforderten Frömmigkeitsübungen teilzunehmen, jedoch mit innerem Vorbehalt. In zahlreichen Briefen beantwortete Calvin Anfragen dieser Art. Er verfaßte auch Schriften. „Kleine Abhandlung, die zeigt, was ein Gläubiger Mann machen muß, wenn er die Wahrheit des Evangeliums kennt und sich unter Papisten befindet" (1543) und „Die ,Entschuldigung' von Johann Calvin an die Herren Nikodemiten, veranlaßt durch deren Klage über seine zu große Strenge" (1544). Er rechtfertigt seinen Rigorismus aus der Heiligen Schrift: Wenn jemand die Messe singt, die er sonst für eine „abscheuliche Gotteslästerung" hält, so „teilt er zwischen Gott und dem Teufel", dann gibt er die Seele dem einen und den Leib dem anderen. Einen Kompromiß gebe es daher nicht. In der Einleitung wurde bereits auf seinen Kampf gegen den Libertinismus der französischen Humanisten in der Schrift „De scandalis" (1550) hingewiesen. In ihr setzte er sich auch mit der Gruppe der unentschlossenen, leidenscheuen Humanisten auseinander. Trotz der Verfolgungen baute Calvin die Hugenottenkirche planmäßig auf. Immer wieder mahnte er in seinen Briefen, die Gemeindebildung nicht zu überstürzen. Wenn in einer Gegend Erweckte seien, sollten sie regelmäßige Zusammenkünfte einrichten, um gemeinsam Gott zu loben, sich gegenseitig in der Erkenntnis zu fördern und sich zu ermahnen. Die Sakramente sollten sie erst gebrauchen, wenn sie reif seien, eine Gemeinde zu bilden. Denn die Sakramente seien das Kennzeichen einer Gemeinde. Dazu bedürfe es eines ordentlich berufenen Predigers und Ältester, die auf die Kirchenzucht achteten. Calvin
104
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
versuchte mit diesen Anweisungen einem Wildwuchs der Gemeinden zu begegnen und ihnen Festigkeit in den Verfolgungen zu geben. Der Institution der römischen Kirche stellte er eine festgefügte Gemeindeorganisation entgegen. Bald wird er mit Bitten um Prediger bestürmt. In den Jahren 1562 bis 1564 gelangen 72 Schreiben dieser Art an die Venerable Compagnie. „Es ist unglaublich", schreibt ein Genfer Pfarrer an Farel, „wie sehr sich alle diese Bedürfnisse und Anliegen hier häufen. Von allen Seiten bittet uns das arme Volk um Speise, und niemand ist da, der das himmlische Brot ihnen austeilt. Allein im Tournon und Agennois sind mehr als 300 Gemeinden, die der Messe entsagen, ohne Prediger. Die Abgesandten unserer französischen Brüder versichern uns, daß, wenn heute 4000 bis 6000 Geistliche zu haben wären, sie auf der Stelle ihre Anstellung finden würden." Calvin mußte der Pariser Gemeinde mitteilen, sie könnten keine Prediger schikken, in Genf seien bereits zu wenige. Die Genfer Akademie wird nun zur Pflanzstätte des französischen Protestantismus. „Schickt uns Holz", schreibt Calvin an die Gemeinde zu La Rochell, „damit wir Pfeile daraus machen und sie euch zurückschicken." Im Jahre 1555 entstehen die ersten Gemeinden, vier Jahre später tritt in Paris die erste Generalsynode zusammen. Calvin sandte einen Entwurf zu einem Bekenntnis, aus dem die berühmte Confessio Gallicana wurde. Die von der Synode ausgearbeitete Kirchenordnung übernimmt Calvins Ämterlehre und legt die Rechte der Synode fest. Die calvinische presbyterialsynodale Ordnung entstand. Die Hugenottische Kirchenordnung (Discipline ecclesiastique) wurde das Vorbild der nachfolgenden reformierten Kirchenordnungen. Mit dem Erstarken des französischen Protestantismus erhob sich drohend die Gefahr des Radikalismus in den eigenen Reihen, der zur Gewaltanwendung trieb. Der Vorwurf, Aufruhr zu betreiben, schien sich zu bewahrheiten. Calvin hat in dieser Zeit unermüdlich zum offenen Bekenntnis des Glaubens
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
105
gemahnt, aber zugleich die Pflicht zum Ausharren im Vertrauen auf Gott und zum geduldigen Leiden eingeprägt. Die einzige politische Aktion, die er für erlaubt hielt, war die Fürsprache der Schweizer und Deutschen Regierungen in Paris. Würden seine Mahnungen aber auf die Dauer Gehör finden? Mußten ihm nicht angesichts der ständigen Hinrichtungen die Zügel entgleiten? Aus der Pariser Gemeinde wurde 1557 gemeldet, es mehrten sich die Stimmen, die dem Terror der Obrigkeit mit Gewalt entgegentreten wollten. Calvin schrieb sofort im Namen der Genfer Pfarrer zurück, man möge doch ja alles der Führung Gottes überlassen und allen Aufruhr vermeiden. „Es wäre wahrlich besser, daß wir alle zugrunde gingen, als daß das Evangelium dem Vorwurf ausgesetzt würde, daß es die Menschen zum Aufruhr und Aufstand ausrüste." Noch einmal konnte die offene Empörung vermieden werden. Doch wie lange noch? In den Maitagen des Jahres 1558 kam es in Paris auf den Pfaffenwiesen zu einem großen Psalmensingen, an dem 4000 bis 6000 Menschen teilnahmen, unter ihnen auch viele Adelige. Die Gegner verdächtigten die Protestanten gleich des Aufruhrs. In dieser Zeit wandte sich Calvin zum ersten Mal an den französischen Hochadel. Calvin schrieb an König Anton von Navarra, der durch seine Heirat mit Jeanne d'Albret zur königlichen Familie gehörte und durch seine Frau den Evangelischen nahe stand. Calvin beschwor ihn, sich auf der bevorstehenden Notabelnversammlung für die Beendigung der Verfolgungen einzusetzen. Doch war jener nur dazu bereit, den Evangelischen Schutz in seinem Lande zu gewähren. Sein Bruder Francois d'Andelot, Prinz Conde, hatte als Gouverneur der Bretagne die evangelischen Prediger beschützt und hielt in seinem eigenen Haus Gottesdienste ab. Vom König zur Rede gestellt, hatte er den Mut, die Messe eine Menschenerfindung zu nennen. Der König ließ ihn daraufhin verhaften. Calvin hat ihm einen Trostbrief ins Gefängnis geschickt. Als er auf Bitten seiner Familie einer Messe beiwohnte, ohne jedoch selbst zu wider-
106
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
rufen, redete ihm Calvin ernstlich ins Gewissen. Z u r gleichen Zeit gewann der französische Protestantismus einen Führer in Admiral Coligny. Auch ihm sandte Calvin einen Brief in die Gefangenschaft, in die er im Kampf gegen Spanien geraten war. Er hatte dort M u ß e , sogar die Institutio zu lesen. Die Reformation fand damals besonders unter den Adeligen viele Anhänger. Sie waren durch ihre Stellung in der Lage, ihren Glaubensgenossen Schutz zu bieten. Selbst am Parlament, dem höchsten Gericht in Paris, weigerten sich Richter, die grausamen Verfolgungen zu unterstützen. Anne du Bourg kostete diese Weigerung 1559 das Leben. D a starb im gleichen J a h r unvermutet Heinrich II. Ihm folgte sein noch unmündiger Sohn Franz II. auf den T h r o n . Sofort rissen die Guisen die Regentschaft an sich, der Kardinal die Staatsverwaltung, der Herzog das militärische Oberkommando. Dagegen protestierten die Brüder Bourbon, Anton von Navarra und Prinz Conde: Ihnen stehe als Prinzen von Geblüt die Regentschaft zu. Calvin erfaßte sogleich die Möglichkeiten, das Geschick der französischen Kirche grundlegend zu ändern. Abgesandte der Hugenotten bestürmten Anton von Navarra, die Regierung zu übernehmen. Er könne sich - der Plan stammte von Calvin - auf die französischen Stände und die deutschen evangelischen Fürsten stützen. Jener sagte zwar zögernd zu, unternahm aber nichts. Die Protestanten waren über sein Zaudern enttäuscht. Schon meldeten sich Radikale, die die unerträglichen Verfolgungen durch Tyrannenmord zu beendigen gedachten. In der Institutio widerspricht Calvin scharf dieser Idee: Unter dem Tyrannen muß der Privatmann leiden und im Gebet Gott um Hilfe anflehen (II, 2 , 2 4 ; III, 10,6; IV, 20,31). Gleich den übrigen Reformatoren hielt er daran fest, daß eine geistliche Bewegung nur mit geistlichen Mitteln voranschreiten könne. Die Ständeversammlung und die Prinzen von Geblüt hätten seiner Meinung nach jedoch nicht nur ein Widerstandsrecht, sondern sogar Widerstandspflicht (Inst. IV, 20,31). Es kam
Das Ringen um die Reformation in Frankreich
107
trotzdem zur Verschwörung von Amboise gegen die Guisen (1560). Calvin war vorher um R a t gefragt worden, konnte aber seinen Grundsätzen getreu nur widerraten. Er hoffte immer noch, daß Anton von Navarra sich aufraffen würde, seine Rechte durchzusetzen. N u r so schien Duldung zu erreichen zu sein und Frankreich auf legitimem Wege für die Reformation gewonnen werden zu können. Als 1 5 6 0 der ebenfalls minderjährige Karl I X . auf dem französischen T h r o n folgte, blieb Navarra jedoch erneut passiv; er überließ die Regentschaft der Königinmutter. Es begann die Zeit der Katharina von Medici und ihrer schwankenden Religionspolitik. Die Hugenotten errangen erste Erleichterungen für ihre Religionsausübung, der alte Gegensatz blieb aber bestehen. Damals begannen die Hugenotten zu einer politischen Partei zu werden, die neben den religiösen nationale Ziele verfolgte; viele unter ihnen wollten die Reformation durchsetzen und der Innen- und Außenpolitik der Guise entgegentreten. Die Politisierung des französischen Calvinismus setzte ein. Am Ende mußte die Austragung der Gegensätze durch Waffengewalt stehen. Als sich im Religionsgespräch von Poissy 1 5 6 1 und im Duldungsedikt von St. Germain 1 5 6 2 ein Ausgleich anbahnte, richteten die Guisen 1 5 6 2 das bewußt provokatorische Blutbad von Vassy unter den Hugenotten an. Der erste Hugenottenkrieg ( 1 5 6 2 - 1 5 6 3 ) war die Folge. Calvin stand in dieser Zeit im Briefwechsel mit den politischen und kirchlichen Führern der Hugenotten. Die Politisierung hat er nicht verhindern können. M i t dem Zaudern Antons von Navarra ist Calvins Politik gescheitert. Er stand aber auch nun nicht abseits, sondern half nach Kräften. Im Danielkommentar, den er am 18. August 1561 mit einem Widmungsschreiben „An alle frommen Verehrer Gottes, die danach begehren, daß Christi Reich in Frankreich recht aufgerichtet werde" findet er äußerst scharfe W o r t e gegen die Tyrannen, die die Kirche unterdrücken. Aber auch jetzt sagt er nicht, daß ihnen der Gehorsam zu verweigern sei.
108
Der Schriftsteller und Theologe 12. Der Schriftsteller und Theologe
Da die Hugenottenkirche ständig wuchs, wurde Calvins Vorhaben, das Genfer Gymnasium zur Akademie auszubauen, immer dringender. Es fehlte eine französischsprachige Hochschule, an der evangelische Theologen ausgebildet werden konnten. Im Jahre 1558 erlaubte der Genfer Rat Calvin trotz der schwierigen Finanzlage, die ersten Professoren zu berufen. Es traf sich günstig, daß Theodor Beza und Piere Viret Lausanne verließen. Die aussichtslosen Verhandlungen um die Einführung einer Kirchenzucht im Berner Waadtland veranlaßte ihre Ubersiedlung nach Genf. Beza wurde zum Rektor der Akademie bestimmt. Calvins Plan, die Gelder durch eine Haussammlung aufzubringen, wurde ein voller Erfolg; 10 000 Goldgulden wurden gespendet. Das Gebäude, das errichtet wurde, konnte bereits am 5. Juni 1559 eingeweiht werden. Die „Gesetze" der Akademie wurden von Calvin verfaßt. Ein gewaltiger Zustrom ausländischer Studenten setzte ein. Einige berühmte Namen sind bereits genannt worden: Marnix van St. Aldegonde, Caspar Olevian und John Knox, der begeistert ausrief: „Seit der Apostel Zeiten hat es keine Stätte auf Erden gegeben, wo das Evangelium in solcher Kraft und Reinheit gelehrt wird." Calvin setzte seine Bibelauslegung an der Akademie fort. Er legte nun das Buch Daniel aus, dann bis zum Januar 1563 Jeremia und die Klagelieder und endlich Hesekiel. Er kam nur bis zum 21. Kapitel, dann mußte er die Vorlesung aus Gesundheitsgründen abbrechen. Doch schrieb er vor seinem Tod noch den Kommentar zum Buch Josua. Beza hat dem Werk eine Lebensbeschreibung beigegeben, die noch im Todesjahr Calvins gedruckt wurde. Im Vorwort des Kommentars zu den Kleinen Propheten (1559) beschreibt der Drucker, wie die Vorlesungen schriftlich festgehalten wurden. Calvin begann mit Gebet und redete dann frei, ohne Konzept. Zwei Sekretäre
Der Schriftsteller und Theologe
109
schrieben seine Ausführungen mit, verglichen hinterher den Wortlaut und ließen eine Reinschrift anfertigen. Am nächsten Tag wurde Calvin die Nachschrift zur Korrektur vorgelegt. Calvin hat die meisten biblischen Bücher kommentiert, vom Alten Testament fehlen nur die Schriften von den Samuelbüchern an bis Nehemia und die salomonischen Werke, vom Neuen Testament die Offenbarung des Johannes. Alle Kommentare sind bald nach der Fertigstellung im Druck erschienen. In seinen Predigten hat Calvin auch einen großen Teil der fehlenden Geschichtsbücher des Alten Testamentes ausgelegt, dazu fast die ganze übrige Bibel. Nur die Offenbarung des Johannes fehlt wiederum. Er hatte eine kaum tragbare Predigtverpflichtung übernommen: Normalerweise predigte er sonntags zweimal, werktags in jeder zweiten Woche täglich einmal. Dabei stellte seine Predigttätigkeit nur einen kleinen Teil seiner Arbeit dar. Seit 1549 hatte der Rat einen französischen Flüchtling beauftragt, die Predigten regelmäßig mitzuschreiben. Auf diese Weise sind über 2400 Predigten Calvins aufgezeichnet worden. Davon erschienen ca. 700 vor und nach seinem Tod im Druck; sie sind im Corpus Reformatorum wieder abgedruckt worden. Die originalen Predigtnachschriften sind leider zum großen Teil verlorengegangen. Bis zum Jahre 1805/6 befanden sie sich in 48 Bänden in der Genfer Bibliothek. In unverantwortlichem Leichtsinn sind damals 47 Bände von der Bibliothek verkauft worden, zum Teil sind sie beim Altpapierhändler gelandet. Nach und nach sind von ihnen wieder 14 aufgetaucht, kürzlich noch ein Band mit 85 Genesispredigten in der Bodleian Library in Oxford. Die vorhandenen Bände enthalten noch etwa 700 ungedruckte Predigten, die jetzt in den Supplementa Calviniana ediert werden. Calvins gedruckte Schriften umfassen weit über 100 Titel. Die wichtigsten sind oben beschrieben worden. Doch wäre noch manches Buch wert, genannt zu werden: Seine Schrift gegen die Astrologie (1549), die Auseinandersetzung mit den katholischen Vermittlungstheologen Balduinus und Cassander
110
Der Schriftsteller und Theologe
(1561 und 1562) usw. Im Corpus Reformatorum steht die staatliche Zahl von 4271 Calvinbriefen. Unsere Lebensbeschreibung gab bereits wiederholt Anlaß, auf Calvins Lehre einzugehen. Seine Betonung der Ehre Gottes, sein Verständnis des göttlichen Gesetzes vornehmlich als Anleitung zur Heiligung (tertius usus legis), die Lehre von der Kirchenzucht, die Vier-Ämter-Lehre, das Verhältnis von Kirche und Staat und das Problem der Theokratie wurden erwähnt und erläutert. Sie veranlaßten, Calvin einen Theologen der Heiligung zu nennen. Es ist hier nicht der Ort, die Grundzüge seiner Theologie darzulegen. Doch soll auf die Lehren noch eingegangen werden, durch die Calvin in Streitigkeiten verwickelt worden ist. Es sind die Lehre von der Heiligen Schrift, von der Trinität, von der Prädestination und vom Sakrament. In ihnen und natürlich in der Lehre von der Heiligung zeigt sich die Eigenart seiner Theologie. Calvin mußte sein Verständnis der Heiligen Schrift zuerst im Streit mit Caroli verteidigen. Damals weigerte er sich, die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, insbesondere das sogenannte Athanasianum zu unterzeichnen. Er wollte ihnen auf keinen Fall die Autorität zuerkennen, die die Bibel besitzt. Einer Gleichrangigkeit der kirchlichen Tradition mit der Heiligen Schrift wollte er im Ansatz wehren. In der Frühzeit der Reformation konnten die römischen Bräuche und Zeremonien nur durch entschiedenes Festhalten an der Schriftautorität abgewehrt werden. Nicht zufällig verteidigte Caroli damals auch die Gebete für die Toten. Die Auseinandersetzung mit der katholischen Theologie veranlaßte Calvin auch, den Umfang des biblischen Kanons festzustellen. In der Hugenottischen Kirchenordnung von 1559, die er entworfen hat, sind die biblischen Bücher einzeln aufgezählt. Andere reformierte Bekenntnisse sind ihr darin gefolgt. Man wird dieses Vorgehen jedoch nicht als Erstarrung der Theologie und als Beginn der protestantischen Orthodoxie verstehen dürfen. Die Reformation vertrat eine andere Ansicht über den
Der Schriftsteller und Theologe
111
Umfang des biblischen Kanons als die katholische Theologie. Sie greift auf den jüdischen Kanon zurück, der die Apokryphen des Alten Testaments nicht enthält. Das Konzil von Trient bestätigt dagegen am 8. April 1546 den hellenistischen Kanon und verbietet ausdrücklich, die Apokryphen von den übrigen biblischen Büchern zu trennen. Calvin geht in der Schrift „Acta Synodi Tridentinae cum antidoto" (1547) auf diese Entscheidung ein und weist darauf hin, daß im 2. Makkabäerbuch das Fegefeuer, im Buch Tobias die Genugtuung des Menschen und der Exorzismus gelehrt würden (usw.). Der Umfang des Kanons konnte daher wohl Gegenstand des Bekenntnisses werden. Der Vorwurf des Biblizismus, das heißt eines gesetzlichen Bibelgebrauches, vermag Calvin nicht zu treffen. Der Genfer Reformator lehrte wie Luther den Unterschied von Bibel und Evangelium, wenn er auch dessen Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium nicht anerkannte. Die Verkündigung des Zorns und der Gnade Gottes, die Verheißung oder Zusage der göttlichen Barmherzigkeit ist, ist für ihn Mittelpunkt der Bibel. Wie wenig er Biblizist war, zeigt, daß er die Synoden nicht mit dem Apostelkonzil (Apg. 15) begründet und bei der VierÄmter-Lehre nicht sklavisch der Aufzählung der Charismen (Rom. 12, 1. Kor. 12) folgt. Vernunfts- und Erfahrungsgründe läßt er wohl gelten. Auch hat er ein Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, wie erwähnt, nicht ausgelegt und also offensichtlich nicht sehr geschätzt. Calvin verteidigt die traditionelle Trinitätslehre. Wenn er Caroli gegenüber sich weigerte, die Begriffe „Trinität" und göttliche „Person" zu gebrauchen, so nur aus grundsätzlichen Erwägungen, denn in der Institutio 1536 (nicht aber im Genfer Katechismus 1537) hatte er sie gerade erst verwendet. Caroli war kein ernstzunehmender Ankläger. Und doch ist Calvins Verständnis der göttlichen Personen nicht unproblematisch. Dazu muß man sich vergegenwärtigen, daß die Dreieinigkeit eine Paradoxie ist, die der menschliche Verstand nur schwer festzuhalten vermag. Die Theologen neigen immer dazu, ent-
112
Der Schriftsteller und Theologe
weder die Einheit Gottes oder die drei Personen in Gott mehr zu betonen. Calvin unterstreicht stärker die Einheit, Luther die Dreiheit. Diese verschiedene Akzentsetzung bestimmt ihre Theologie. Luther wird darum mehr das Menschwerden Gottes in Christus hervorheben, Calvin das Gottsein des Menschgewordenen; Luthers Anliegen wird das Herabsteigen Gottes zur Erde sein, Calvin die Hoheit und Majestät Christi. Mit Recht ist erklärt worden, Calvins Trinitätslehre habe einen „modalisierenden Schein" (E. Wolf). Er kann nämlich die drei göttlichen Personen „Eigenschaften" (proprietates) oder „Seinsweisen" (subsistentiae) des Wesens Gottes (essentia) nennen (Institutio I, 13,6). War aber auf diese Weise die Eigenständigkeit der Personen noch festzuhalten? Diese Lehrweise brachte Calvin in die Nähe Servets, mochte der Abstand zu dessen Pantheismus auch ganz unverkennbar sein. Jenem waren die drei Personen nur Ausstrahlungen (Emanationen) der Gottheit. Calvin hat in Servet die Leugnung der kirchlichen Trinitätslehre bekämpft, aber auch die Perversion seiner eigenen Lehre. Die Forscher sind sich heute einig, daß die Prädestinationslehre nicht die Zentrallehre Calvins ist; es gibt keine Zentrallehre im System Calvins. Die Stellung der Prädestinationslehre in der Institutio 1559 gibt Aufschluß über ihren Rang. Sie wird im dritten Buch behandelt, das die Überschrift trägt „Auf welche Weise wir der Gnade Christi teilhaftig werden" (usw.). Das Buch beginnt mit der Lehre vom Heiligen Geist (Kapitel 1) und nennt als dessen Wirkungen Glaube (2), Buße (3-5), christliches Leben (6-10), Rechtfertigung (11-18), christliche Freiheit (19), Gebet (20) und Erwählung (21-24). Bei Zwingli gehört die Prädestinationslehre hingegen an den Anfang, in die Gotteslehre, und ist Teil der Allkausalität Gottes. Calvin denkt die Prädestination anders als Zwingli. Auch bei ihm erfolgt Gottes Ratschluß „vor Grundlegung der Welt" (Eph. 1,4) und es ist eine Entscheidung über ewiges Leben oder ewige Verdammnis jedes einzelnen Menschen (vgl. Rom. 9, 1 ff.). Doch versucht Calvin dem Systemzwang zu entgehen
Der Schriftsteller und Theologe
113
und nur das biblische Zeugnis wiederzugeben. Gott ist nicht Ursache der Sünde, der Mensch ist allein schuldig. Auch sind Vorherbestimmung zum ewigen Leben und zur Verdammnis nicht gleichwertig; die Verwerfung (reprobado) ist nur eine Grenzaussage, die unbetont bleibt (P. Jacobs). Neben dem Partikularismus des Heils versucht Calvin nach Kräften den Heilsuniversalismus der Offenbarung Gottes in Christus hervorzuheben. Er betont, daß der Ratschluß Gottes verborgen, das Heil in Christus jedoch den Menschen offenbar ist. Es zeigt die Größe Calvins, daß er die Spannungen und Widersprüche in seiner Prädestinationslehre nicht auf Kosten anderer Lehren beseitigt, wie es nach ihm Theodor Beza tat, dessen Prädestinationslehre rein logisch aufgebaut ist und daher zur Zentrallehre wird. Calvin vertritt in seiner Prädestinationslehre ein doppeltes Anliegen. Erstens will er allem Mitwirken des Menschen am Heil (Synergismus) wehren. Der seligmachende Glaube ist ganz und gar Geschenk Gottes. Calvin schützt so die Rechtfertigungslehre vor Mißdeutungen. Immer wieder wendet er sich heftig gegen den Gedanken, Gott erwähle und verwerfe vor Grundlegung der Welt auf Grund seines Vorherwissens (Präscienz), wie die Menschen sich einmal entscheiden würden. Sein zweites Anliegen ist die Heilsgewißheit der Glaubenden. Da der Erwählte seit Anbeginn der Welt von Gott zur ewigen Seligkeit bestimmt ist, steht sein Heil unerschütterlich fest. Er kann gewiß sein, auch künftig im Glauben zu beharren (Perseveranz). Für erwählt aber soll sich jeder Glaubende halten, obgleich es auch Heuchler und Abtrünnige gibt. Diese Erwählungsgewißheit ließ viele Hugenotten das Martyrium ertragen; sie gab den englischen Puritanern zur Zeit Cromwells ihr Siegesbewußtsein. Richtig gestellt werden muß: Weder im europäischen noch im nordamerikanischen Calvinismus hat sich indessen die Erwählungsgewißheit auf den wirtschaftlichen Erfolg gegründet, mag jener auch eine Folge der calvinistischen 8
Neuser, C a l v i n
114
Der Schriftsteller und Theologe
Kirchenzucht und der „innerweltlichen Askese" (Max Weber) sein. Wie kein anderer Reformator beruft sich Calvin in der Sakramentslehre auf den Kirchenvater Augustin. Er übernimmt dessen Unterscheidung von Zeichen (signum) und Sache (res), das heißt, von sichtbarer und unsichtbarer Gabe des Sakraments. Brot und Wein bzw. das Taufwasser weisen auf die eigentliche Gabe hin, die die Seele empfängt. Mit der Unterscheidung von Zeichen und Gabe verbindet sich diejenige von Leib und Seele. Wie Zwingli lehrt Calvin ein geistig-geistliches Verständnis der Abendmahlslehre, sie ist Gabe allein für den Glaubenden. Dieser Zug seiner Sakramentslehre wird unterstrichen durch den Vorrang, den das Wort auch im Sakrament hat. Da Gott durch den Heiligen Geist und das Verkündigungswort seine Gnade gibt, ist das Sakrament immer „Anhang des Wortes" (appendix verbi). Jedes dingliche Verständnis der Gnadengabe ist daher abgewehrt. Das Sakrament wirkt nur bei den Glaubenden. Und doch geht Calvin in der Abendmahlslehre über Zwingli hinaus. In der Abendmahlschristologie stimmt er zunächst noch mit dem Züricher Reformator überein. Der Leib Christi ist jetzt an einem Ort im Himmel und also räumlich vom Abendmahl und den Glaubenden getrennt. Kronzeuge ist wieder Augustin; die Ubiquitätslehre Luthers wird entschieden abgelehnt. Es muß angemerkt werden, daß das sogenannte Extra Calvinisticum - dieser Begriff kommt zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf - zu Unrecht seinen Namen trägt. Vor Calvin haben Zwingli und Bucer diese Lehre (der göttliche Logos in Christus ist personal gedacht und kann daher auch „außerhalb" (extra) der Menschheit Christi sein, das heißt, die Gottheit Christi ist im Abendmahl gegenwärtig) schon vertreten. Sie hat ihre Wurzel in der Alten Kirche. Die Gegenwart Christi im Abendmahl versteht Calvin trotzdem anders als Zwingli. Er lehrt eine pneumatische Präsenz. Der Heilige Geist (Pneuma) verbindet die Glaubenden mit Christus im Abendmahl und macht ihn
Der Schriftsteller und Theologe
115
ihnen gegenwärtig. Die Glaubenden erheben ihre Herzen zum Herrn (sursum corda), sie erhalten im Glauben Gemeinschaft mit Christus. Ihr Glaube wird dadurch gestärkt und gemehrt, das heißt, sie werden im Abendmahl nicht etwa nur dessen vergewissert, was sie schon haben. Den Genesiolutheranem haben diese Aussagen nicht genügt. Der Trost des Abendmahls, meinten sie, damit Luthers Anliegen aufnehmend, werde nur erfahren, wenn für den Abendmahlsempfang kein Glaube gefordert werde. Auch vermißten sie die Gegenwart Christi in Brot und Wein. Sie haben nicht anerkannt, daß Calvin ihnen näher stand als Zwingli. Calvins größtes Werk ist die Institutio Religionis Christianae, durch die er 1536 berühmt wurde und die er 1559 abschloß. In ihr beweist er seine von keinem anderen Reformator erreichte systematische Meisterschaft. Das Werk hat die Theologie weit über das Reformiertentum hinaus beeinflußt. Die Genfer waren sich in seinen letzten Lebensjahren wohl bewußt, welch berühmter Theologe in ihren Mauern lebte. Calvin aber blieb der schlichte, demütige Mensch, der er Zeit seines Lebens war und der nur dann fordernd vor die Öffentlichkeit trat, wenn es die Sache seines Herrn verlangte. Die Abschiedsrede des Sterbenden am 28. April 1564 vor den Pfarrern Genfs läßt nochmals sein Wesen erkennen. Er beschreibt bei dieser Gelegenheit sein Werk in Genf. Es ist eine stolze Bilanz, die er ziehen kann, und doch erklärt er: „Aber, was ich getan habe ist nichts wert. Die Böswilligen werden dies Wort unfehlbar aufgreifen, aber ich sage nochmals, daß alles, was ich getan habe, nichts wert war, und daß ich ein elendes Geschöpf bin. . . . Und ich bitte auch, daß das Böse mir vergeben sei; wenn aber etwas gut gewesen ist, daß ihr euch danach richtet und es befolgt." Am 27. Mai 1564 ist Calvin, 55 Jahre alt, gestorben. Er wurde nach seinem Wunsch ganz schlicht begraben. Als wenige Monate später fremde Studenten nach seinem Grab fragten, konnte man es ihnen schon nicht mehr bezeichnen. 8*
Literaturverzeichnis 1.
Bibliographie
Erichson Alfred: Bibliographia Calviniana, Berlin 1900. Nachdruck Nieuwkoop 1960 ( = Corpus Reformatorum Bd. 87, S. 517-586). Niesei, Wilhelm: Calvin-Bibliographie 1901-1959. München 1961. 2. Werke im
Originaltext
Die Werke liegen in einer wissenschaftlichen Gesamtausgabe vor, die jetzt durch die vollständige Edition der Predigten Calvins, wie erwähnt, ergänzt wird. Die handliche Auswahlausgabe der Hauptschriften bietet neben den Texten eine wissenschaftliche Kommentierung (sie fehlt im ersten Band). Ioannis Calvini Opera, ed. G. Baum, E. Kunitz, E. Reuss, Braunschweig: 1863-1900, 59 Bde. (Corpus Reformatorum Bd. 29-87) Ioannis Calvini Opera selecta, ed. P. Barth, W. Niesei, D. Scheuner, München 1926-1952, 5 Bde. Supplementa Calviniana (Predigten), Neukirchen, Bd. 1, 1936-1961, ed. H. Rückert; Bd. 2, 1961-1964, Bd. 5, 1964, ed. E. Mühlhaupt (nicht abgeschlossen). 3. Deutsche Übersetzung einzelner
Werke
Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Religionis Christianae nach der letzten Ausgabe übers, von O. Weber, Neukirchen 1955». 1 Joh. Calvins Christliche Glaubenslehre nach der ältesten Ausgabe vom Jahre 1536, B. Spiess, Wiesbaden 1887. Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe, hsg. von O. Weber, Neukirchen 1937 ff. (nicht abgeschlossen). Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Übers, von R. Schwarz, Neukirchen 1960-1962 2 , 3 Bde. Um Gottes Ehre! Vier kleinere Schriften Calvins, übers, von M. Simon, München 1924 (Brief an König Franz I., Antwort an Kardinal Sadolet, Genfer Katechismus 1542, Schreiben an Kaiser Karl V.)
117
Literaturverzeichnis
M u ß t e Reformation sein? Calvins Antwort an Kardinal Sadolet. Übers, von G. Gloede. (Das W o r t der Reformation, Bd. 4) Göttingen 1956 und Berlin 1957. Abraham - Predigten. Ubers, von E. Bizer, München 1937 Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Ubers, u. eingel. von E. Mühlhaupt, Neukirchen 1959. Christliche Unterweisung. Der Genfer Katechismus von 1537 (FurcheBücherei Nr. 217) H a m b u r g 1963 Johannes Calvin, Das Abendmahl des Herrn. Übers, von W . Rotscheidt, Elberfeld 1909 2 (Petit Tracite de la Saincte Cene, 1541). Reformierte Bekenntnisschriften und Kirchenordnung in deutscher Übersetzung, hsg. von P. Jacobs, Neukirchen 1949 (Genfer Katechismus 1542, Genfer Kirchenordnung 1561, Hugnottisches Bekenntnis samt Kirchenordnung von 1559 u. a.) 4. Biographien Eine ausführliche neuere Lebenbeschreibung Calvins gibt es nicht. Doch sind in den letzten Jahren einige gute, kürzere Darstellungen erschienen. Das Monumentalwerk von E. Doumergue ist eine große Materialsammlung, die speziellen Anforderungen nicht genügt. Es lohnt sich immer noch, auf die ausführliche, ältere Biographie von E. Stähelin zurückzugreifen. Stähelin, Ernst: Johannes Calvin, Elberfeld 1863, 2 Bde. (Leben u. ausgew. Schriften der Väter u. Begründer d. reform. Kirche, Teil 4) Doumergue, Emile: Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps, Lausanne 1899-1927, 7 Bde. (in Folio). Bossert, A.: J o h a n n Calvin, Gießen 1908 (aus dem Französischen). Stickelberger, Emanuel: Calvin, Gotha 1931 u n d Stuttgart 1943. Cadier, Jean: Calvin. Der M a n n , den Gott bezwungen hat, Zollikon 1959 (aus dem Französischen). Staedtke, Joachim: Johannes Calvin. Erkenntnis u n d Gestaltung, Göttingen 1969 (Persönlichkeit u n d Geschichte Bd. 48). 5. Einzeluntersuchungen
zum Leben
Calvins
Bohatec, Joseph: Bud6 und Calvin. Studien zur Gedankenwelt des französischen Frühhumanismus, Graz 1950. Sprenger, Paul: Das Rätsel u m die Bekehrung Calvins. Neukirchen 1959.
Literaturverzeichnis
118
Köhler, Walter: Züricher Ehegericht und Genfer Konsistorium, Bd. 2, Leipzig 1942 (Quellen und Abhandlungen z. Schweiz. Reformationsgesch. Bd. X). Cornelius, C. A.: Z u r Geschichte Calvins, in: Historische Arbeiten vornehmlich zur Reformationszeit, Leipzig 1899, S. 105-557. Neuser, Wilhelm H.: Calvins Beitrag zu den Religionsgesprächen von Hagenau, Worms u n d Regensburg (1540/41), in: Studien zur Geschichte und Theologie der Reformation, Festschrift für E. Bizer zum 65. Geb., Neukirchen 1969, S. 213-237. Bainton, Roland H.: Michael Servet 1511-1553, Gütersloh 1960 (aus dem Englischen). Wolf, Ernst: Deus omniformis. Bemerkungen zur Christologie des Michael Servet, in: Theologische Aufsätze Karl Barth zum 50. Geburtstag, München 1936, S. 443-466. Pfisterer, Ernst: Calvins Wirken in Genf, Neukirchen 1957 2 . Nürnberger, Richard: Die Politisierung des französischen Protestantismus, Tübingen 1948.
6.
Theologie
Eine umfassende Darstellung der Theologie Calvins fehlt. Dies liegt zum Teil daran, daß in der Vergangenheit immer wieder unzutreffende Fragen u n d M a ß s t ä b e an seine Thnologie herangetragen worden sind. Auch erweist sich sein H a u p t w e r k , die Institutio, die sich natürlich als Zusammenfassung der Theologie Calvins anbietet, zugleich als Hemmnis. Ihre auf den ersten Blick klaren Aussagen verleiten dazu, die Forschung auf dieses Buch zu beschränken u n d das umfangreiche übrige Material mit seinen oft weitaus lebendigeren und aufschlußreicheren Aussagen beiseite zu lassen. Z u d e m gibt die Institutio dem Forscher eine Menge Fragen auf. Eine große Anzahl gründlicher Einzeluntersuchungen sind noch nötig, bis eine befriedigende Gesamtdarstellung möglich ist. Einige vorzügliche Monographien liegen bereits vor.
a)
Gesamtdarstellungen
Niesei, Wilhelm: Die Theologie Calvins, München 1957 2 („Kapitel 1: Die bisherige Forschung"!). Wendel, Francois: Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neukirchen 1968 (aus dem Französischen).
119
Literaturverzeichnis b)
Einzeluntersuchungen
Bohatec, Joseph: Calvins Vorsehungslehre, in: Calvinstudien 1909, Leipzig, S. 339-441. Brunner, Peter: Allgemeine und besondere Offenbarung in Calvins Institutio, in: Evangl. Theol. 1/1934, S. 189-215. Niesei, Wilhem: Syllogismus Practicus? in: Aus Theologie und Geschichte der reformierten Kirche, Festgabe für E. F. K. Müller, Neukirchen 1933, S. 158-179. Bohatec, Joseph: Calvin und das Recht, Freudingen i. W. 1934. Göhler, Alfred: Calvins Lehre von der Heiligung, München 1934. Dominica, Max: Die Christusverkündung bei Calvin, in: Beiheft 2/1936 der Evangl. Theol., S. 223-253. Bohatec, Joseph: Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berücksichtigung des Organismusgedankens, Breslau 1937. Jacobs, Paul: Prädestination und Verantwortlichkeit Neukirchen 1937.
bei
Calvin,
Krusche, Werner: Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, Göttingen 1957.
Namensregister Agrícola, J o h a n n 10 Alciati, Andreas 17 A m e a u x , Pierre 71 A n t i d o t , François de 105, 106 Anton v o n N a v a r r a 105, 106, 107 Augusta, J o h a n n e s 47 Bainton, R o l a n d 118 Balduinus, Franciscus 46, 109 Barth, Peter 116 Bedier, Noel 8, 15, 20, 24 Berthelier, Philibert 76, 77 Beza, T h e o d o r 16, 19, 22, 23, 29, 88, 95, 102, 109, 113 Bizer, Ernst 117 Blandrata, Giorgio 92, 93, 95 Bohatec, Joseph 10, 117, 118, 119 Bolsee, Jerôme 74, 75 Bona, Königin von Polen 92 Bossert, A. 117 Bourg, Anne d u 106 Bray, Guy de 96 Brunner, Peter 118 Bucer, M a r t i n 5, 21, 40, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 59, 84, 97, 114 Budé, Wilhelm 7, 18, 27 Bullinger, Heinrich 66, 85, 88, 91, 93, 94, 95 Bure, Idelette de 46 Calvin, J o h a n n (Jean Cauvin, Calvinus) Charles d'Espeville 29 M a r t i a n u s Lucanius 27 Alcuinus 27, 43 Capito, W o l f g a n g 42, 50, 51 Caroli, Pierre 34, 35, 45, 110, 111
Cassander, Georg 109 Castellio, Sebastian 64, 65, 80 Cauvin, Anton 12, 30 Cauvin, Franz 12 Cauvin, Gérard 12, 13, 14, 15, 17 Cauvin, J e a n n e (le Franc) 12, 13 Cauvin, Karl 12 Cauvin, M a r i e 12, 30 Coligny, Gaspard 106 Contarini, Gasparo 52 C o p , Nikolaus 21, 22, 24 Cordier, M a t h u r i n 15, 17, 54 Cornelius, C. A. 68, 117 C o u r a u t , Elie 38 C r a n m e r , T h o m a s 99 Cromwell, Oliver 113 Czervenka, M a t t h i a s 47, 94 D a n ä u s , Petrus 20 Daniel, François 20, 22 Dolet, Etienne 9, 73 Dominicé, M a x 119 Doumergue, Emile 117 Duchemin, Nicolas 17, 29 Eck, J o h a n n 52 Eduard VI. König von England 97 Elisabeth, Königin von England 98 Erasmus von R o t t e r d a m 6, 7, 15, 18, 21, 22, 52, 66 Ercole d'Esté 29 Erichson, Alfted 116 Farel, Wilhelm 7, 30-34, 37-39, 44, 46, 53-55, 57-59, 62, 68, 69, 74, 76, 77, 80, 82, 98, 104 Favre, François 72, 73 Ferdinand I., römischer Kaiser 94
Forge, Etienne d e la 25 Franz I., König von Frankreich 8, 9, 20, 24 bis 27, 53 , 99, 100, 116 Franz II., König von Frankreich 106 Gentile, Valentin 92, 93 Gloede, G ü n t e r 116 Göhler, Alired 119 Gruet, Jacques 73 Grynäus, Simon 39, 43, 51 Heinrich II., König von Frankreich 101, 106 Heinrich VIII., König von England 97 Heussi, Karl 82 Illyricus, Flacius 87 Jacobs, Paul 117, 119 Kampfschulte, F. W. 14 Karl V., römischer Kaiser 24, 51, 79, 86, 95, 116 Karl IX., König v o n Frankreich 107 Katharina von Meaici 107 Knox, l o h n 98, 99, 108 Köhler, Walter 38, 117 Krusche, Werner 119 Lasco, J o h a n n a 87, 91, 93, 98 Lipomani, päpstlicher N u n t i u s 89 Lismanino, Francisco 89, 90, 92 Luther, M a r t i n 5, 7, 8, 10, 21, 22, 24, 28, 46, 49, 50, 52, 61, 68, 85, 87, 88, 99, 111, 112, 114, 115
Namensregister Maigret, Laurent 73 Marcourt, Antoine 25, 56 Margareta von Navarra 8, 9, 21, 23, 53 Maria, Königin von England 98 Marnix, Philipp van 97, 108 Marot, Clement 29, 42 Martyr, Petrus 97, 98 Melanchthon, Philipp 5, 7, 24, 25, 47-51, 53, 65-67, 87, 88, 91 Melius, Petrus 94 Morand, Jean 56 Mühlhaupt, Erwin 116, 117 Neuser, Wilhelm H. 118 Niesei, Wilhelm 116, 118, 119 Nürnberger, Richard 118 Oekolampad, Johann 32, 61, 82 Olevian, Caspar 109 Olivetan, Pierre Robert 19, 28 Osiander, Andreas 10 Paul III., Papst 86 Perrin, Ami 72, 74, 76, 79, 81 Pfisterer, Emst 81, 82, 118
Philipp, Jean 56 Philipp von Hessen 51, 53 Philipp II., König von Spanien 96 Pighius, Albert 66 Pocque, Antoine 9 Poppius, Menso 96 Quintin 9 Rabelais 9, 15 Radziwil, Nikolaus von 90, 93 Renata von Ferrara 28, 29 Rotscheidt, Wilhelm 117 Roussel, Gerard 7, 8, 21, 29, 30 Rückert, Hanns 116 Sadolet, Jacapo 27, 43, 44, 49, 116 Saunier, Antoine 54 Scheuner, Dora 116 Schwarz, Rudolf 116 Sept, Michel 54, 55 Servet, Michael 23, 77 bis 80, 92, 112, 118 Seymour, Eduard, Herzog von Somerset 97 Simon, Matthias 116 Sigismund August, König von Polen 89, 90
121 Sozini, Lelio 92, 93 Spiess, Bernhard 116 Sprenger, Paul 19, 117 Staedtke, Joachim 117 Stähelin, Ernst 86 Stancarus, Franciscus 92, 95 Stapulensis, Faber 7, 8, 19, 23 Stella, Petrus (Pierre de l'Estoile) 16, 17 Stickelberger, Emanuel 117 Stordeur, Jean 46 Sturm, Johannes 50, 51 Susliga, Florian 89 Tillet, Louis du 23 , 25, 28, 42 Trie, Guillaume de 78 Trolliet, Jean 67, 75 Valla, Lorenzo 75 Vatable, Franzois 7, 20 Viret, Pierre 30, 68, 74, 76, 82, 108 Volmar, Melchior 17-19 Weber, M a x 114 Weber, Otto 116 Wendel, François 118 Westphal, Joachim 87 Wolf, Emst 112, 118 Zwingli, Huldrych 5, 7, 8, 13, 24, 25, 28, 61, 85, 88, 112, 114
Sachregister Abendmahlslehre, Abendmahlsstreit 25, 34, 48 bis 50, 84 f., 87 f., 93, 114 f. Alteste (Presbyter) 37, 40, 58-60, 62 f., 103 Augsburger Bekenntnis (1530 u. 1540) 49 f., 91, 94 f. Biblizismus 111 Bilderverehrung 20, 29, 48 Bischofsamt 90 Calvinismus 5, 85, 95, 97, 99, 101, 107, 113 Censura f r a t r u m 64 Confessio Gallicana 104 Consensus Tigurinus 85, 87
Genfer Katechismus 33, 35 f., 67 f., 95, 111, 116 f. Gesetz (Dekalog) 10, 27 f., 35, 67 f., 110, 111 Heiligung 10, 40, 110 H u m a n i s m u s 6-9, 15, 17 f., 20, 22, 24, 27, 102 f. Institutio Christianae Religionis 26-28 , 49, 106, 111, 115, 116, 118 Kanon 111 Kirchenzucht 10, 36-39, 40, 48, 58 f., 61-63, 65, 72, 73 , 82, 88, 103, 108, 110, 114 Libertinismus (Libertiner) 9 f., 32, 80, 103
E x k o m m u n i c a t i o n (Kirchenbann) 12 £.. 36-39, 40, 61
Messe, M e ß o p f e r 29, 50, 52 f., 89, 103, 105 Mystik 7 f., 10, 78
Extra Calvinisticum 114
N i k o d e m i t 23, 103
Prädestinationslehre 65-68, 74-77, 101 f., 110, 112 f., 119 Reformationseid 37 Religionsgespräch 25, .'J4, 47, 49-53, 56, 57, 85, 107, 118 Sakramentierer 25 Sakramentslehre 27 f., 35, 114 Scholastik 6, 15, 21 Syllogismus practicus 113 f., 119 T a n z v e r b o t 82 T a u f e 87 T h e o k r a t i e 81 f., 84, 110 Toleranz 65 f., 80, 107 Transsubstantiation 52 Trinitätslehre 23 , 34 f., 77, 79 f., 92, 95, 110 ff. T y r a n n e n m o r d 106 Widerstandsrecht 106 f. Wittenberger Konkordic 48 f., 84
Religion in der Sammlung Göschen Luther Von Franz Lau 2., verbesserte Auflage. 153 Seiten. 1966. (Band 1187)
Melanchthon Von Robert Stupperich 139 Seiten. 1960. (Band 1190)
Zwingli Von Fritz Schmidt-Clausing 119 Seiten. 1965. (Band 1219)
Sören Kierkegaard Leben und Werk Von Hayo Gerdes 134 Seiten. 1966. (Band 1221)
Paulus Von Martin Dibelius Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben und zu Ende geführt von Werner Georg Kümmel. 4., verbesserte Auflage. 157 Seiten. 1970. (Band 1160)
Jesus Von Martin Dibelius 4. Auflage mit einem Nachtrag von Werner Georg 140 Seiten. 1966. (Band 1160)
Kümmel.
Walter de Gruyter & Co. • Berlin
Friedrich Schleiermacher Leben und Werk (1768 bis 1834) Von M. Redeker 320 Seiten. 3 Bildn. 1968. (Band 1177/1177 a)
Einführung in die Konfessionskunde der orthodoxen Kirchen Von K. Onasch 291 Seiten. 1962. (Band 1197/1197 a)
Geschichte des christlichen Gottesdienstes Von W. Nagel 2. verbess. u. erweit. Auflage. 258 Seiten. 1970. (Band 1202/1202 a)
Geschichte Israels Von den Anfängen bis zur Zerstörung des Tempels (70 n. Chr.) Von E. L. Ehrlich 2. Auflage. 159 Seiten. 1970. (Band 231/231 a)
Römische Religionsgeschichte Von F. Altheim 2 Bde. 2., umgearb. Auflage. I: Grundlagen und Grundbegriffe. 116 Seiten. 1956. (Band 1035) II: Der geschichtliche Ablauf. 164 Seiten. 1956. (Band 1052)
Die Religion des Buddhismus Von D. Schlingloff 2 Bde. I: Der Heilsweg des Mönchstums 122 Seiten. 11 Abbildungen. 1 Karte. 1962. (Band 174) II: Der Heilsweg für die Welt 129 Seiten. 9 Abbildungen. 1 Karte. 1963. (Band 770)
Walter de Gruyter & Co. • Berlin
Der Weg Jesu Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen Von Ernst Haenchen Groß-Oktav. 2., durchgesehene und verbesserte Auflage. XVI, 594 Seiten. 1968. Geb. DM 32,(De Gruyter Lehrbuch)
On the Trial of Jesus Von Paul 'Winter Groß-Oktav. X, 216 Seiten. 1961. Geb. DM 2 2 (Studia Judaica Band I)
Die Religion und die Rollen Eine psychologische Untersuchung der Frömmigkeit Von Hjalmar Sunden Groß-Oktav. VIII, 451 Seiten. 1966. Geb. DM 68,-
Neutestamentliche Zeitgeschichte Die biblische Welt 500 v. bis 100 n. Chr. Von Bo Reicke Groß-Oktav. 2., verbesserte Auflage. VIII, 257 Seiten mit 5 Tafeln. 1968. Geb. DM 28,(De Gruyter Lehrbuch)
Walter de Gruyter & Co. • Berlin
EMANUEL HIRSCH
Das Wesen des reformatorischen Christentums Oktav. VI, 270 Seiten. 1963. Ganzleinen D M 1 8 -
Ethos und Evangelium Oktav. XII, 443 Seiten. 1966. Ganzleinen D M 38,-
Hauptfragen christlicher Religionsphilosophie Oktav. VIII, 405 Seiten. 1964. Ganzleinen D M 19,80 (Die kleinen de-Gruyter-Bände 5)
Predigerfibel Oktav. XII, 415 Seiten. 1964. Ganzleinen D M 24,-
Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik Die Dogmatik der Reformatoren und der altevangelischen Lehrer quellenmäßig belegt und verdeutscht 4. Auflage. Oktav. XII, 446 Seiten. 1964. Ganzleinen D M 19,80
Walter de Gruyter & Co. • Berlin
W O L F G A N G TRILLHAAS
Dogmatik Groß-Oktav. 2., verbesserte Auflage. XVI, 582 Seiten. 1967. Geb. DM 36,(Sammlung Töpelmann I, 3)
Ethik Groß-Oktav. 2., neubearbeitete Auflage. XVI, 498 Seiten. 1965. Geb. DM 3 2 (Sammlung Töpelmann I, 4)
Das Evangelium und der Zwang der Wohlstandskultur Oktav. XIII, 82 Seiten. 1966. DM 1 2 (Theologische Bibliothek Töpelmann, Heft 13)
Gott existiert Eine dogmatische Studie von Carl Heinz Ratschow Oktav. 2. Auflage. IV, 87 Seiten. 1968. DM 12,(Theologische Bibliothek Töpelmann, Heft 12)
Walter de Gruyter & Co. • Berlin
Homiletik Theologie und Technik der Predigt Von Leonhard Fendt Zweite Auflage, neu bearbeitet von Bernhard Klaus Oktav. X, 147 Seiten. 1970. Gebunden DM 1 6 (De Gruyter Lehrbuch) Aus dem Inhalt: Prolegomena - Systematik der Predigt - Einführung in die homiletische Praxis - Die Grundlinien einer Form- und Ideengeschichte der Predigt.
Evangelische Religionspädagogik Von Helmuth Kittel Oktav. XXVIII, 489 Seiten. 1970. Gebunden D M 32,(De Gruyter Lehrbuch) Einführung in die wissenschaftliche Religionspädagogik des deutschen Protestantismus. Lehrbuch für Studierende aller religionspädagogischen Berufe.
Massenmedien im Dienst der Kirche Theologie und Praxis Von Bernhard Klaus Oktav. VIII, 215 Seiten. 1970. Laminiert D M 9,80 (Theologische Bibliothek Töpelmann, Band 21) Praktisch-theologisches Lehrbuch über die Durchführung von Predigt, Unterricht und Seelsorge mittels der technischen Medien Presse, Hörfunk, Fernsehfunk und Fernsprecher.
Walter de Gruyter & Co. • Berlin