Brüder, Geister und Fossilien: Eduard Mörikes Erfahrungen der Umwelt [Reprint 2014 ed.] 9783110925746, 9783484321083
This collection of essays is interdisciplinary in approach and examines areas of the life and work of Eduard Mörike (180
209 14 8MB
German Pages 184 Year 2001
Polecaj historie
Table of contents :
Einleitung
Brüderlich geteiltes Unglück. Karl, Eduard, August, Louis und Adolph Mörike
Der Bruderschwur zu Ludwigsburg
Hoffnungsvoller Beginn
Mystes’ Tod (August Mörike 1807-1824)
»Der Amtmann hat Läuse« (Karl Mörike 1797-1848)
»Wo will all das noch naus?« (Adolph Mörike 1813-1875)
Konstant im Schatten (Louis Mörike 1811-1886)
Ganz gewöhnliches Elend
»Apropos was halten Sie von Gespenstern?« Mörikes Beziehung zu Kerner im Schwarzlicht privater Geisterkunde
Der peinliche Geister-Mörike
Philosophie, Geister und Kerner
Ein Geistesverwandter (1824-1834)
Kryptobiographie und Krankenbesuche (1835-1836)
»Rabausch«-Gespräche (1837-1840)
Poltergeister in und um Cleversulzbach (1841-1843)
Nachklang
»Willkommene Fragmente« Eduard Mörikes Versteinerungssammlung
Biedermeier sammelt
Der Pensionär vermißt den »Zwölffaecherkasten« (Wermutshausen 1843 -1844)
»Weil aber doch einmal klassifiziert sein muß ...« (Schwäbisch Hall 1844)
Studien eines angehenden Petrefaktensammlers
»[...] ich verlange ja auch nicht ganze oder halbe Ichthyosauren« (Mergentheim 1844-1850)
Handlanger der Wissenschaft?
Antediluvianische Gelegenheiten
Studien eines angehenden Petrefaktensammlers Schwäbisch Hall 1844/45. Abbildung und Beschreibung einiger in der Umgegend von Schwäbisch] Hall gefundenen Petrefakten mit Bemerkungen von Prof. Kurr
Literaturverzeichnis
Texte Eduard Mörikes
Weitere Literatur
Namenregister
Abbildungsnachweise
Citation preview
Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte Band 108
Thomas Wolf
Brüder, Geister und Fossilien Eduard Mörikes Erfahrungen der Umwelt
Max Niemeyer Verlag Tübingen 2001
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Wolf, Thomas: Brüder, Geister und Fossilien: Eduard Mörikes Erfahrungen der Umwelt / Thomas Wolf. - Tübingen: Niemeyer, 2001 (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte; Bd. 108) ISBN 3-484-32108-3
ISSN 0083-4564
© Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen 2001 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier. Satz: niemeyers satz, Tübingen Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten Einband: Industriebuchbinderei Nadele, Nehren
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
ι
Brüderlich geteiltes Unglück Karl, Eduard, August, Louis und Adolph Mörike
5
Der Bruderschwur zu Ludwigsburg
5
Hoffnungsvoller Beginn Mystes'Tod (August Mörike 1807-1824) »Der Amtmann hat Läuse« (Karl Mörike 1797-1848) »Wo will all das noch naus?« (Adolph Mörike 1813-1875) . . . Konstant im Schatten (Louis Mörike 1 8 1 1 - 1 8 8 6 ) Ganz gewöhnliches Elend
6 10 15 39 46 47
»Apropos was halten Sie von Gespenstern?« Mörikes Beziehung zu Kerner im Schwarzlicht privater Geisterkunde
49
Der peinliche Geister-Mörike Philosophie, Geister und Kerner Ein Geistesverwandter (1824-1834)
49 51 64
Kryptobiographie und Krankenbesuche (1835-1836) »Rabausch«-Gespräche (1837-1840) Poltergeister in und um Cleversulzbach (1841-1843) Nachklang
72 76 86 m
»Willkommene Fragmente« Eduard Mörikes Versteinerungssammlung
115
Biedermeier sammelt Der Pensionär vermißt den »Zwölffaecherkasten«
115
(Wermutshausen 1843-1844)
118 V
»Weil aber doch einmal klassifiziert sein muß ...« (Schwäbisch Hall 1844) Studien eines angehenden Petrefaktensammlers »[...] ich verlange ja auch nicht ganze oder halbe Ichthyosauren« (Mergentheim 1844-1850) Handlanger der Wissenschaft? Antediluvianische Gelegenheiten
121 129 131 142 151
Eduard Mörike: Studien eines angehenden Petrefaktensammlers Schwäbisch Hall 1844/45. Abbildung und Beschreibung einiger in der Umgegend von Schwäbfisch] Hall gefundenen Petrefakten mit Bemerkungen von Prof. Kurr.
160
Literaturverzeichnis Texte Eduard Mörikes Weitere Literatur
166 166 167
Namenregister
173
Abbildungsnachweise
178
VI
Einleitung
Friedrich Sengle forderte 1952 eine Mörikebiographie, die »dem Wechselspiel von Leben und Werk wirklich gerecht wird«, 1 wobei er von der Prämisse ausging, daß »bei Mörike Kunst und Leben in einer engen Beziehung zueinander stehen«. 2 N o c h i960 konnte Siegbert Salomon Prawer nur Harry Mayncs überarbeitete Biographie von 1 9 1 3 als gelungenen Versuch rühmen, »urkundlich« vorzuführen, »was eigentlich geschah«. 3 Inzwischen ist diese literaturgeschichtliche Lücke durch die Lebensbeschreibung von Peter Lahnstein und das chronikalische Tabellenwerk Hans-Ulrich Simons geschlossen und das Bild der mannigfachen inneren Zusammenhänge von Leben und Werk bei Eduard Mörike weitgehend fixiert. Wenn es trotzdem noch biographische Dunkelfelder gibt, die zu erhellen bisher niemanden begeisterte, so ist dies möglicherweise dem Umstand zuzuschreiben, daß hierzu philosophisches, geologisches oder alltagsgeschichtliches Terrain betreten werden muß. Interdisziplinäre Detailstudien erschließen indes Stoff für neue gedankliche Querverbindungen, die beim vorsichtigen Betrachten hinlänglich bekannter summarischer Urteile oder gängiger Interpretationen nicht zustande kommen. D i e folgenden drei Untersuchungen beleuchten spezifische, unter dem gemeinsamen Nenner Umwelterfahrung zusammengefaßte Erlebniswelten eines Schriftstellers, der sich den Zwängen und Bedingtheiten seiner familiären Situation sowie den Fremdbestimmungen seiner geistigen und literarischen Entwicklung durch Schule, Universität und staatliche Obrigkeit anpassen mußte und doch trotz aller Anfechtungen und Deformationen des äußeren Lebens literarische Werke hervorbrachte, an denen formale Ungezwungenheit, stilistische Brillanz oder gar Klassizität (Vorbildlichkeit) gerühmt werden. Das Genrebild vom armen,
1 2 5
Sengle [1], S. 4 6. Sengle [1], S. 44. Prawer, S. 46. 1
notleidenden Restaurationszeitpoeten, der bei allem äußeren Elend als Klausner seine Werke schafft, will auf ihn dennoch nicht passen. Mörike erwies sich vielmehr, wiewohl physisch und psychisch oft angegriffen, als ein mitten im Leben stehender und aus mannigfachen familiären und gesellschaftlichen Prüfungen gestärkt hervorgehender Autor, der seine gewonnenen Erfahrungen in der Literatur meisterlich umzusetzen und spielerisch zu relativieren vermochte. Mörikes anfänglich starker Autoritätsglaube wich mit der Zeit immer mehr dem Autoritätszweifel in der Beziehung zum älteren Bruder Karl, in der ungleichen Freundschaft zu Justinus Kerner sowie im Dialog zu naturwissenschaftlichen Koryphäen wie Kurr, Quenstedt oder Oppel. Als Konstanten erscheinen angesichts dieses Emanzipationsprozesses die Liebe zur Schwester Klara und die Freundschaft zu Wilhelm Hartlaub, die beide nicht nur in der Phase der Spukbegeisterung, sondern auch bei der geologischen Beschäftigung Mörikes Umwelterfahrungen, seine Geheimnisse und Entdeckungen teilten. Im aufopferungsvollen Zwist mit den straffälligen Brüdern Karl und Adolph trat Eduard Mörike als ausdauernder Kämpfer und letztlich dominierender Pater familias auf. Auch gegenüber Justinus Kerner, der zunächst die Rolle eines geistigen Ubervaters spielte, dann zeitweise auf okkultistischem Gebiet ein Gleichgesinnter war, um schließlich als Leitbild abzudanken, vollzog sich - parallel zu Mörikes schriftstellerischer Sozialisation - eine deutliche Entwicklung von Passivität zur Aktion. Mörikes Streben nach Selbstbestimmung und Dominanz zeigte sich selbst im scheinbar abseitigsten Lebensbereich des unverhofft gewonnenen privaten Freiraums, als er nach seiner Pensionierung begann, die gewachsene, naturwissenschaftlich erklärbare Umwelt zu ergründen und im Rahmen einer regionalen Petrefaktensammlung in Besitz zu nehmen. Ein damals beliebter Zeitvertreib geriet dem Pensionär zur ernsthaften Beschäftigung mit der gerade prosperierenden geologischen Wissenschaft. Beharrlich erarbeitete er sich ein ansehnliches Fachwissen, schwang sich zum herrschsüchtigen Gebieter einer Schar von Sammel»Helfern« auf, die ihn mit Rohmaterial versorgten, trat mit wissenschaftlichen Größen der Zeit in Gedankenaustausch und erwog sogar, durch kustodische Tätigkeiten beruflichen Nutzen aus der Steinleidenschaft zu ziehen. Bei der Betrachtung des scheinbar harmlosen Fossiliensammelns und der obskuren Beschäftigung mit parapsychischen Phänomenen werden 2
nebenbei aus ungewohnter Perspektive Grundoperationen der Mörikeschen Poetik sichtbar, etwa das Benennen und akribische Beschreiben von Dingen und Sinneseindrücken, das teilweise pseudoreligiöse Züge annimmt. Sowohl im Gespensterkontext - der für Kerner verfassten Beschreibung der Cleversulzbachphänomene - als auch im Fossilkontext - der für Kurr verfertigten Beschreibung eigener paläontologischer Fundstücke - zeigt sich das zentrale Interesse Mörikes weniger als ein natur- oder pseudowissenschaftliches, denn als ein poetischästhetisches. Wie das Fossiliensammeln im vielzitierten Gedicht »Der Petrefaktensammler« zur Poesie wird, schöne Steine und schöne Worte plötzlich austauschbar erscheinen, blitzt durch die vordergründig sachliche und kühle Beschreibung akustischer Wahrnehmungen eventueller Geisteraktivitäten das Interesse an einer schönen, geheimnisvollen und witzigen Spukgeschichte. Nur mit Mühe gelang es Justinus Kerner, der in seiner okkult-wissenschaftlichen Zeitschrift >Magikon< sehr (vergeblich) um Seriosität bemüht war, Mörike vom stimmungsvollen, aber vollkommen hypothetischen, Benennen des Urhebers der gespenstisch anmutenden Sensationen im Cleversulzbacher Pfarrhaus abzubringen. Mörike war an »Rabauschs« Geschichte und an der Vorstellung, sie poetisch mitzugestalten, offenbar mehr interessiert als an philosophischer Spekulation über ihre Faktizität. Die interpretatorischen Möglichkeiten sollten hier und in den drei Detailstudien nur angedeutet werden; verzweigte literaturhistorische Darstellungen verlieren durch längere exegetische Exkurse oft alle Stringenz. Insofern versteht sich das Buch eher als Vorarbeit denn als abschließendes Memorandum. Um Eduard Mörikes »Erfahrungen der Umwelt« und etwaige auf diesen gründende Deutungen von Teilaspekten seiner Poetik und Ästhetik umfassend darzustellen, wären noch verschiedene andere, bislang unbeleuchtete Lebensabschnitte und Erlebnisbereiche in ausführlichen Kapiteln einzubeziehen, vor allem das Verhältnis zu Schwester und Ehefrau und die Unterrichtstätigkeit am Stuttgarter Katharinenstift. Stillschweigend vorausgesetzt bleibt die werkgeschichtliche und interpretatorische Relevanz biographischer Daten, über die sich freilich theoretisch ebenso grundlegend streiten ließe wie über die Frage, ob die Fokussierung des biographischen Augenmerks auf einen bestimmten Lebensbereich nicht Verzerrungen des Gesamtbildes und der Einzelheiten hervorruft, indem sie dem Detail mehr Gewicht beimißt, als ihm 3
vielleicht zukommt. Doch dürfte bei der Verfeinerung des biographischen Rasters das Gesamtbild an Schärfe gewinnen, weil der im Moment des genauen Hinsehens ausgeblendete große Rahmen nicht generell aufs Spiel gesetzt wird und der Leser durch die biographische Chronologie stets zu einer Relativierung eventueller Uberzeichnungen in der Lage ist. Für die im folgenden offerierten Seiteneinblicke bedurfte es keiner langjährigen Wühlarbeit in den Archiven, da sie vorwiegend mit gedruckten Quellen auskommen - nur dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach sei für die Erlaubnis zur Begutachtung der Reste von Eduard Mörikes Petrefaktensammlung und für die Genehmigung zum Abdruck der >Studien eines angehenden Petrefaktensammlers< herzlich gedankt. Ebenso danke ich Herrn Prof. Dr. Georg Braungart (Regensburg), ohne dessen Bemühungen das vorliegende Buch nicht hätte realisiert werden können. Die Münchner Hermann-Lenz-Stiftung finanzierte in großzügigster, äußerst dankenswerter Weise den Druck. Für wertvolle Hinweise und aufmunternden Zuspruch bin ich außerdem Frau Margarete Mörike (Stuttgart), Frau Dr. Ursula Kocher (Berlin), Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Philippi (Tübingen), Herrn Prof. Dr. Winfried Barner (Göttingen), Herrn Reinhard Breymayer (Ofterdingen) und Herrn Albrecht Bergold (Marbach) sehr verpflichtet. T.W.
4
Brüderlich geteiltes Unglück Karl, Eduard, August, Louis und Adolph Mörike
Der Bruderschwur zu Ludwigsburg Karl Friedrich Mörike, Ludwigsburger Landvogtei- und Oberamtsarzt, s t a r b a m 22. O k t o b e r 1 8 1 7 m i t 54 J a h r e n an d e n F o l g e n eines S c h l a g anfalls u n d hinterließ seine E h e f r a u C h a r l o t t e D o r o t h e a m i t sieben K i n d e r n 1 in materiell u n g e s i c h e r t e n V e r h ä l t n i s s e n . S e i n e n T o d v o r a u s a h n e n d h a t t e n s i c h die f ü n f S ö h n e a m 7. J a n u a r d u r c h e i n e n s y m b o l i s c h e n A k t e n g a n e i n a n d e r g e s c h l o s s e n . Sie e r r i c h t e t e n ein s c h r i f t l i c h e s > M o n u m e n t u m a m i c i t i a e fraternae< - w o h l einer I d e e K a r l s , des A l t e sten, f o l g e n d : W i r [...] versprechen uns gegenseitig, die Pflichten, die wir als Brüder auf uns haben, einander treu zu erfüllen, die Liebe in allen Lagen unseres Lebens zu erhalten, und, wenn der Tod uns trennen wird, einander auch noch im Grabe und in der Ewigkeit zu lieben. 2 S i e b e n P a r a g r a p h e n enthielt d e r V e r t r a g i m g a n z e n u n d g i p f e l t e in d e m Gelöbnis, den, der einst so tief herabsinken könne, diesen aus den reinsten Absichten geleisteten Schwur zu verlachen, bei allem, was ihm heilig und teuer sei, auf den rechten Weg zurückzuführen. 3
1
Eduard Mörike, geboren am 8. September 1804, war das dritte Kind von Charlotte und Karl Mörike, das überlebte (nach Karl, ^1797 und Luise, #1798). Eine Schwester und drei Brüder (Charlotte, 28.8.1795-23.3.1797; Karl, 2.8.1794; Christian, 20.10.1800; Christian, 7.7.1802-10.3.1803) waren nicht am Leben geblieben. A u ß e r den vier Jüngeren (August, * 1807; Louis, 1811; Adolph, #1813 und Klara, *I8I6) kamen noch weitere zwei G e schwister auf die Welt, starben jedoch früh (Mariette Augustine, 17.6.180611.4.1807; Friederike, 5.8.1809-29.8.1809). Vgl. Klaus Dietrich Mörike [3], S. io6f. Von dreizehn Kindern überlebten sieben, was damals nicht ungewöhnlich war. Die Kindersterblichkeitsrate in Württemberg lag bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts bei ca. 40 Prozent. Vgl. Boelcke, S. 157f.
2
Zit. nach Lahnstein, S. 15. M a y n c [2], S. 15.
3
5
Karl, Eduard und August unterzeichneten eigenhändig, den beiden Jüngsten (Louis und Adolph) lenkte Karl die Feder. 4 Z u m Beweis der Zusammengehörigkeit hatten alle Brüder etwas zum Monument beigesteuert, das aus einem an Wand oder Decke zu hängenden' Holzbehältnis bestand: Von Carl M. ist die Kapsel Nr. ι samt Inlage / [von] Eduard M . [ist] das Wappen. / [Von] A u g u s t ist das Cachet. 6 / [Von] L u d w i g ist der Kupferstich. / [Von] A d o l p h M . [ist] das hölzerne Gefäß. 7
Außerdem wurde jedem ein Kryptogramm 8 für den familiären Briefwechsel zugeordnet. So »knabenhaft« 5 das A b k o m m e n erscheint, so »merkwürdig« 10 ist es doch im wahrsten Wortsinn. Eduard bekräftigte 1819 den Bund durch einen handschriftlichen Urkundeneintrag. 11 Es sollte eine Zeit kommen, da ihm jene sieben Paragraphen drückend in Erinnerung gerufen würden.
H o f f n u n g s v o l l e r Beginn Zunächst bewegte sich das Brudergespann auf eher sonnigen Wegen. Karl hatte 1811 in Ludwigsburg die Schule beendet und studierte nach diversen Kameralpraktika (zuletzt in der Stadt- und Amtsschreiberei in Nürtingen) seit April 1818 in Tübingen Staatswissenschaft und Staatswirtschaft, während Eduard im November trotz des nicht bestandenen Landexamens (64Ster von 81 Kandidaten) dank Onkel Georgiis 12 Für4 5
6 7 8
9 10 11
12
Zit. nach Kaufmann, S. 28. »Heute vertrauen wir dieß Gefäß, und alles was daßelbe enthält, zum Zeichen unseres brüderlichen Bündnißes der Luft an, und verpflichten uns gegenseitig, dieses Denkmal, so bald es verletzt wird, z u erneuern.« Zit. nach Koschlig, S. 48 (Faksimile) u. S. 204. Frz.: Siegel. Zit. nach Kaufmann, S. 29. Der Brauch der Namenszeichen wurde besonders bei den studentischen Verbindungen gepflegt. Vgl. Bauer, S. 111. Maync [2], S. 15. Maync [2], S. 15. Maync [2], S. IJ. Peter Lahnstein verwechselt die Datierung des handschriftlichen Vermerks von Eduard (1819) mit dem Entstehungsdatum, weshalb er behauptet, Karl Eberhard sei »damals zweiundzwanzig« Jahre alt gewesen (vgl. Lahnstein, S. 15). Friedrich Eberhard von Georgii (1757-1830) war 1818 Direktor des königlich-württembergischen Obertribunals (und von 1819 an dessen Präsident).
6
spräche als »sehr gutartiger Knabe« doch »gnadenhalber« 1 ' zum niederen theologischen Seminar in Urach zugelassen worden war. Gottlob Friedrich Plancks Familie in Nürtingen 1 4 schließlich ermöglichte A u gust in den Jahren 1 8 1 8 - 2 0 den Schulbesuch. In Urach hatte Eduard großes Heimweh nach der Mutter und dem Bruder Karl. 1 ' Mit wachsendem Freundeskreis schmerzte ihn die Entfernung von der Familie aber immer weniger. Die Brüder wurden in die neuen Freundschaften mit einbezogen. Als etwa Karl, der nun in Stuttgart Referendar bei der Königlichen Finanzverwaltung 16 war, von Eduards Kontakt zu Wilhelm Waiblinger erfuhr, bat er »dringend«, ihm etwas Poetisches von diesem »mitzutheilen«. 17 Eduard schrieb Waiblinger von Karls Interesse, der sich nun seinerseits nach Karl erkundigte. Eduard stellte ihm den Bruder folgendermaßen vor: Mein älterer Bruder? er ist gegenwärtig in Stuttgardt bey meiner Mutter, nachdem er in Tübingen das CAMERALE studirt hatte. Du hast ihn wohl schon oft ohn ihn zu kennen auf der Bibliothek - dem Museum - oder im Theater gesehen. Stell Dir keinen trockenen Cameralisten drunter vor. Ich lieb ihn über alles. Sein Liebstes ist Musik [...]. 1 8
1806 hatte er nach Aufhebung der altwürttembergischen Verfassung König Friedrich I. von Württemberg den Schwur unbedingter Untertänigkeit verweigert und den Dienst quittiert, weshalb man ihn landläufig den »letzten Württemberger« nannte. Der König aber hatte auf Georgiis Dienste nicht verzichten wollen und ihn schon bald wieder ins Oberjustizkollegium berufen. Georgii betrieb im Garten hinter seinem Haus Büchsenstraße 3 6 (am Büchsentor) eine Kegelbahn, und lud Jahr für Jahr zu einer Kegelgesellschaft ein, der als ständiger Teilnehmer auch der Bildhauer Johann Heinrich Dannecker angehörte. Vgl. Zeller, S. 40 und Kaufmann, S. 30. '3 Zeller, S. 53. 14 Die Frau des Stadtschreibers, Auguste Friederike Rosina Planck geb. Beyer war die Schwester von Charlotte Mörike und Klara Neuffen Klaras Ehemann Christoph Friedrich Ludwig Neuffer unterstützte Charlotte und ihre Kinder. Vgl. H G K A 10, Anm. S. 340 zu S. 13, Z. 24-27. 15 An die Mutter schrieb er am 2$. Juni 1821: »Wenn ich wirklich nur einige Augenblicke zu euch und in Carls Zimmer fliegen könnte!« H G K A 10, S. 19, Z. 2 4 f. 16 Vgl. Simon, Sp. 26. •7 H G K A 10, S. 30, Z. 3of. 18 H G K A 10, S. 32, Z. 7-14. Die Skizze Schloß: »[...] zwar ist schon längst noch anderer nicht minder schöner Gegenstand der ihn begeistert«, womit auf Pauline Lohbauer, eine Schwester von Mörikes ehemaligem Ludwigsburger Schulkameraden Rudolf Lohbauer angespielt war, in die Karl sich verliebt hatte. Vgl. H G K A 10, Anm. S. 364 zu S. 32, Z. 13. 7
Karl war der einzige Bruder, der »an Alter [...] vor« Eduard stand und dank seiner »Eigentümlichkeit« 1 ' tiefen Einfluß auf ihn nahm, vornehmlich sein Fühlen auf »übersinnliche und göttliche Dinge zu lenken verstand«. 20 Er verfolgte die Fortschritte Eduards im Schreiben und leitete ihn in poetischen Dingen an. 1819 erschienen Gedichte beider Brüder im Stuttgarter >Armen-FreundTheelied< wurde am 2. Januar 1821 im Cottaschen >Morgenblatt< abgedruckt. Schon früh hatte sich bei Karl eine starke musikalische Begabung angedeutet. 1807 bis 1810, im Alter von zehn bis dreizehn Jahren, erteilte ihm Carl Maria von Weber Klavierunterricht. 22 Er hat während des Studiums komponiert und Cotta in Tübingen 1820 eine Sammlung eigener Lieder zum Verlag angeboten.23 Der Vierundzwanzigjährige beendete im April 1821 sein Studium in Tübingen mit Bravour, so daß Onkel Georgii seinen Schützling Eduard (eingedenk des Fiaskos beim Landexamen) am 12. März 1822 ermahnen konnte: ich bitte dich, deinen Bruder Carl zum Vorbild zu nehmen: er hat sein Examen mit vielem L o b bestanden und das Zeugnis erster Classe erhalten. Die Vorsehung wird, wie ich hoffe, nun auch weiter für ihn sorgen. 2 4
1822 widmete Karl seinem Onkel Eberhard von Georgii, dem Präsidenten des Königlich Wirtembergischen Obertribunals und Ritter des Kföniglich] Wfirtembergischen] Kronordens 2 5
»unterthänigst« die kleine Schrift >Über die Verbesserung der Gemeindeverwaltung als Mittel zum National-WohlstandSüsser Abend, deine Stille ...< sowie ein unvollendetes Drama, zu dem Ernst Friedrich Kauffmann die Musik hatte schreiben wollen. Vgl. Kaufmann, S. 36. - Augusts Nachlaß und die Nachlässe der anderen Brüder sind »nicht nachweisbar und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch nicht erhalten«. (Schriftliche Auskunft von Albrecht Bergold, Mörikearchiv vom 7. Mai 1998).
10
innigen Wunsch, Medizin zu studieren. Seit 1821 lebte er in Stuttgart bei Mutter und Schwestern und bereitete sich heimlich auf das angestrebte Studium vor. Erst 1823 ließ er seinen Entschluß durchblicken. 4 4 D i e Familie versagte ihm aus finanziellen Gründen die Verwirklichung seiner Pläne und brachte ihn im Frühjahr 1824 als Apothekergehilfe in L u d w i g s b u r g unter, zunächst bei der Brandschen H o f a p o t h e k e am Holzmarkt, 4 5 danach in der Hausmannschen Apotheke. A u g u s t hatte die Studienabsichten keineswegs aufgegeben; vielmehr plante er nun, an der Ackerbauschule in Hohenheim Landwirtschaft zu studieren, da dort keine spezielle, kostspielige Vorbildung verlangt wurde. 4 6 Eduard, dem er in Tübingen davon erzählte, nannte die Studienpläne ein »Luftschloß«. 47 Er war »völlig ruhig« über die Aussichtslosigkeit des Unterfangens und versuchte A n f a n g Juli 1824, dem Jüngeren die Studienabsicht, die unsre geliebte Mutter in ein Meer von Sorgen stürzt48, ganz zu vergällen. 49 Vielleicht aus Unlust über diesen unbrüderlichen Versuch plauderte August, gerade von Bernhausen herkommend, eine (leider nicht überlieferte) Äußerung der Kusine Klara N e u f f e r über ihr einstiges Verhältnis zu Eduard aus. 5 ° Dieser war tief verletzt.' 1 U m die Wogen zu glätten, schickte August, den Weg nach Stuttgart wieder über Bernhausen nehmend, eine mit Klara gemeinsam gebrochene Rose nach Tübingen, die Eduard wehmütig an Entschwundnes und an das Vorüberfliegen irdischer Gestalten an einander erinnert.51 Ins gleiche methaphorische Feld gehörten w o h l auch die Orangenblüten, die A u g u s t dem Bruder sandte. Eduard bedankte sich, längst Vgl. Simon, Sp. 29. HKGA 10, Anm. S. 386 zu S. 53, Z. 19. 46 Vgl. Simon, Sp. 31 und HKGA 10, Anm. S. 386 zu S. 53, Z. 21. 47 HKGA 10, S. 44, Z. 22. Brief an die Mutter vom 4. Juli 1823. 48 Zit. nach Simon, Sp. 33. 4 ' Vgl. Simon, Sp. 33. 50 Vgl. Corrodi, S. 40. Klara Neuffer hatte sich bereits 1823 mit Christian Schmid verlobt. Eduards Beziehung zu Maria Meyer (Ostern 1823) beschleunigte nach ihrem Bekanntwerden in Nürtingen diese Verbindung: »[N]un war Mörike seiner Jugendgespielin widerwärtig [...] geworden.« Camerer, S. 5. 51 Vgl. HKGA 10, S. 274, Erschlossene Briefe 33. 52 Zit. nach Simon, Sp. 33. Vgl. auch HKGA 10, S. 68, Z. 16-21 und Anm. S. 400 zu S. 68, Ζ. ιγ{. 44 45
II
keinen Groll mehr hegend, von Stuttgart aus und unterzeichnete im Uberschwang der Gefühle den Brief gar mit »AUGUST«: - E D U A R D will ich sagen - d o c h ist ja U N U M A T Q U E I D E M . ' 3
Dem Eintreffen Augusts entgegensehend, verhieß Eduard: Wenn D u kommst, darfst Du allerhand Merkwürdiges sehen, lesen. 54
Die unglückliche Maria Meyer, die Eduard 1823 in Ludwigsburg kennengelernt und angeschwärmt hatte, war unversehens in Tübingen aufgetaucht und hatte ihn durch ihre höchst reale Gegenwart in tiefste Herzensbedrängnis gebracht. Er floh zwar nicht vor ihr, wie mit Harry Maync oft behauptet wurde," sondern besuchte sie ein- oder zweimal, in Begleitung Flads bzw. alleine,'6 aber das Wissen um ihre Nähe trieb ihn doch an den mütterlichen Herd nach Stuttgart, wo ihm ein Attest zu einer längeren Kur verhalf. Idealisch gestimmt, suchte er sich der irdischen Jammergestalt Mariens durch Poesie zu erwehren. Das erste der Peregrinagedichte (die spätere No. III) entstand sowie ein Drama >LymamünsterDon GiovanniMorgenblatt< zuflössen, durchaus auch einmal den Herrscher: Nebenher, ich weiß nicht, wie es kommt, maase ich mir unwillkührlich einige DOMINATION an, was in den Augen eines dritten in der That höchst lächerlich aussehen muß (und zuweilen auch in meinen eigenen), wenn man bedenkt, daß ich, ohne das, was mir mein Bruder zusteckt, keinen Heller bey mir führe. Aber das ist, als wenn sichs von selbst so gemacht hätte.9' Eduard beschrieb Karl als jovialen, leicht behäbigen Mann, dessen Humor sich erst bei näherem Zusehen offenbarte. 1824 hat er ihn mit »Cameralsverwaltersgesicht« gezeichnet und ein typisches, die »Karl'sche Manier« bezeichnendes »bonmot« imitiert.' 6 Johannes Mährlen schilderte er am 4. Mai 1828 sein »Verhältnis« zum Bruder, ihre »brüderliche Harmonie« folgendermaßen: Es ist ein Familien Äther und eine Geistesübereinkunft zwischen uns die eine um so interessantere Wirkung hervorbringt, je mehr wir dennoch in Nebendingen von einander abzuweichen scheinen, während gegenseitig eine stillschweigende und gewißermaßen delicate Anerkennung desjenigen vorwaltet, was einer vor dem andern voraushaben mag. Immer werden unsere hizigsten Debatten auch zugleich die lustigsten und innigsten und wir reichen einander dabei QUASI SUB ROSA mitten unter den Dornen die Hände.?7
93
»Das Hochamt war ...« Vgl. Werke, S. 4of. ' t H K G A 10, S. 210, Z. 2of. « H K G A 10, S. 2 1 1 , Z. 24-29. 96 Über die von August geschickten und auf dem Postweg braun gewordenen Zitronenblüten sagte er: »Für die Pfeife ist der Tabak freylich nicht, aber verdient darum doch nicht ausgepfilien zu werden.« H K G A 10, S. j6, Z. 6ff. '7 H K G A 10, S. 2 1 1 , Z. 16-24.
19
Karls »originelle« Verknüpfungen v o n naturwissenschaftlichen Kenntnissen, religiösen Meinungen und »wahrem Geschmack« machten ihn in den A u g e n des Bruders »unwiderstehlich«. 98 K u r z wir sind für einander gegossen u[nd] gemünzt - D u solltest nur 2 Wochen unter uns leben, was gilts D u würdest sagen dieser thurn u[nd] TAXissche Amtmann in Sfcheer] hat, wenn er will, etwas unbeschreibliches an sich das man lieben muß [ . . . ] . " Buchstäblicher Höhepunkt von E d u a r d s U r l a u b bei Karl w a r die gemeinsame Besteigung des 7 6 7 Meter hohen Bussen bei Unlingen ( A m t Riedlingen) am 16. Mai: hier genossen die Brüder bei herrlichem Wetter neben den anstehenden Ruinen und der Kapelle das Panorama bis zu den Alpen. D e r Berg mit Burgruine und Kapelle gehörte seit 1 7 9 0 dem H a u s e Turn und Taxis. 1 0 0 E i n Brief Eduards an Johannes Mährlen lieferte eine schöne Momentaufnahme des vorangegangenen Vormittags. Karl und Eduard waren »früh« nach Mengen gefahren, u m sich wegen einer Postkutschenroute zu erkundigen. Schnell landeten sie beim Wein und vergaßen in »desperater Lustigkeit« die Zeit. U m noch z u m Mittagessen heimzukommen, bestiegen sie kurz vor zwölf U h r die Postkutsche. A m »THOR VON SCHEER« jedoch ließ E d u a r d anhalten, bedeutete dem Bruder auszusteigen und wies den Kutscher an, ihn (Eduard) wieder nach Mengen zurückzufahren. Karl wurde erklärt, er solle zu Haus nur sagen, ich hätte, ohne APPETIT, in einer A r t Seelenkazenjammer die Grille gefaßt, auf dem Mengener Kirchhof MittagsRuhe zu halten. Dort läge ich unter einem Holderstrauch und sähe die warmen Kräuter auf den Hügeln der Sonne entgegendampfen, während aus der Thür der nahn Capelle kühle Schauer auf mich zuwehen. D a hätt ich so allerley auszubrüten. E r versprachs und man ist dergleichen schon an mir gewöhnt. N u n sitz ich aber, viel vernünftiger, hier auf der Post, trinke Caffee und schreibe, während der Wind am offnen Fenster dort die langen weißen Vorhänge, seegelartig bläht, - und siz und schreibe £>zr[.] 101
H K G A 10, S. 2 1 1 , Z. 33, 35 und S. 2 1 2 , Z. if. 99 H K G A 10, S. 2 1 1 , Z. 30-33. 100 1785 war die Hauptruine in thurn und taxisschen Besitz übergegangen, 1790 auch die zuvor hornsteinische Vorburg. Hans-Ulrich Simon datiert die Bussenbesteigung auf den 18. Mai. Vgl. Simon, Sp. 54. Der Brief, in dem Eduard vom Plan berichtet, wurde jedoch am 16. Mai in Mengen begonnen, wegen der Ausführung des Bussenplans am selben Tag unterbrochen und erst am 18. Mai in Scheer beendet. Vgl. H K G A 10, S. 2i6f. 101 H K G A 10, S. 216, Z. 3 1 bis S. 217, Z . 10. 20
Aber der Brief konnte auf der Mengener Post nicht fertig werden, weil auch Karl so seine spontanen Pläne verfolgte: Ο MERVEILLE! D a kommt mein Bruder zurückgefahren, im SonntagsRock und mit der Nachricht, er habe schnell den Entschluß gefaßt, an diesem schönen N a c h M i t t a g mit mir auf den Bussen, einen durch sein vortreffliches PANORAMA berühmten B e r g 1 0 2
zu gehen. So wenig das Prädikat idyllisch auf andere Lebensstationen Eduards passen will, etwa auf seine Amtszeit als Cleversulzbacher Pfarrer, - als Kennzeichnung der Zeit 1828 in Scheer mit den Brüdern Karl und Louis wäre es wohl angemessen. Karls Ehe schien unter der brüderlichen Lebensfreude nicht gelitten zu haben. Dorothea Mörike, der Eduard zum 23. Geburtstag das >Grüne HeftJesu benigne!< war dem Roman als »Musikbeilage« beigegeben. •'7 H K G A 1 1 , S. 330, Z. i j f f . r 8 ' Vgl. H K G A 1 1 , Anm. S. 699 zu S. 330, Z . 8f. sowie Simon, Sp. 81. Karl bewarb sich 1 8 3 $ zum zweiten Mal mit Empfehlung Eduards. Vgl. Simon, Sp. 88. 154
159
Mörike in Ochsenwang, S. 64. ° Mörike in Ochsenwang, S. 66. 161 Mörike in Ochsenwang, S. 29. l6
31
In einem Brief an Gustav Schwab bezeichnete er Karl und sich als künstlerisch-poetisches Gespann. 1 6 2 D o c h mit der brüderlichen Harmonie war es, seitdem die Rollen vertauscht erschienen, nicht mehr weit her. E r traute Karl (zurecht) keinen Einfluß im öffentlichen Leben mehr zu - etwa als dieser sich anbot, für Friedrich Theodor Vischer einen Verleger zu finden'6' - und vermutete gar, daß der König, seit meines Bruders Affaire dem Namen M. gehässig' 64 sei. Besonders Karls starrköpfige Bemühungen um Rehabilitation machten Eduard Sorgen. A n die Braut Luise Rau schrieb er am 9. Juni 1833: Karl wird uns in dieser Woche noch verlassen und seine Sache nach Kräften in STUTTGART persönlich] betreiben. Sein Schiksal nagt mir je länger je mehr an dem Herzen, zumal er sich von uns nicht rathen noch helfen läßt. [...] So viel ist gewiß, daß ich mich mit ihm in die Länge nicht mehr hätte vertragen können. (Behalte diß bei Dir.) 1 6 ' 1 8 3 3 1 6 6 wurde Karl Kanzleiassistent bei der Abgeordnetenkammer in Stuttgart, verließ die Stelle jedoch im April 1 8 3 4 aus unbekanntem Grund wieder. Im Juni entließ man ihn offiziell.' 6 7 Unmittelbar nach Eduards Einzug in Cleversulzbach nistete sich Karl bei ihm ein und betrieb von dort weitere Bewerbungsversuche. Außerdem komponierte er und schrieb die Komödie >Des Vaters Geburtstage.' 68 Bezeichnender-
162
16
H K G A 1 2 , S. 20, Z . 1 0 - 1 7 .
3 H K G A 1 1 , S. 282, Z. 30fr.
164
L6
H K G A 1 1 , S. 3 1 2 , Z . i8f.
S H K G A 12, S. 3 i , Z . 18-25. 166 Hans-Ulrich Simon nennt »Juli« als Eintrittstermin (Simon, Sp. 83), offensichtlich Klaus Dietrich Mörike folgend (vgl. Klaus Dietrich Mörike f i ] , S. 199). Bei Hanns Wolfgang Rath findet sich »Dezember«. Rath [2], S. 124. Die Historisch-Kritische Ausgabe nennt ebenfalls »Dezember«, Raths Angaben übernehmend. HKGA 12, Anm. S. 344 zu S. 38, Z. i6f. 167 Rath nennt hier »Juni« und spricht von »Entlassung«. Rath [2], S. 124. Die Historisch-Kritische Ausgabe sagt ebenfalls »Juni«. H K G A 12, Anm. S. 344 zu S. 38, Z. i6f. Bei Simon steht »April«; er folgt auch hier Klaus Dietrich Mörike, der das Fernbleiben auf April und die Entlassung auf Juni 1834 datiert, was insgesamt am schlüssigsten erscheint. Vgl. Klaus Dietrich Mörike [1], S. 199. 168 Am 24. Dezember 1834 reichte er beim Hoftheater das dem »königlichen] Hofschauspieler und Regisseur« Carl Seydelmann gewidmete Lustspiel >Des Vaters Geburtstag< ein. Es wurde, wie auch die Emilie Zumsteeg gewidmete >Arie auf den Geburtstag eines geliebten Vaters< 1838 gedruckt. Uber eine Aufführung des Stückes ist nichts bekannt. In der Widmung an Seydelmann heißt es: »Ein vornehmer und höchst gebildeter Engländer (Graf von
3*
weise wird darin ein gemeiner »Regierungskommissär« unschädlich gemacht. Auch Bestechung und Vetternwirtschaft werden ausführlich gegeißelt. Das selbstherrliche Treiben der Beamten erscheint als Possenspiel: Regierungskommissär (beklommen). Meine Amtsführung - ist aber - doch auch - ganz nicht tauglich - nicht ganz untauglich, wollte ich sagen - Sehen Eure Excellenz diese meine novissimas Vorschläge an, wie sie auf allgemeine Sicherheit und moralitam zielen - (Er stellt dem Minister einige Aktenstücke zu, und geht, während dieser sie liest, wieder unruhig umher). Minister (liest). »Vorschlag, zur bessern allgemeinen Sicherheit alle Flüsse und Bäche des Landes mit Pallisaden zu verzäunen und des Nachts mit Pechpfannen zu erleuchten - [ . . . ] Vorschlag, Schillers Werke im ganzen Lande zu verbieten, weil er darin das Stehlen empfiehlt« - Schiller empfiehlt das Stehlen? Wie so denn? Regierungskommissär. Es heißt ja in einem seiner Lieder: »Und wers nie gekonnt, der stehle!« 169 Damit hatte sich Karl als einstiger Verbesserungsoptimist mit schlechter Amtsführung selbst auf die Schippe genommen. Sein charakteristischer, von Eduard gerühmter Sprachwitz, geht in der Überlänge des Textes allerdings unter und übersteigt meist nicht die Ebene des Kalauers: v. Mirgern. »Das ist ein außerohrdentlicher Mensch« Philipp. Wieso? v. Mirgern. Seine Ohren fallen außer die Größe gewöhnlicher Menschenohren. 170 [•»] Philipp. Nicht wahr, Berlin liegt an der Spreu? Charlotte. An der Spree, wollen Sie sagen. 171 Biographische Lichter fallen auf Karls Zeit in Cleversulzbach und zeigen die dortige Präsenz Eduardscher Privatmythologie: Philipp. Lebt vielleicht in Berlin der sichere Mann, von dem ich hier im Hause schon aus einem Buche habe vorlesen hören? 172
169 170 171 172
Chesterfield) sagte einst zu seinem Sohne: »ich möchte nicht zu einer früheren Zeit gelebt haben, weil es damals noch keinen Garri[c]k gegeben hat;« - der Kunstfreund unserer Zeit aber darf sagen: »ich möchte nicht in einer früheren Zeit gelebt haben, weil Garri[c]k noch lange kein Seydelmann war, und möchte auch in keiner späteren Zeit leben, weil kein zweiter Seydelmann geboren werden wird.« Karl Mörike [2], S. Vllf. Karl Mörike [2], S. 95. Karl Mörike [2], S. 105. Karl Mörike [2], S. 106. Karl Mörike [2], S. 106. 33
Drei der Figuren, die Brüder Ornich, tragen Mörikesche Brüdernamen: August, Eduard und Karl; ihre künftige Stiefmutter, die weibliche Hauptfigur, heißt folgerichtig »Charlotte«. Das Cleversulzbacher Pfarrhaus in seiner Eigenschaft als letzter Wohnsitz von Schillers Mutter wird gebührend erwähnt. Einen Moment lang fallen die Figur »Eduard v. Ornich« und der leibhaftige Bruder Eduard in eins: Charlotte. Ich störe Sie doch nicht? Amatus. Ο nein; eine Schönheit entreißt mich der andern (er zeigt ihr das Buch), Schillers Gedichten. Kennen Sie sie? Charlotte. Wohl kenne ich sie; aber ich kenne noch Etwas, das Sie vielleicht noch nicht kennen - die Stätte, wo die Asche von Schillers Mutter ruht. Amatus. Wirklich? Charlotte. [...] Mir scheint es billig, auch das Andenken der so gemüthvollen Frau zu erneuern, die unsern Dichter erzog und mit Mutterhand die Saiten in seiner tiefsten Seele in den Wohlklang stimmte, der uns nun Alle entzückt. Deßwegen hat auch Eduard dafür gesorgt, daß dieses Grab, welches zweiund dreißig Jahre lang verlassen und fast ungekannt war, einstweilen wenigstens mit einer Trauerweide bezeichnet werde. 173 A m 27. Juli 1834 bat Karl beim König um die Erlaubnis, trotz rechtskräftiger Verurteilung wieder im Staatsdienst arbeiten zu dürfen. Das Gesuch wurde abgelehnt. Eine Bewerbung beim Innenminister um eine befristete Beschäftigung blieb erfolglos. Die Verwandtschaft machte Eduard Vorwürfe, weil er Karl im Pfarrhaus Asyl gewährte. Vom Rentamt in Scheer wurde regelrecht nach diesem gefahndet; doch schließlich verzichtete man auf die Eintreibung seiner Schulden, denn: Die Einziehung zu realisieren ist unmöglich. Der p. Mörike lebt eingezogener Nachrichten zufolge rein von der Unterstützung seiner Verwandten und sein gänzlicher Verfall ist notorisch. Das gehorsamste Rentamt darf ehrerbietigst voraussetzen, daß die traurige Zerrüttung des p. Mörike auch bei der Hochfürstl. Dom[änen]-Ob[er]-Adm[inistration] völlig bekannt sei und glaubt hierauf den unmaßgeblichen Antrag auf »Delierung« dieser Ersatzkosten begründen zu dürfen, als der p. Mörike die früheren amtlichen Aufforderungen unbeantwortet ließ, sein jetziger Aufenthaltsort unbekannt ist und die Correspondenz mit ihm nur Portoauslagen, nie aber eine Zahlung der Schuld herbeiführen konnte. 174
173 174
Karl Mörike [2], S. i4of. Klaus Dietrich Mörike [1], S. 200. 34
Trotz aller Bedrängnis versah Karl für Eduard weiterhin Korrekturarbeiten, beriet ihn bei der Zusammenarbeit mit dem Komponisten Ignaz Lachner und beurteilte dessen Komposition für die >RegenbrüderGedichte< erschienen 1838 bei Cotta. Vgl. H K G A 12, S. 271, Erschlossene Briefe 37. 181 H K G A 12, Anm. S. 403 zu S. 81, Z. 18-22. 176
35
Der Unterzeichnete sieht sich veranlaßt Folgendes zu erklären: die sogenannten verbrecherischen Umtriebe, deren ich bestraft wurde, hatten ihren Grund in einer gerechten Erbitterung, welche durch mehrere zu meinem Nachteile verübte ungerechte und parteiische Handlungen verschiedener zum Teil mir vorgesetzter Personen erregt wurde, in einer Erbitterung, die besonders dadurch aufs höchste gesteigert wurde, daß ich mit meinen dringenden Beschwerden, die ich von Instanz zu Instanz verfolgte, nirgends gehört wurde, und man mir, anstatt durch eine unparteiische Untersuchung auf offenem und geradem Wege eine Abhülfe herbeizuführen, nur durch die dritte Hand Winke und Ermahnungen zum Stillschweigen geben ließ. 182 E r fabulierte von einem »Geheimnis«, das er preisgeben werde, wenn man ihn nicht rehabilitiere: Ich habe mir einen Termin gesetzt, wenn ich innerhalb dessen nicht in meinen billigen Wünschen befriedigt werde, so lege ich die ganze Sache nebst den betreffenden Dokumenten einem Richter vor, welcher nicht gewohnt ist, parteiischen und pflichtvergessenen Beamten durch die Finger zu sehen; wogegen ich aber auf der andern Seite, wenn ich nur sehe, daß man den tätigen und eifrigen Willen mir zu helfen, hat, und wenn mir in Folge dessen die so nötige Hülfe wirklich zuteil geworden, gerne feierlich gelobe, jener Sache nicht mehr zu gedenken. 18 ' Es kam zu neuen Ermittlungen. Vom September 1 8 3 6 an befasste sich der Kriminalsenat wiederholt mit Karls Eingaben. A m 14. Juli 1 8 3 7 wurde er wegen fortgesetzter Erpressungsversuche und wegen fortgesetzter schwerer, theils verläumderischer, theils unbewiesener injuriöser Bezüchte und Schmähungen gegen mehrere Staatsbeamte, mit Rücksicht auf eine, wegen ähnlicher Vergehen früher entstandenen Strafe, zu einer sechsmonatigen Festungsstrafe und zur Bezahlung der Untersuchungskosten verurtheilt.' 84 Karl verbüßte die Strafe im folgenden Jahr (von M ä r z bis September 1838) im Ludwigsburger Arbeitshaus. Eduard sprach gegenüber Wilhelm Hartlaub im Mai 1838 vom »Familienunglück« der »Brüder«.' 8 ' E r mußte zur Tilgung von Karls Strafschulden neuerlich bei Verwandten um Geld betteln. ι8έ Im Kreis seiner Freunde machten böse Sprüche über
182
Rath [2], S. 124. Rath [2], S. 124. 184 Klaus Dietrich Mörike [1], S. 200. 18 5 H K G A 12, S. 191, Z. 19. 186 Klaus Dietrich Mörikes Angabe, August Fecht in Brettach hätte hierzu Geld gegeben, kann nicht richtig sein, da Fecht zum fraglichen Zeitpunkt 1838 bereits tot war (er starb 1837). 183
36
den »Amtmann« die Runde. David Friedrich Strauß etwa schrieb an Friedrich Theodor Vischer am 29. Juli 1838: D e r Amtmann hat Läuse, wie Kauffmann schreibt. E r ist nämlich im Arbeitshaus in Ludwigsburg als Festungsstrafgefangener. 1 8 7
Karls bitterer Weg war noch nicht zuende. Aus der Haft entlassen, fälschte er ein großväterliches Testament, um am Reichtum seines Großvetters Carl F. W. Mörike teilzuhaben - insbesondere am Ertrag der seit 1787 in Neuenstadt fabrizierten »Kaiserifich] privilegierten] Blutr[einigungs-]Pillen«. l8S Erneut wurde auch Eduard vorgeladen. An Wilhelm Hartlaub schrieb er am 24. Juni 1839: Wie verdrießlich uns Allen die Sache an sich, wie traurig diese Hinspannung für Jedes ist kann ich euch nicht ausdrücken! Mich ekelt Alles an, ich denke nichts u[nd] rede Nichts [ . . . ] . 1 8 9
Am 17. Januar 1840 wurde der seit einem Jahr bereits in Untersuchungshaft sitzende Karl wegen langen, fortgesetzten Versuchs einer Erpressung in hohem Betrage, verbunden mit Fälschung einer Privaturkunde, unter Einrechnung eines Teils des entstandenen Arrests zu einer Arbeitshausstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, neben Zuscheidung der H a f t - und Untersuchungskosten verurteilt. 1 ? 0
Trotz wiederholter Gnadengesuche mußte er die volle Strafe verbüßen. Die Lungentuberkulose, an der er seit seiner ersten Haftzeit litt, verschlimmerte sich nun drastisch. Verzweifelt, aber erfolglos versuchte Eduard, eine Verbesserung von Karls Verpflegung zu erreichen. Literarische Pläne, von denen Karl ausführlich an Ludwig Bauer schrieb, zerschlugen sich. 1 ' 1 Nach der Entlassung Ende Mai 1843 hielt sich Karl kurzzeitig in Cleversulzbach und Nürtingen auf, bevor er der Einladung eines ehemaligen Studienkameraden in die Schweiz folgte. Durch dessen Vermittlung wurde er 1845 Hauslehrer bei der Familie des Fabrikanten
187
Klaus Dietrich Mörike [1], S. 2 0 1 . Vgl. die Abbildung bei Klaus Dietrich Mörike [3] vor S. 1 4 5 . l8 » H K G A 1 3 , S. 56, Z . 1 9 ® . 188
191
Klaus Dietrich Mörike [1], S. 2 0 1 . L u d w i g Bauer schrieb am 4. April 1 8 4 1 an Eduard: »Dein Bruder Karl hat vorigen Herbst sehr ausführlich über ein schriftstellerisches Unternehmen an mich geschrieben. E r wollte die Bekehrungsgeschichte des dänischen Ministers Struensee [...] neu herausgeben [...].« Bauer, S. 97.
37
Clermont in Waghäusel bei Mannheim. 1 8 4 7 wieder stellenlos schrieb er einen sechsseitigen Bittbrief an den Fürsten von T h u m und Taxis, seinen ersten Arbeitgeber. 1 ' 2 Ohne Erfolg. Von Ostern 1 8 4 7 bis Anfang 1848 wohnte er bei Frau und Kindern zur Miete im einstigen Bezzenbergerschen Schloß, dann zog er zu Bruder Louis, der zu dieser Zeit - vollständige Umkehr der einstigen Konstellation - bereits thurn und taxisscher Verwalter auf Schloß Pürkelgut bei Regensburg war. E r vollendete seine >Maximen des MusikunterrichtsGedichteBilderbuch< hob Kerner hervor, daß sein »Glaube an die Existenz von Geistern nicht anererbt« sei. Kerner [5], S. 13. Nikolaus Gerber bezeugte, daß es eine Zeit gab, da Kerner noch nicht an Geister glaubte: »[...] so muß ich bemerken, daß ich Kerner in meinem ganzen Leben wenige Stunden gesehen habe, zu einer Zeit, in welcher er selbst noch nicht an Geistererscheinungen glaubte, und daß er daher auf mich nicht den mindesten Einfluß ausgeübt hat.« Gerber, S. $69. - Auf eine Stelle in einem Brief Kerners an Varnhagen von Ense 1837 hat Lee. B. Jennings hingewiesen (vgl. Jennings [2], S. 109): »Du schreibst von einer Geistergeschichte in Tübingen. Ich erinnere mich nicht, was das war. Damals [1804-1809; Anm. T.W.] glaubte ich an Geister grade so wie Du jetzt. Das heißt, ich fürchtete sie und glaubte nicht daran.« Geiger, S. 76.
49
Eine Freundin machte mir kürzlich Vorwürfe darüber, daß ich so dumm sey, und an Geister glaube. Ich erzählte ihr ein Paar Thatsachen und fragte sie, wie sie denn die Sache natürlich erklären wolle? » E y was! war ihre naive A n t wort, man denkt nicht darüber nach.« 4
Schadete es einem Dichter wirklich nicht, abergläubisch zu sein, wie Goethe behauptet hatte?' Harry Maync, der diese Maxime »lächelnd« für Mörike in Anspruch nehmen wollte/ hätte die zugehörige Reflexion aus den >Wanderjahren< mitbedenken sollen: D e r Aberglaube gehört zum Wesen des Menschen und flüchtet sich, w e n n man ihn ganz und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten Ecken und Winkel, von w o er auf einmal [...] wieder hervortritt. 7
Mörikes Geisterglaube wurde von der zeitgenössischen Kritik zur hindernden, genieaufzehrenden »Schrulle«8 erklärt, die ihn - im Verbund mit seiner Liebe fürs mythopoetische Detail der eigenen Kunstmärchen - an der Ausbildung »derberer poetischer Freß- und Verdauungswerkzeuge« 9 hinderte. Die Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts dagegen betrachtet die Spukmarotte, wenn's irgend geht, gar nicht erst oder schiebt sie dem nahe wohnenden Justinus Kerner in die - ohnehin vor Geistern überquellenden - Schuhe. Mörikes schriftliche Einlassungen ins Gespenstische werden für gewöhnlich als augenzwinkerndes Liebäugeln mit zeittypischen Okkultmoden oder als eines seiner »apokryphischen Wunder« abgetan.10 Das einschlägige Textmaterial deutet indes auf ein durchaus ernsthaftes »kritisches Interesse« am Spuk, wie bereits Lee B. Jennings ausgeführt hat. 11 Versucht man Mörikes Geisterglauben zu ignorieren, so starrt er umso unvermuteter wieder aus Werk und Briefwechsel heraus und erschwert das Textverständnis. Eine interpretierende Chronik der Beziehung zwischen Mörike und Kerner soll zur Ausleuchtung des Cleversulzbacher Geisterhorizonts
4 Gerber, S. 568. 5
6 7 8 9 10 11
Vgl. Goethe, S. 2 1 : »Der Aberglaube ist die Poesie des Lebens, deßwegen schadet's dem Dichter nicht abergläubisch zu seyn.« V g l . ebd., S. 358: » D e r Aberglaube ist die Poesie des Lebens [...]« sowie: » D e m Poeten schadet der Aberglaube nicht [...].« M a y n c [2], S. 204. Goethe, S. 42. Briefwechsel mit Viseber, S. 148. Strauß, S. 246. Brief von Strauß an Vischer am 1 5 . M ä r z 1 8 3 8 . Zit. nach Prawer, S. 1 5 . Vgl. Jennings [ i ] , S . 72-86.
50
beitragen. Eingangs möchte ich auf die Stellung der Philosophen zur Geisterfrage und auf Kerners Stellung zur Philosophie eingehen. Man erwarte jedoch keine parapsychologische Bewertung des Pfarrhausspuks. Die Phänomene spontaner wiederkehrender Psychokinese (i.e. Spuk) werden hier so genommen, wie sie vorliegen - als Textereignisse und biographisch-werkgeschichtliche Anhaltspunkte. OttoJoachim Grüssers Vermutung, die Erscheinungen seien bloße »Parästhesien« gewesen, die von Mörikes Krankheiten oder von seiner perennierenden Hypersensibilität gegen lebensweltliche Unbilden herrührten, erscheint mir mit Eberhard Bauer 12 nicht haltbar. Die »Tatsachen« waren nicht an Mörike allein gebunden, sondern wurden zwischen 1780 und 1840 von zahlreichen namentlich bekannten Personen beobachtet.
Philosophie, Geister und Kerner Harry Maync betont die »mystische«, den Geisterglauben fördernde Wirkung, die Schellings Naturphilosophie in der Restaurationszeit ausübte. 1 ' Im Text der »Stuttgarter Privatvorlesungen< (1810) finden sich in der Tat höchst interessante Überlegungen zur Geisterkunde - etwa daß der Mensch nach dem Tod in einer »reductio ad essentiam« auf sein eigenes (mehr böses als gutes) »a2« zurückgeführt werde, welchselbiges »a2« eben das sei, was wir in der Volkssprache (und hier gilt es eigentlich: vox populi vox Dei) nicht den Geist, sondern einen Geist nennen.'4
Schellings zugrunde gelegte Annahme einer organischen Wechselwirkung zwischen menschlichem Geist und beseelter Natur geht allerdings auf den fünften Teil von Spinozas >Ethik< zurück: Der menschliche Geist kann mit dem Körper nicht absolut zerstört werden, sondern es bleibt von ihm etwas übrig, was ewig ist. 1 '
12 13 14
15
Grüsser, S. 288. - Bauer, S. 333. Maync [2], S. 202. Stuttgarter Privatvorlesungen, Kapitel: »Gedanken über eine Philosophie der Geisterwelt«. In: Schelling, S. 88. - Frei, S. 21: »[D]er ältere Schelling spricht wie ein Eingeweihter. E r nimmt einen feinstofflichen Körper an, den Sitz der Ahnungen und des Hellsehens; er überdauert den Tod des physischen Körpers, wird aber scharf vom Geist geschieden.« Spinoza, S. 314.
51
Die christliche Tradition dieser Vorstellung (von Jakob B ö h m e ' 6 zurückreichend bis in biblische Quellregionen 1 7 ) ist vollends nur der europäische Strang einer uralten polyethnischen Mythologie. Für den G e danken vom Fortleben (Palingenesie, Wiederverkörperung) und von der Wirksamkeit des essentifizierten Menschen nach dem Tod einen Prototext angeben zu wollen, wäre eine undankbare Lebensaufgabe. Max Dessoir hat die magischen Wurzeln idealistischen Denkens in der orientalischen Mystik aufgezeigt und den (bis zu einem nicht geringen Grade auch polemischen) Nachweis geführt, daß der Gedankenkreis aller Geheimwissenschaften (samt spiritistischen Vorstellungen) sich mit ursprünglichen Versuchen zu einer idealistischen Weltanschauung deckt.' 8
Die Affinität des deutschen Idealismus zum Geisterthema hängt mit der immerwährenden Virulenz des Leib-Seele-Problems zusammen: Ist die Leib-Materie (physis) mit der Geist-Seele (psyche) durch Dreh- und Angelpunkte verbunden, und wenn ja, wie sieht das Wirkungsmodell dieser alles entscheidenden Verbindung aus? Nicht umsonst kreisen Kants Geistertheoreme in auffälliger emotionaler Ambivalenz'? um das Problem der räumlichen Existenz der Seele. Gibt es »einfache Substanzen oder Wesen, die sogar in einem von Materie erfüllten Räume gegenwärtig sein können« - Wesen also, welche die Eigenschaft der Undurchdringlichkeit nicht an sich haben, und deren so viele, als man auch will, vereinigt niemals ein solides Ganzes ausmachen? 2 0
Nach vergeblichem Bemühen, die Unmöglichkeit der Gespenster kritisch einwandfrei darzutun, wandte sich Kant lieber der poetischen
16
Jakob Böhme: N e u e Wiedergeburt. In: Sloterdijk/Macho, B d . 2, S. 7 8 1 . Böhmes Gedanken wurden fortgesponnen von Friedrich Christoph Oetinger: Vier Stufen der Wiedergeburt. In: Sloterdijk/Macho, Bd. 2, S. 782f. '7 Paulus 2. Kor. 3, 18. 18 19
zo
Dessoir, S. 264. Liliane Weissberg beschreibt Kants zwiespältige Haltung in den Träumen eines Geistersehers als ein H i n - und Hergerissenwerden von der »Liebe zur Metaphysik« und der Suche nach »Respektabilität« f ü r die Philosophie als Wissenschaft und für sich als Philosoph. V g l . Weissberg, S. }Seherin< widmete er Johann Friedrich von Meyer. 33 Vgl. Theobald Kerner, Bd. 2, S. 1 1 . - Kerner lernte Brentano 1841 in München kennen und erhielt von ihm eine Locke der entrückten Dülmener Nonne Katharina Emmerick. Vgl. Fröschle, S. 82. - A m 23. März 1842 traf Kerner Schubert, Brentano, Görres und den geisterliebenden bayerischen Kronprinzen in München. 34 Kerner [1], Erster Theil, S. 10. Der Untertitel dieser Kernerschrift machte verschiedentlich Probleme: Im Katalog Kerner Uhland Mörike des Schillernationalmuseums (Bergold/Salchow/Scheffler, S. 1 1 2 ) steht »Hereintragen«, bei Bernhard Zeller: Das Kernerhaus und seine Welt (Schott, S. 123) dagegen »Geisteswelt«. - »Kurz: es gibt ein inneres Schauen, welches nicht durch die äußeren Sinne vermittelt ist, und ein diesem inneren Schauen entsprechendes inneres Tun (Wirken ad extra), welches ebensowenig durch das äußere Tun vermittelt ist.« Baader, S. 62. 55 Fröschle, S. 84. i6 Schopenhauer, S. 325, Z. 38 und S. 326, Z. 1. 32
55
Friedrich Strauß 37 reduzierten in böswilliger Ausdeutung der Subjektivitätsthese das Phänomen der Spektralsichtigkeit auf psychische Anomalie: Kerners Seherin und die Geistergläubigen insgesamt galten ihnen als seelisch »Kranke«.' 8 Adolf Carl August Eschenmayer 3 ' verdankte Kerner wesentliche Impulse bei seiner Beschäftigung mit Mesmerismus und »thierischem Magnetismus«. Eschenmayers Wendung der »Athertheorie« -
eine
Frühform des von Parapsychologen angenommenen »feinstofflichen« Okkultfluidums - verband Kerner mit den Aussagen der Seherin zur
37
38
39
»[...] die Mittheilungen Kerners [über die »Seherin«; Anm. T.W.] sind für den Arzt, den Philosophen, überhaupt für jeden, dem die Kenntniß der menschlichen Natur nach ihren verborgenen Tiefen angelegen ist, von dem höchsten Belange; es bleibt ohne dieselben eine Reihe der Krankheitszustände des Menschen in den wichtigsten Punkten lückenhaft; [...]« Strauß zit. nach Gerber, S. 497. Carus, S. 334: »XVII. Vorlesung. [...] Gespensterfurcht gleich Furcht des Menschen vor sich selbst und seiner kranken Phantasie [...]«; Carus, S. 339f.: »[...] auf diese Weise hatte die Kranke des Dr. Kerner ihre Erscheinungen, und Beide glaubten auf das Festeste an die Wirklichkeit und Objectivität einer Wahrnehmung, welche doch nur subjectiver Natur sein konnte.« - Die Tendenz zur ganzheitlichen Weltsicht führte Carus nahe an die moderne psychologische Skalentheorie der psychischen Erregungszustände heran (Roland-Fischer-Modell, vgl. Navratil, S. 50): »[...] sodann aber werden wir auch in diesen, doch immer einigermaßen kranken Seelenäußerungen [...] einen deutlichen Uebergang gewahr zu den erhabensten Richtungen des menschlichen Gemüthes, welche im Dichter und Künstler als Genialität bezeichnet zu werden pflegt.« Carus, S. 339. - Eschenmayer hat diese Erregungsskala der menschlichen Seele im empirischen Teil seiner 1 8 1 7 erschienenen Psychologie (§ 278: »Was ist erhöhte Einbildungskraft?«) noch deutlicher vorgebildet: S. 257: »In unserem gewöhnlichen Bewußtseyn, in dem sich Gedanke, Gefühl und Handlung zu jedem Product vereinigen, kommt das Gesez nie selbst, sondern nur die Anwendung desselben auf die objective Welt zur Erkenntniß, wodurch bestimmte Begriffe, bestimmte Gefühle, bestimmte Entschlüsse erzeugt werden. Im aussergewöhnlichen Zustande hingegen, in welchem irgend eine plastische Kraft die Vermögen der Seele erhöht, tritt das Gesez selbst heraus, und dann entsteht nicht eine reflectirte, durch diskursive Begriffe, sondern durch Intuition vermittelte Erkenntniß.« Eschenmayer, S. 257. Exakt diesem höheren »clairvoyance«-Zustand der »Seele«, etwa vergleichbar dem ergotrophen Stadium »aroused« bis »hyperaroused« bei Roland-Fischer (vgl. Navratil, S. 50), entspricht Peirces Erkenntnisform der »Abduction«. Vgl. Peirce, S. 240-287. Adolf Carl August Eschenmayer (1768-1852), Karlsschüler, praktischer Arzt in Kirchheim, Oberamtsarzt in Sulz, ab 1800 herzoglicher Leibarzt in Kirchheim, ab 18x1 an der Universität Tübingen; dort von 1818 bis 1836 Ordinarius für Medizin und Philosophie. Mitbegründer des Archivs für den
56
Nervengeisttheorie. 40 Eschenmayer suchte sittliches und schönes E m p finden an das normale, durch die ätherische Geistergemeinschaft jedem Menschen innewohnende »Selbstgefühl« zu koppeln und so eine natürliche, allgemeine Fundierung von Ästhetik und Morallehre zu bewerkstelligen.41 Besonders imponierte Kerner, daß Eschenmayer nicht bloß mit allen Kenntnissen des Arztes ausgerüstet ist, sondern zugleich auch als einer der vorzüglichsten Philosophen unsrer Zeit bekannt wurde, und mit der Tiefe des Denkens auch den heiligen Glauben an Christum treu bewahrt. 42 In dem Beitrag >Mysterien aus dem innern Leben, erläutert durch die Geschichte der Seherin von Prevorst< nahm Eschenmayer Kerners Werk vor der Kritik in Schutz. Ein weiterer Anreger und Berater Kerners in magnetischer Hinsicht war Johann Carl Passavant, 4 ' dessen Hauptwerk Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hellsehen« ( 1 8 2 1 ) Johann Friedrich von Meyer in den »Blättern aus Prevorst< rezensierte. 44 1840 erschien Nikolaus Gerbers Buch >Das Nachtgebiet der Natur im Verhältniß zur Wissenschaft, zur Aufklärung und zum Christenthums in dem Kerners Protoparapsychologie ebenfalls nachdrücklich verteidigt wurde. Kerner schickte Gerber zum Abdruck ein Gedicht, das an seine philosophischen Kritiker adressiert war und »bedankte«
thierischen Magnetismus. - Nach Peter Krummes Interpretation im Nachwort seiner Ausgabe der >Psychologie< war Eschenmayer jener Philosoph, dessen Kolleg der Hauffsche Satan in Tübingen als erstes besuchte. Vgl. Eschenmayer, S. 279t. und Hauff, Bd. 3, S. 49-56. 4 ° Eine Zusammenfassung der Ätherhypothese, die bereits bei den Ägyptern belegbar ist (das »Ka«) und neuplatonisches Gemeingut war (Plotin, Porphyrius, Jamblichus), gibt Gebhard Frei im Kapitel »Der Doppelgänger und das Problem des Feinstofflichen«. Vgl. Frei, S. 77-87. - Zu Eschenmayers Wirkung auf Kerners Nervengeisttheorie vgl. das Kapitel »Justinus Kerner und die feinstoffliche Konstitution des Menschen« bei Olaf Räderer. Räderer, S. i 3 f . 41 Eschenmayer, S. 289-408. 42 Fröschle, S. 84. 43 Johann Carl Passavant (1790-1854), Arzt und Ireniker (d.h. ein um friedliche Beilegung des Konfessionszwists Bemühter) in Frankfurt am Main. Freund des Regensburger Bischofs Johann Michael Sailer (1751-1832), der als Pädagoge und Theologe u. a. mit Savigny und Brentano in Kontakt stand. Auch der Breslauer Fürstbischof Melchior von Diepenbrock (1798-1853) und Josef von Görres waren mit Kerner befreundet. 44 Fröschle, S. 84. 57
sich zugleich im >Magikon< f ü r Gerbers »Mühe« mit der Widerlegung und für sein »gesundes, richtiges Auge«: Was sie als meinen. Nasen kluger Philosophen Ο wie fein ihr ausgewittert Daß der Hölle Feuerofen Und die Geister mich zersplittert; Daß ich irre, schmerzzerissen Durch die Flur ein armer Greiner, Wie von einer Katz gebissen, Die man magisch trieb aus Einer. Daß ich sehne mich vergebens In den Jubel sonn'ger Tage, Aus der Nacht des Geisterlebens, Daher meines Liedes Klage. Feine philosoph'sche Nasen! Schmerz ist Grundton meines Herzens Von Natur ihm eingeblasen, Schmerz der Grund selbst seines Scherzens. Jener Schmerzenslieder viele, Hat der Knabe schon gesungen, Die ihr in der Geisterschwüle Meines Herzens meint entsprungen. Was ich schau' im Geisterreiche, Kann mich nicht zur Klage stimmen Das Gespenst, das ernste, bleiche, Macht nur dem, der's nicht glaubt, Grimmen. Schmerzlicher als irre Schatten Sind mir irre Menschenbengel, Die, weil h i e r Verstand sie hatten, Glauben d o r t sich flugs als Engel. Liegt mein Körper eine Leiche, Ist mein Geist noch nicht am Ziele, Denn in meines Vaters Reiche, Sind der Wohnungen gar viele. Einst aus Vaters Hand will nehmen Ich mein Loos demüthig, stille, Schweb' ich auch mit irren Schemen Vater es gescheh' dein Wille! Gottes Liebe tief im Busen Lieb' ich, die er schuf, die Erde,
58
Lieb' ich Liebe, Wein und Musen, Bis ich Geist bei Geistern werde. 4 '
Kerners Interesse am »thierischen Magnetismus« und Mesmerismus und seine Uberzeugung vom Geisterreich wuchsen nicht auf einem akademischen, philosophisch-naturwissenschaftlichen Studienweg, auch wenn man seine medizinischen Anfänge gern zum Bürgen einer lebenslangen aufgeklärten Objektivität machen möchte.46 Max Dessoirs Einschätzung der hartnäckigen Verquickung widerstreitender Impulse bei Kerner ist eher zu trauen: Seine poetische Einbildungskraft und sein religionsphilosophischer Glaube spielen immerfort in die Aufnahme des Tatbestandes hinein; vergebens hat er versucht, den Dichter und Mystiker in sich von dem Naturforscher loszulösen. Freilich liegt diese Verschmelzung so verborgen, daß selbst die Gegner der ganzen Richtung ihrer nicht gewahr wurden. 47
Kerners angeborener »Schmerzenston« fand im Seherton der Frau Hauffe nur eine von mehreren Verstärkungsmöglichkeiten. Auch die unterländischen Weingeister - »Nervenstimmer« für Kerner wie für den geisterseligen Jean Paul das Bayreuther Bier - waren wohl kaum mehr als amplifikatorische Akzidenzien seines musischen Ichs. Tiefe Religiosität beanspruchte die Zentralgewalt über Kerners Naturbetrachtung und Einbildungskraft. Dabei hielt sich Kerner wie Goethe frei von jeder konfessionellen Beengung; er war eine viel zu freie Persönlichkeit, um Kirchgänger zu sein.48 Jakob Burckhardt nannte die Poesie in seinen 1870/71 gehaltenen Vorlesungen >Uber das Studium der Geschichte< rundheraus ein »Organ der Religion« und führte als herausragendes geschichtliches Beispiel für ihre rein kultische Bedeutung die skandinavische >Wöluspa< (Rede der Wöle = Offenbarung der Seherin) 4 ' an. Ohne philologische Evidenz zu besitzen, kann diese Definition doch allemal zur Echtheitsprüfung der biedermeierlichen Gespensteroffenbarungstexte dienen. Im Falle 45
Kerner [3], Jg. 1, Heft 1, S. XII. - Gedicht zit. nach Gerber, S. 49 jf. Vgl. etwa Bonin, S. 461. Kerner wird dort als Naturwissenschaftler und »philosophischer Anthropologe« bezeichnet. 47 Dessoir, S. 107. 48 Bock, S. i72f. Vgl. auch Kerners >Albumblatt< vom 7. September 1859: »Weiß nicht woher ich bin gekommen / Weiß nicht wohin ich werd' genommen, / Doch weiß ich fest: daß ob mir ist / Eine Liebe die mich nicht vergißt!« Kauifmann, S. 132. 4 ? Burckhardt, S. 70. 46
59
Kerner/Haufies, Brentano/Emmericks, Blumhardt/Dittus' und Oberlins zeigte sich ein Hereinragen der unbändigen echten Romantik in die gesitteten, schauersüchtigen Zirkel der literarischen Pseudoromantik wie etwa Johann August Apels »Gespenstertees« in Leipzig. In Weinsberg, Dülmen, Möttlingen und im Steintal wurde nicht wohlig geschaudert, sondern gläubig das Okkulte erfahren. Ein magischer, protophilosophischer Idealismus suchte sich im Geister-, Dämonen- und Wahrtraumhorizont poetische Ausdrucksformen wie zuvor (zu kernromantischer Zeit) im Bergwesen von Novalis. Das romantisch-christliche - recht eigentlich: romantisch-katholische - Element des restaurationszeitlichen Geisterglaubens (denn nur die katholischen Toten durchlaufen die Seelenwaschanlage des Purgatoriums, während die Protestanten im allgemeinen' 0 direkt in ihre Endorte auf- bzw. abfahren) fand sich bei Jung-Stilling (>Theorie der GeisterkundeGeisterkunde< gelesen und dabei »Gespensterschauer und schwere Verstörungen« erlebt.' 3 Auch im Pietismus gibt es teilweise die Lehre vom Zwischenzustand. »Wenn sogar Stilling und Andere eigenthümliche theologische Ansichten haben, welche an den Pietismus hinstreifen, (was jedoch Stilling ausdrücklich ablehnt und gegen die Pietisten streitet), so gründet er dies auf seine Bibelauslegung und andere Gründe, nie aber auf die Aussprüche dieser Somnambülen oder Geister, welche im Gegentheil nur deßwegen einen Werth für ihn haben, weil seine Bibellehre sich dadurch bestätigt findet.« Gerber, S. 583. ' 2 Kerner [5], S. 252!. und S. 229: »Ich glaubte an keine Vernichtung nach dem Tode, sondern an eine pythagoreische Seelenwanderung, die sich mir auch auf die Tiere, da ich sie so sehr liebte, erstreckte. Meine Beobachtung der Verwandlung der Insekten und das Lesen der Schriften dieser alten Philosophen brachte mich darauf.« '3 Wilpert, S. 2 59. 51
60
Jung-Stilling glaubte fest an die reale Wirksamkeit von Schutz- und Schadensgeistern, die den Menschen begleiten, aber auch an das irrtümliche Erscheinen von Abgeschiedenen, die noch nicht im ewigen Höllenfeuer braten bzw. im Zustand der vollendeten Seligkeit frohlocken. Jung-Stillings Abhandlung war daher die eines Gespenstertherapeuten. Vor dem Tod »hat man sein Sach zu bestellen« und darf nichts vergessen, denn Rückkehr, und Erscheinung ist gegen die Ordnung Gottes. Indessen kann es auch Ausnahmen von der Regel geben. F ü r denjenigen dem ein Geist erscheint, ist es unnachlässige Pflicht, ein solches Wesen mit Ernst und Liebe zu behandeln, und zurecht zu weisen. 5 4
Kerners Bild des Geisterreichs, im Gedicht >Was sie als meinen< getreulich abgespiegelt, trug stark Jung-Stillingsche Züge. In Befolgung der apostolischen Selektionsempfehlung (i. Joh. 4, i) prüfte er die »philosophischen Nasen« und erkannte sie als die falschen Propheten. Diese »irren Menschenbengel« wünschte er fortan in »der Hölle Feuerofen«. Der biblische Johannes hatte an Timotheus geschrieben, daß in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abtreten und verführerischen Geistern beziehungsweise Lehren der Dämonen anhangen würden (1. Tim. 2 1 , 1 ) . In Kerners Hochzeitscarmen für seinen ungleichen Freund David Friedrich Strauß, das sich in einer Abschrift Mörikes erhalten hat, liest man: Bei der Hochzeit eines Ungläubigen Sein Glaube kommt dem Ehestand ganz zu gut; Denn ist es, w i e er wähnet, nichts mit Drüben, Wenn nach dem Tode alles Lieben ruht, So muß man hier für Ewigkeiten lieben. [...] N u r was das H e r z fühlt, H e r z ! das ist das W a h r e . "
Die offenbare Opposition in Geisterfragen duldete Kerner gezwungenermaßen, weil die Seherin selbst ihm attestiert hatte, daß Straußens allseits' 6 ob seiner >Lebensgeschichte Jesu< angezweifelter Christenglaube
"
Jung-Stilling, S. 348 (§ 42). Kerner [4], S. ioof. Eine das vorurteilsbehaftete Bild v o n Strauß korrigierende Schilderung gibt E m m a von Suckow, die Strauß bei Kerner in Weinsberg begegnete, in ihren >Reisescenen in Bayern, Tyrol und Schwabens Nindorf, S. 25 6ff.
62
»nie z u m U n g l a u b e n w e r d e n k ö n n e « . K e r n e r blieb j e d o c h skeptisch. G e g e n ü b e r v o n M e y e r v e r w u n d e r t e er sich: Sein [i. e. Strauß'; Anm. T. W.] Glaube an magnetische Wunder und sein Unglaube an die biblischen ist unbegreiflichf.] 57 Strauß indes nutzte den kuriosen Seherinnenspruch später o f t , u m K e r ner z u »schrauben«: Entweder also, halte ich ihm nun entgegen, bin ich auch jetzt noch nicht ungläubig; oder wenn dies, so ist Ihre Seherin eine falsche Prophetin gewesen.' 8 D i e Inkarnation des doppelt, also s o w o h l in religiöser w i e in o k k u l t e r Hinsicht »Ungläubigen« w a r f ü r K e r n e r der »kalte«, uninspirierte N a turwissenschaftler. D i e Irrlehren sah der ganzheitlich agierende K e r n e r mit zunehmendem A l t e r immer deutlicher v o n denjenigen verbreitet, welche, eingeschlossen in die isolierende Glastafel (tabula vitrea) ihres Schädels, keine Ahnung von einer Sympathie der Dinge und einem höhern Geisterleben haben, denen alles Geistige, was nicht an ihrer kalten Gehirnwand sogleich in palpablen" Tropfen sich sublimirt, Trug und Lüge ist 6 ° - mit anderen Worten: v o n den bornierten » A u f k l ä r l i n g e n « , » G l a s k ö p fen« u n d »blinden W i d e r s p r e c h e r n « / 1 M i t diesem antiaufklärerischen Pathos f o l g t e K e r n e r ebenfalls J u n g - S t i l l i n g , der gegen E n d e seiner >Theorie der Geisterkunde< ( 1 8 0 8 ) geschrieben hatte:
57 Fröschle, S. 85. 58 Strauß zit. nach Gerber, S. 486. Weitere Anekdoten zum ungläubigen Strauß in: Scheuffelen/Dambacher/Dieke, S. 204. 59 »palpabel«: (medizinisch) tast-, fühl-, greifbar. Justinus Kerner: Geschichte zweier Somnambülen. Zit. nach Kerner [3], Jg. 1, Heft 2 (1840), S. 147: >Ein Wort der Wahrheit zur Beherzigung gegen Wolfgang Menzels Kritik des MagikonReiseschattenPoetischen Almanach für das Jahr i8i2< und im >Dichterwald< von 1 8 1 3 enthaltenen Gedichte Kerners. O b Mörike die bis dahin erschienenen medizinischen Schriften über Wurst- und Fettgift zur Kenntnis genommen hatte oder die 1824 publizierte >Geschichte zweyer Somnambülen nebst einigen anderen Denkwürdigkeiten aus dem Gebiete der magischen Heilkunde und der Psychologies ist nicht zu ermitteln. 68
62
Jung-Stilling, S . 3 J i ( § $2). Vgl. den Brief an Luise Rau vom 10. November 1 8 3 1 . H K G A 1 1 , S. 226, Z. 19L Mörikes Begehung der Ruine muß vor 1824 stattgefunden haben, da die von Kerner gestifteten Äolsharfen noch nicht sieht- bzw. hörbar waren. 64 Vgl. Simon, Sp. 38. 6 ' Vgl. H K G A 10, S. 78, Z. 25. 66 H K G A io, S. 65. 67 Brief an Luise Rau vom 26. November j 829. Mörike schickte ihr ein Gedicht aus Kerners >Reiseschatten H K G A 10, S. 136, Z. 9. 76 H K G A 10, S. 136, Z. i8ff. - H K G A 10, S. 136, Z. 2 7 ff. 77 In einem Brief an die Schwester Luise vom Januar 1827 deutet er diesbezügliche Besorgnis an. »[...] auch berührte ich den Verdacht der Phantasterey in dem ich vielleicht stehe [...]« H K G A 10, S. 143, Z. 2. Mörikes Freund Wilhelm Nast war Ende 1826 aus dem Stift ausgebrochen.
66
Brief zu schicken (»eine ganz andere als eine Kranken-Stimme« 7 8 ), wenn ihn am Ende nicht doch zu große Schüchternheit davon abgehalten hätte.?' Bey Gelegenheit Ihrer neugesammelten Gedichte, regte sich bei mir der alte Wein, dessen in dem Liede auf Herrn Lfudwig] Uhlands Herzog Ernst gedacht ist; denn diß war das lezte meiner tübinger Jahre, von denen Ihre Schriften ein eigenthümliches und unzertrennliches Ingrediens für mich und meine Freunde gewesen sind. 8 °
Mörike nahm sich ernsthaft vor, anläßlich einer Reise zu Ludwig Bauer auch Kerner zu besuchen. Aber die Pläne zerschlugen sich, u. a. weil die Krankheit der Schwester Luise sich verschlimmerte und die Mutter einen Kutschunfall hatte. An Johannes Mährlen schrieb er: Den guten Pfarrer in Ernsbach [i. e. Ludwig Bauer; Anm. T. W.] konnte ich nicht besuchen. Gott weiß, daß ich es ernstlich entschlossen war. 8 '
Gegenüber Mährlen verlor Mörike von Kerner noch kein Wort. Ein halbes Jahr später ergab sich dann durch die tödliche Krankheit der Mutter Mährlens eine neuerliche Kontaktmöglichkeit. Mährlen bat den Freund - nichts von Mörikes früheren Briefen an Kerner wissend - , an das Weinsberger Orakel zu schreiben. Ein Vorfühlen von David Friedrich Strauß bei Kerner, durch Mörike für Mährlen eingeleitet, war vorausgegangen. Über die Hintergründe zu dieser Mehreckkonstruktion ist mangels Briefen nichts bekannt. Sie scheint mir aber nur so erklärbar, daß Mörike sich sträubte, wieder einen »Krankenbrief« an den »Doktor« Kerner zu schicken. Aus der erhaltenen Korrespondenz erhellt nur, daß Mörike nach dem offensichtlich wenig sachdienlichen Schreiben von Strauß am ι. September sich endlich breitschlagen ließ, wieder mit einem Anliegen vorstellig zu werden. »Dringend« hatte Mährlen den widerstrebenden Mörike gebeten, seine Bedenklichkeiten endlich hintanzustellen: da aber die N o t h drängt und meine Schwestern in dem vor mir liegenden Brief mich inständig bitten, mit dem Besprochenen nicht zu säumen, glaube ich die MenschenLiebe des HE. D. Kerner leide es gewiß, daß man sich ihm
78 HKGA io, S. 136, Z. 31. 7? HKGA 10, S. 136, Z. }2f. 8 0 HKGA 10, S. 136, Z. 3 3 f. und S. 137, Z. 1-4. 81 HKGA 10, S. 138, Z.2f.
67
unangemeldet naht, besonders, wenn D u , wie ich Dich dringend bitte, Innliegendes mit einem Schreiben begleiten würdest, mich entschuldigend, daß es mir unmöglich geweßen, im Augenblick der Abreise selbst zu schreiben. Thus also, und laß mich in der Hoffnung gehen, daß meiner leidenden Mutter noch Trost und H ü l f e zu Theil werden könne. 8 2
Indem Mörike die hastige Mitteilung Mährlens, der diesmal keine Zeit für den Umweg Mörike - Strauß - Kerner mehr zu haben glaubte und überstürzt von seinem Vikariatsort Zell nach dem elterlichen Wohnort Ulm abreiste, zitatweise in die »gehorsame« Anfrage einbettete, gab er Kerner zu verstehen, daß nicht er es war, der ihn belästigen wollte, und daß es erst triftiger Gründe bedurft hatte, ihn zu einer neuerlichen Anfrage in Krankheitsdingen zu überreden. Doch selbst als Mittelsmann hatte er noch Furcht, das Ansuchen könnte ihm - dem Boten - übel angerechnet werden. Durch eine geradezu beschwörende Formel wollte er Unheil von seiner eigenen, so quälend angebahnten Beziehung zu dem Geistesverwandten ablenken. Eine doppelte Anrede unterstreicht die Bewußtheit dieser Vorsicht: Verehrtester H e r r Doktor! Mit vieler Schüchternheit nehme ich mir die Freyheit, wieder bittweise an Sie zu schreiben [...]. / Bester Herr Doctor! daß ich doch ja nicht Gefahr laufe, durch mein Ansuchen im Geringsten Ihr Zartgefühl in einer Sache zu beleidigen oder verlegen zu machen, bey der Sie, wie ich wohl weiß, nicht einmal immer blos von Ihrer Menschenfreundlichkeit abhängen. 8 '
Die bei Kerner in Behandlung befindliche Friederike Häufle (über deren Anwesenheit und fernheilende Fähigkeiten man in Tübingen gerüchteweise Bescheid wußte 8 4 ) sollte, so der Plan Mährlens, Mörikes und Strauß', anhand eines mitgesandten Bandes die Krankheit der Mutter näher bestimmen und eventuelle Heilungschancen angeben. Der Versuch schlug fehl. Anne Katherina Mährlen war bereits gestorben, bevor Mörikes Brief abging - die Seherin bekam nach dem Kontakt mit dem Band einen Erbrechensanfall, lag »wie eine Leiche« da und konnte nur mit Lorbeerblättern, einer Salbe aus Olivenöl, gelbem Wachs, Terpen-
82 8
3
84
H K G A 10, S. 1 7 0 , Z . 2 4 - 3 3 . H K G A 10, S. 170, Z . 7 - 1 4 . L u d w i g Uhland schrieb an Kerner am 20. M ä r z 1 8 2 7 : » N u n , man erzählt ja Wunderdinge von Deiner neuen magnetischen Patientin?« Theobald Kerner, Bd. 2, S. 565.
68
tinöl sowie Kamillentee ins Leben zurückgerufen werden. 8 ' Wiewohl Mörike sich Hoffnung machte, selbst von Kerner »Resolution« zu erhalten,86 schickte dieser die Botschaft über den katastrophalen Ausgang des Ferndiagnoseexperiments an Strauß. Mörike ließ er bloß grüßen, mit deutlichem Hinweis auf die Unmöglichkeit und Unwilligkeit zu weiterer Aktivität hinsichtlich Krankheitsanfragen an die Seherin.87 Das Interesse Mörikes an Kerners Dichtung war trotz dieser neuen Peinlichkeit ungebrochen; er bat Friedrich Theodor Vischer, ihm »auch etwas vom Justinus« zu schreiben, von dem er »köstliche Gedichte« in Wendts >Musenalmanach< »angetroffen« habe.88 Kerners >SeherinReiseschattenTaschenbuch ohne Jahresschild< zu bitten, aber es geschah nichts dergleichen.8' Noch immer wollte er zu Kerner reisen,90 unterließ es aber auch in der Zeit seiner Beurlaubung (nach den Vikariaten in Köngen und Nürtingen). Vollends verwunderlich wird die Verschleppung dieses Besuchs vom Jahr 1831 an. Friedrich Theodor Vischer hatte Kerner besucht, ihm von dem Begabten erzählt und überbrachte Mörike am 28. Januar 1831 die Freudenbotschaft: A l s ich kürzlich in Weinsberg war, hat Kerner 1 große Sehnsucht nach D i r ausgesprochen].' 1
85
H K G A 10, S. 1 7 7 , Z . ü f . - A n m . S. 482. Im ersten Teil der >Seherin< berichtete Kerner über den Vorfall v o m 5. Sept 1 8 2 7 . Kerner [1], Erster Theil, S. 1 9 7 ^ Erst am 6. September las er angeblich im Schwäbischen Merkur< die Nachricht v o m Tod der Frau Mährlen.
86
Brief Mörikes an Mährlen vom 2. Sept 1 8 2 7 . In: H K G A 10, S. 1 7 2 , Z . 2 i f .
87
»Kerner schreibt weiter [zitiert M ö r i k e Strauß gegenüber Mährlen; A n m . T. W.], ich solle ihn und Frau H . bei D i r und Mährlen entschuldigen, da er nun in Beziehung auf Mährlens [ebenfalls kranken; A n m . T. W.] Vater nichts thun könne, da Frau H . seit jenem Vorfall nichts dergleichen mehr anrühre. E r läßt Dich und Mährlen herzlich grüßen und heißt mich über die Sache ruhig seyn, deren Folgen nun größten theils vorüber seyn.« ( H K G A 10, S. 1 7 7 , Z . 1 9 - 2 4 . )
88
Brief Mörikes an Vischer vom 2. April 1 8 3 1 . H K G A 1 1 , S. 1 9 3 , Z . 6f. - A m a deus Wendt ( 1 7 8 3 - 1 8 3 6 ) w a r 1 8 3 0 - 1 8 3 2 Redakteur des »Göttinger MusenalmanachsMaler Nolten< und gedachte vor seiner Reise zu Kerner erst das Erscheinen des Buches abzuwarten. Der unbekannte Eduard Mörike wollte dem (in den Briefen meist großgeschriebenen) Justinus Kerner endlich als legitimierter Schriftsteller gegenübertreten, nicht länger als hypochondrischer oder unselig handlangender Bittsteller. (Die Bettelei mußte indessen Hartlaub ertragen, der dem Freund ioo Gulden vorstreckte, die er lange Zeit nicht wiedersah.93) Kaum eine Bemerkung in den Briefen verriet etwas über den entstehenden Roman. A n Hartlaub in Wermuthshausen schrieb Mörike am 8. April 1831: Es wäre sehr wohl möglich, d.h. ich habe es fest im Sinne, Dich zu Anfang des JULI in Deiner Heimath zu besuchen, Dich, den lieben Bauer in Ernsbach und den JUSTINUS Kerner. Dann bring ich Dir eine kleine Schrift von mir, gedruckt, mit. 94
Daß er sich innerlich zu Kerner wünschte, zeigen die Beziehungsnetze, die er wob, als seine Verlobte Luise auf Kerner zu sprechen kam. Sie hatte im Oktober 1831 ihre Freundin Johanna Fraas - einer zeitweiligen Verlobten Friedrich Theodor Vischers95 - in Weinsberg besucht, deren Familie die Kerners gut kannte. Mörike schrieb: Bleibe ja mit jenen freundlichen Geistern in Verbindung und lasse Dir aus Hannchens Briefen zuweilen einen Klang jener Windharfen wiederbegegnen die Dir so lieb geworden waren und in deren träumerische Melodieen Du ja auch die Erinnerung an Deinen Eduard so innig verwoben hast. [...] Kerners liebevolles Andenken ist mir viel werth, leider haben wir einander nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber ich hänge nun doppelt angenehm durch Deine Vermittlung mit ihm zusammen.' 6
92
Brief Mörikes an Vischer vom 2. April 1831. H K G A 1 1 , S. 191, Z. z6f. '3 H K G A n , A n m . S. 579 zu S. 195. 9 + H K G A 1 1 , S. 195, Z. 28f. - S. 196, Z. if. 95 Vgl. H K G A 12, Anm. S. 356 zu S. 47, Z. 26 und Anm. S. 328 zu S. 26, Z. 2if. 9Maler Nolten< wieder etwas realistische Unterfütterung. Gegenüber dem seit September 1831 auf dem Asperg einsitzenden Bruder Karl Mörike spekulierte Eduard brieflich über eine dem Roman voranzustellende politisch entlastende Widmung. Er verfiel auf die Idee, das Werk statt Uhland, Tieck oder den Fürstinnen von Thum und Taxis lieber Karl Friedrich Freiherr von Kerner, Justinus Kerners älterem Bruder zu widmen, der (1812 wegen seiner Verdienste geadelt) eine wichtige Position als Geheimrat und Präsident des württembergischen Bergrats bekleidete. Die Dedikation sollte sich haftmildernd für Karl Mörike auswirken. Mein Gedanke ist nun halb, ich wolle etwa dem JUSTIN Kerner die Schrift in gehefteten Aushängebogen u[nd] eh* es noch vollkommen abgeschlossen ist zuschicken mit der Bitte b[ei] sfeinem] Bruder die Erlaubniß für mich zu erbitten. (JUSTIN K . will mir sehr wohl: er hat mir dieß erst kürzlich wieder durch vertraute Hand bezeugen lassen) [...]. Im Ganzen mag ich Schmeicheleien der Art nicht und nur unter gewissen Umständen werden sie nicht verächtlich. So ζ. B. b[ei] Kernern: wo Dankbarkeit für Genossenes so viel wiegt als Aussicht auf künftigen Vortheil.' 7
Ob nun der Bruder dagegen war oder Eduard Mörike selbst die neue Bittstellerei doch nicht übers Herz brachte, bleibt unklar. Nur zweimal wurde Justinus Kerner vor dem Erscheinen des Romans noch erwähnt: anläßlich eines merkwürdigen Todesfalls' 8 und als Gegenstand eines ungeheuerlichen Gerüchts: Ich höre für gewiß, das JUST. KERNER mit Familie nach NORD AMERIKA ziehen w e r d e . "
Die Nachricht war aber zum Glück verderbt. Kerner, der hier wohl mit Lenau verwechselt wurde, blieb der Gegend als gastfreier Zentralpunkt erhalten, und Mörike durfte weiter auf eine künftige Begegnung hoffen. 1832 erschien >Maler Nolten< und sollte nun an »Uhland, Kerner &c.« abgehen. 100 Ob Kerner jedoch tatsächlich ein Exemplar erhielt, ist nicht bekannt. Zu einer Anfrage bei Kerner wegen eines Beitrags zum
H K G A 11 S. 233, Z . 1 2 - 1 6 . - dito Z. 2 1 - 2 4 . Brief Mörikes an Luise Rau vom 10./11. Dezember 1831: »Ist das Gedicht von J . Kerner nicht dasjenige worin ein Gespenst vom Kirchhof die Cholera prophezeiht?« H K G A 1 1 , S. 239, Ζ. 1 if. 99 H K G A 1 1 , S. 279, Z.9ff. 100 H K G A 1 1 , S. 304, Z. 29. 98
71
>Jahrbuch schwäbischer Dichter und NovellistenLetzte Wohnung von Schillers Mutter in Cleversulzbach bei NeckarsulmGesprächen mit Goethe< zum Geschenk. Noch immer beschäftigte ihn Kerners erster Krankenbesuch: E r regte Alles in mir auf, was ich je von Verehrung und Liebe für Sie empfunden hatte und es entstand zugleich der Wunsch in mir, Ihnen irgend etwas Freundliches zu erweisen. 1 1 4
Durch die Freundschaftsgabe der >Gespräche< transponierte Mörike die Beziehung zu Kerner gewissermaßen in klassische Regionen und reinigte den Kontakt somit von den morbiden Begleitumständen, die ihm aufgrund seiner anfänglichen »Schaam« im Briefwechsel wiederum unangenehm gewesen sein mußten.
»Rabausch«-Gespräche ( 1 8 3 7 - 1 8 4 0 ) Zu Mörikes körperlicher Unpäßlichkeit hatte sich eine lästige Schuldenaffäre gesellt, in die er durch windige Geschäfte seines Bruders Adolph geraten war. Im Sommer 1837 war er noch immer zu »reizbar«, um den »Weg von ein Paar Stunden« auf sich zu nehmen und in Kerners »ungewohnten« Familienkreis einzutreten, ohne daß ihn dies zu sehr »beunruhigt« hätte. 11 ' Die großen Freundschaftsbezeugungen und kleinen Eckermanndienste, die Mörike unterdessen ein jüngerer Verehrer, Hermann Kurz, im Sommer 1837 erwies," 6 brachten den »zähen Reconvalescenten« 11 ? langsam wieder geistig in Schwung. Auch die Ludwig Bauer gewid-
114
H K G A 12, S.87, Z. 14-17.
" 5 H K G A 1 2 , S. 109, Z . 4 - 7 . 116 K u r z hatte M ö r i k e nach einem Incognitobesuch in Ochsenwang mit dem Bruder Ernst in der Novelle >Das Wirthshaus gegenüber gefeiert: »[...] ich [...] werde in Z u k u n f t blindlings nach allem greifen, was mir dieser Dichter bietet, er kann gar nichts schreiben, was nicht vortrefflich ist, alles verwandelt sich unter seiner Hand in G o l d ! « K u r z [1], Bd. 1 2 , S. 50. - K u r z redigierte auf Mörikes Wunsch das Verslibretto der >RegenbrüderWispeliaden< gaben Zeugnis einer allgemeinen inneren A u f heiterung. A m Sonntag, den 2. Juli 1837 ließ Mörike nach Weinsberg bestellen, daß man am nächsten Tag »besonders ungestört« sein würde. Prompt kam der ersehnte Kerner tags darauf zum zweiten Mal nach Cleversulzbach. Es begleitete ihn seine Tochter Rosa Maria, die Mörike so tief beeindruckte, daß er ihr später das Gedicht >Erzengel Michaels Feder< widmete. Noch einmal aus dem vollsten Herzen danken wir für den gestrigen Nachmittag. Als ich nach d[em] Abschied auf der Straße zwanzig Schritt von Ihnen weg war; da war mir, als müßt ich Ihnen Beiden nochmal nachlaufen und wieder von vorne anfangen, mich an Ihnen zu erquicken.118 Kerner hatte einen glücklich veränderten Mörike angetroffen. Nach dem Besuch schätzte er ihn als poetische Persönlichkeit sichtlich höher ein. Er ist ein lieber, herrlicher Mensch und sein Dichterwesen ist durchaus originell.119 Sogar Mörikes Art, Schiller seine Reverenz zu erweisen, fand Kerners Verständnis, wie er Sophie Schwab erläuterte. Es ist gut; denn wo ein guter Sohn ist, verdient die Mutter zuerst einen Preis. [...] Von den Müttern kommt alles Gute, das ist durchaus eine in der Natur gegründete Wahrheit.120 Mörike war aufgetaut, hatte erzählt, vor allem von einer Materie, die den Besucher interessierte: Sein Pfarrhaus ist in der Seherin von Prevorst aufgeführt als eines, in dem sich Spuk zeige. Er - der früher an derlei nicht im mindesten glaubte, überzeugte sich völlig davon, und seine Erzählungen sind höchst charakteristisch. Auch die verschiedenen Vikare, die er hatte, überzeugten sich davon [...]. 121 Justinus Kerners Interesse am Spukhaus Cleversulzbach war mit Sicherheit bereits im Vorfeld dieser zweiten Visite rege geworden und hatte seine Schritte wenn nicht gelenkt, so doch zumindest beschleunigt.
II8
H K G A 12, S. Ι Ι Ο , Ζ . 8-12. Theobald Kerner, Bd. 1, S. 123. Theobald Kerner, Bd. 2, S. 123. 121 Theobald Kerner, Bd. 2, S. 123.
119
120
77
Immerhin waren Poltergeister eines seiner spezifischen Sammelobjekte und Spukhäuser die stehenden Beweise der Objektivität der Geister. 122 Die Tatsache, daß Mörike selbst erst nach dem ersten wirklichen Gespräch mit Kerner in den Briefen an Hartlaub des Cleversulzbacher Geistes, des Spektralhundes und des anderen Gespenstergelichters gedachte, 1 2 3 d.h. die Gespenstersphäre aktiv in seine private Mythologie einfügte, läßt vermuten, daß Kerner und Mörike nun ihr gemeinsames Thema gefunden hatten. Mörike gesundete zusehends, zeichnete wieder vermehrt, belebte den Briefwechsel mit den Freunden - die Sphinx als Siegel und die mehrfache Briefvignette >Fausts Zaubermantel< fallen auf - und widmete Kerner gleich zwei Gedichte. Im ersten, >Die Anti/ SympathetikerGeisterkunde< kannte, ist nicht bezeugt; die >Lebensbeschreibung< las er indes im Februar 1834 - Brief an Karl Mörike vom 12. Februar 1834: »Der Stilling ist schon ausgesupft.« H K G A 12, S. 56, Z . 23f. '3 1 H K G A 12, S. 110, Z. 4f. 1)2 »Auch für die späteren Briefe Mörikes gilt die oben getroffene Feststellung, daß sie nicht nur Vorstufe, sondern selbst poetische Werke sind.« Rheinwald, S. 232.
79
veranschaulicht aber zugleich die Verstofflichung des an sich unpoetischen Ereignismaterials und seine symbolisch-spielerische, durchaus schon per se poetische Vorordnung. Mörike erfand eine zeichnerische Chiffre für den Hausgeist, beschrieb die Hundegattung »Canis Spectrails« und wies den übrigen Geistergeschichten, über die er mit Hartlaub im Austausch stand, die Schlüsselbezeichnung »Acta Spectralia« zu. Er habe »einen ganzen Rummel von selbsterfundnen Stoffen« im Kopf, schrieb er am 13. Dezember 1837 an David Friedrich Strauß' 33 - der Hausgeist gehörte fortan mit dazu. Nach der ersten Rumorphase (fünf Brieferwähnungen bis zum 5. März 1838) hatte der Polterer - zumindest laut Briefwechsel mit Hartlaub - erst einmal Pause. Kerner machte aus seiner Liebe zum Dichter Mörike nach dem Erscheinen der Cottaschen Ausgabe der >Gedichte< kein Hehl mehr. Er trug das Buch ständig in der Brusttasche, um es angelegentlich hervorzuziehen und zu herzen und zu küssen. 1 ' 4 Mörike revanchierte sich mit auflebendem Interesse am Maultrommelspiel. Aufgrund dieser beiderseitigen Sympathie, aber wohl auch wegen des lokalen Spuks, kam Kerner am 26. September 1838 erneut zu Besuch, dieses Mal in Begleitung Emma von Suckows, einer schwärmerisch-schönen Anhängerin, die er scherzhaft-liebevoll eine »wahnsinnig gewordene Äolsharfe« nannte. 13 ' In einer Reisebeschreibung >Villegiatur in Weinsberg< schilderte sie am 25. März 1839 im Cottaschen >Morgenblatt< die Umstände des Eintreffens in Cleversulzbach. 1840 erschien die Episode in ihren unter dem Pseudonym »Emma von Nindorf« veröffentlichten >Reisescenen in Bayern, Tyrol und Schwabens »Wenn Mörike nur nicht merkt, daß die Philister zum Besuche anrücken, und sich wieder als Eichhorn in den Wald flüchtet,« scherzte Kerner. Mörike ist von langem Sichthume noch immer nicht völlig genesen. Seine Mutter empfing uns im finsteren Pfarrhause, das am Ende des Dorfes liegt [...] Endlich kam er selbst - man hatte ihn wirklich im Walde geholt. [ . . . ]
133
H K G A 1 2 , S. 1 4 7 , Z . - Z u Mörikes N e i g u n g und Fähigkeit, »Privatverhältnisse« zu »poetisieren« äußerte sich schon Friedrich N o t t e r 1875 in >Eduard Mörike, ein Beitrag zu seiner Charakteristik als Mensch und D i c h ten. Wiederabdruck in: Notter, S. 5 0 - 1 1 7 ; hier: S. 57. - Ü b e r die Gründe zum Bilden der privaten Mythen spekulierte auch Wolf von Niebelschütz in einem seiner Nachkriegsvorträge über Mörike. V g l . Niebelschütz, S. 72f.
134
M a y n c [2], S. 2 0 1 .
!3
' Oberhauser, S. 683.
80
Geistererwähnungen im Briefwechsel nach dem 3. Juli 1837 mit Ausnahme der Briefe an Kerner Datum
Briefempfänger
Inhalt
WH: Hartlaub HK: Kurz EvS: Suckow
G: G:
Hausgeistsymbol Hausgeisterwähnung
9. Sept. 1837
WH
CANIS SPECTRALIS
18. Sept. 1837
WH
CANIS SPECTRALIS
2. Nov. 1837
WH
G
7. Nov. 1837
WH
G
17. Dez. 1837
WH
G
13. Feb. 1838
WH
G
WH
G ACTA SPECTRALIA
5. März 1838 16. März 1838
HK
(zw. 6. Jan. und 21. Feb. 1838)
EvS
G
15. März 1839
WH
G
23. Nov. 1840
WH
G
7. Dez. 1840
WH
G
29. Dez. 184
WH
G
22. Feb. 1841
WH
G
15. März 1841
WH
ACTA SPECTRALIA
26. April 1841
t t t t t t t t t TOD CHARLOTTE MÖRIKES
ttttttttt
8. Sept.1841
WH
G
27. Okt. 1841
WH
ACTA SPECTRALIA
WH
ACTA SPECTRALIA
22.Dez.1841
WH
ACTA SPECTRALIA
26. Dez.1841
WH
ACTA SPECTRALIA
21./24. Jan. 1842
5. Dez. 1841
WH
ACTA SPECTRALIA
4. Juli 1842
WH
Spectralgespräche
8. Nov. 1843
WH
Spectralgespräche
18. Juni 1843
WH
G
Tabelle 1 81
Ich würde sagen, sein sinniges Wesen gewinnt sogleich für ihn, neigte sich das Gemüth nicht zum voraus dem Sänger entgegen, dessen Lieder, dem Zauberquell echter Poesie entsprudelt, bald durch klassische Schönheit, bald durch Humor überraschen. E r spricht sehr gut; alles, was er sagt, ist bedeutungsvoll. Dabey erscheint er einfach und gemüthlich. E r führte uns in den Garten, der in gleicher Höhe mit dem zweiten Stocke liegt. Auf dem Steinsitze unter einem seltsam zur Laube verwachsenen Baume, die grüne Pfarrkutsche genannt, gewährt das alte, von einem Obstbaume beschattete Pfarrhaus ein schwermüthiges, aber kein ungefälliges Bild. 1 3 6 Man führte die von Kerners Begleiterin so benannten »RabauschGespräche«, über deren Inhalt im Rahmen einer journalistischen Reisebeschreibung berichten zu dürfen, Frau von Suckow Mörike am 29. Mai 1838 brieflich bat. Mörike w a r einverstanden. Der Artikel erschien in der Stuttgarter Abendzeitung< vom 18./19. November 1 8 3 8 1 3 7 - allerdings vom Redakteur Hermann Hauff um die Cleversulzbacher G e spensterepisode gekürzt. Vielleicht geschah es aus Rücksichtnahme auf die >Gedichte< - um den zurückgezogenen Poeten nicht in den Ruf des abergläubischen Hinterwäldlers geraten zu lassen, wiewohl Hauff selbst den okkulten Bereichen nicht ganz abgeneigt war. 1 ' 8 A u s Emma von Suckows Bericht über den Besuch in Cleversulzbach sprach Kerners noch immer pessimistische Grundeinschätzung von Mörikes Gesundheits- und Geisteszustand. Schon 1838 hielt er eine Ortsveränderung des »Nervenleidenden« für geraten. Mörike gab uns eine Strecke das Geleite. Als er schied, wandten wir uns noch oft nach dem Wanderer, der im Abendlichte langsam und allein dem Dorfe zuging. Gewiß theilen Viele den Wunsch, den werthen Sänger, der zwar zufrieden und resignirt scheint, in günstigere Umgebungen entrückt zu wissen. Kein Zweifel, daß in diesem schönen glücklichen Lande [...] der edle Dichter bald eine Stellung finden werde, die seine Wiedergenesung erleichtert, seinem Genius ungehemmten Schwung gestattet. Luftveränderung und Scenenwechsel sind zur Heilung dieser gesteigerten Nervenleiden unerläßlich. 13 ' A l s Mörike 1838 in Stuttgart war, machte er am 22. November 1838 Emma von Suckow seine Aufwartung, w o z u es Kerners dringlichen A n -
136
Nindorf, S. 2 4 4 f . Vgl. die Abb. 4 auf S. 73. Emma von Suckow schrieb hier unter dem Pseudonym »Hermann«. Vgl. HK.GA 14, Anm. S. 607 zu S. 230, Z. 3-10. 138 Notter, S. 29. I3 ' Nindorf, S. 246.
137
82
ratens kaum bedurft hätte.' 40 Die abwiegelnden Tagebuchbemerkungen gegenüber Mutter und Schwester daheim bezeugten genauestens, was sie vertuschen sollten - Mörike war nicht minder heftig verliebt in die schöne Journalistin als Kerner. 141 Auch sie war auf das scheue »Eichhorn« neugierig geworden - freilich nur aus literarisch-okkultem Interesse. Während er neben ihr auf dem Sofa saß, erschien er ihr »weniger roth und echauffirt, natürlicher und gesünder« als im Herbst. 1 4 2 Später sandte Mörike ihr als ein »lusus aenigmaticus« das Spiegelgedicht >Ein artig Lob, du wirst es nicht verwehren< mit der Bitte, es bei der Morgentoilette vorm Spiegel zu lesen. Seinem heimlichen Konkurrenten Kerner schickte er einige Exemplare zu galantem Gebrauch, fügte aber neckend hinzu: Verschenken Sie es nach Belieben. Bei Frau von SUCKOW u[nd] Schwester bin ich Ihnen bereits zuvorgekommen. 1 4 3
Mörike berichtete Kerner am 13. Dezember 1838 auch von der Begegnung mit dessen Bruder, der ihm Unterstützung bei einem Versetzungsgesuch versprochen hatte. 144 Stuttgart hatte ihm gutgetan, abgesehen von einem überheizten Zimmer, in dem er hatte ausharren, und einem Kanarienvogel, dessen nervtötendes Piepen er zu lange hatte erdulden müssen. 145 Bemerkenswert sind die faustischen Bilder, die ihm beim Anhören von Beethovens >Symphonie N fi *j< (c-moll, 1808) durch den Kopf gingen: Ich dachte mir, ganz unwillkührlich, schöpferische Geister-Chöre, welche zusammenkommen, eine Welt zu erschaffen; sie sausen und schweifen, einzeln u[nd] in Massen, oft wider einander in seligem Kampf und gießen Ströme von Licht vor sich her, ganze Meere! 1 4 6
H K G A 12, S. 227, Z. 27-35: »Strauß zeigt mit großen Freuden einen neusten Brief von JUSTINUS, der also lautet. / A n Strauß u[nd] Mährlen. / Meine Lieben Söhne! / Es ist doch entsetzlich kalt u[nd] gläsern von euch, daß Ihr noch gar nicht bei der Frau von Suckow wäret. So viel ich höre seye Mörike in Stuttgart; dieser wird hoffentlich doch nicht versäumen, zu der guten Frau hinzugehn. Ich bitt euch, seyd doch ordentlich u[nd] gesittet! / Euer, um euch stets bekümmerter Vater / J. Kerner.« 1 4 1 In seinem Gedicht >An Emma v o n N i e n d o r f heißt es: »Aber zwischen all den Bildern / Sieh! das lieblichste bleibst du.« Zit. nach Krauss, S. 127. 1 4 2 Vgl. H K G A 12, Anm. S. 606 z u S. 229. H K G A 13, S. 51, Z. 22ff. 1 4 4 H K G A 12, S. 2 3f. 4 I 4 ' H K G A 12, S. 245, Z. 26ff. 1 4 6 H K G A 12, S. 228, Z. 18-22. 140
83
Während Mörikes Stuttgarter Aufenthalt befand sich ein Buch in seinem Gepäck, das eine satirische Kritik an Kerner, Eschenmayer und der Geisterkunde überhaupt enthielt: Karl Leberecht Immermanns Roman >MünchhausenLand der Dichtung Dichters Lande< (Scheuffelen/Dambacher/Dieke, S. 194) leider keinen Beleg. Es dürfte sich um einen der Besuche im A u g u s t 1840 gehandelt haben. Eduard Mörike: Drei kunstverwandte Damen. A n Fernande Gräfin von Pappenheim: » [ . . . ] Dies im Fall der nächste Frühling / Jene holden Sängerinnen / Wiederum nach Schwaben brächte. - / H a t er's doch fein ausgerichtet? / Hat man ihn doch wohl verstanden?« Zit. nach Krauss, S. 126. H K G A 1 3 , S. 5 1 , Z . i8f. Vgl. H K G A 1 3 , S. 82. Vgl. die A b b . 3 auf S. 6 1 .
84
kommen w a r . 1 " A m 2. August 1840 traf Mörike mit David Friedrich Strauß in Weinsberg ein. Strauß hatte ihn aus Cleversulzbach abgeholt, um etwaigen Hinderungsgründen das Gewicht zu nehmen (Mörike wollte nicht allein zu Fuß gehen und konnte angeblich keine Kutsche bekommen). 1 '* Gegenüber Wilhelm Hartlaub faßte Mörike zusammen: Strauß, welcher kürzlich in CÖLN und Heidelberg war kam von Weinsperg hieher und nahm mich mit dahin zurück, zu Fuße durch den Wald bis Eberstadt, wo Kerners Gefährt uns erwartete. Wir fanden den Herrn JUSTINUM auf dem alten, von der Abendsonne beschienenen Thum, den Grafen Alexander und Schnitzer von Heilbronn bei ihm. Ich blieb über Nacht u[nd] schlief [...] im Gartenhause. 15 ' Kerner witzelte, Mörike »käme nur von anderen Freunden gerufen« 1 ' 6 , was Mörike mit einem folgenden Besuch »zu widerlegen dachte«. 1 ' 7 Kerner hörte, daß sein Wort Mörike erreicht hatte und formulierte ein einladendes te absolvo: ich will Ihren morgigen Besuch als ganz allein mir gemacht ansehen. 1 ' 8 Mörike folgte diesem Hinweis diesmal ohne Zögerlichkeit am 14. A u gust 1840 und blieb wiederum über Nacht. Hermann Kurz war mit von der Partie. 1 ' 9 Ihm klagte Mörike am 15. August noch ganz in guter Weinsberger Stimmung über sein vergessenes »Sandbüchschen« und gestand eine kleptomanische Neigung bezüglich Schreibutensilien: In diesem Stück bin ich gefährlicher als Kerners Rabe. l 6 ° Zwischen dem 22. und 27. August 1840 besuchte Kerner wieder Cleversulzbach und brachte Karl Mayer und Hermann K u r z mit l 6 : (Mayers
:
' 3 H K G A 13, S. 79, Z . 2 i f . H K G A 13, S. i07f. H K G A 13, S. 1 1 3 , Z. 26-31. 1,6 Vgl. H K G A 13, Anm. S.433 zu S. 110, Z. i8ff. Brief von Kerner an Mörike vom 13. August 1840. IJ7 Brief Mörikes an Hermann Kurz vom 7. August 1840. H K G A 13, S. 1 1 0 , Z. i 9 f . ' ' 8 H K G A 13, Anm. S. 433 zu S. n o , Z. i8ff. Kurz logierte vom 20. August an in Eberstadt, »um recht in der Mitte zwischen Kerner und Mörike zu sitzen«, und übersetzte Ariost. Vgl. Mayer, S. 185. Kurz verabschiedete sich von Mörike (laut Brief an Adelbert Keller vom 10. August 1840) am 9. Oktober. Vgl. H K G A 13, Anm. S. 442 zu S. n j f . 160 H K G A 13, S. 1 1 5 , Z. 1. H K G A 13, S. 134. - Kerner und Karl Mayer holten Hermann Kurz in Ebersbach ab. Vgl. Mayer, S. 185.
154
8?
Sohn Karl Friedrich besuchte Mörike später allein 162 ). Gegenstand der Gespräche waren die Geister allgemein, aber wohl auch der lokale Geist. A n Karl Schnitzer, den er bei Kerner am 2V3. August gesehen hatte, schrieb Mörike: Auch unsern guten Magum [...] sah ich inzwischen wieder, in Weinsperg und bei mir. [...] Neulich brachte mir Kerner den trefflichen C . Mayer [...] Es war mir ein großes Vergnügen, diese alten Freunde miteinander zu sehn, und zu hören, daß sie was die dunklen Gebiete betrifft in vollkommener Opposition sind. l6 3
A m 1. November 1840 bedankte sich Mörike für Kerners wohlwollende Fürsprache bei Prinzessin Marie von Württemberg, die ihm als finanzielle Unterstützung (wie bereits Anfang November ι838 ι6 4) ioo Gulden hatte zukommen lassen. 16 '
Poltergeister in und um Cleversulzbach ( 1 8 4 1 - 1 8 4 3 ) Kurz vor dem Ende der zweiten Spukperiode im Briefwechsel mit Hartlaub vom 15. März 1839 bis zum 22. Februar 1841 (6 Brieferwähnungen) wurde Mörike von Kerner am 19. Januar 1841 freundlich aufgefordert, die Cleversulzbachereignisse für seine Zeitschrift >Magikon. Archiv für Beobachtungen aus dem Gebiete der Geisterkunde und des magnetischen und magischen Lebens nebst andern Zugaben< zu dokumentieren, in der er alle Gespenstergeschichten sammelte, deren er irgend habhaft werden konnte. Vom 28. Januar bis zum 1. Februar 1841 durchforstete Mörike daraufhin seine Cleversulzbacher Tagebuchnotizen auf Unerklärliches und ergänzte die Chronik aus dem Gedächtnis. Im Bericht an Hartlaub las es sich wenig begeistert: Durch einen Auftrag Kerners, welcher ihm sehr am Herzen liegt, und womit er pressirt, bin ich seit gestern in Sachen des Herrn Rabauschen beschäftigt.
161
H K G A 13, Anm. S. 464 zu S. 133. H K G A 13, S. 1 1 7 , Z. 15-19. ιβ 4 H K G A 12, S. 218, Z. 3of. und Anm. S. 590 zu S. 218, Z. 32. ιέ ' Kerners Vorarbeit war es zu verdanken, daß das Königshaus dauerhaft auf Mörike aufmerksam und ihm 1864 das Ritterkreuz des Friedrichsordens verliehen wurde. Vgl. Zeller, S. 424. 86
Ich soll fürs Magikon zusammenschreiben, was wir seit unserm Hierseyn Spuckhaftes erfuhren und das ist grade nicht das amüsanteste Stück Arbeit.' 6 6 Der A n t w o r t an Kerner vom i. Februar 1 8 4 1 lag bereits der fertige Text bei. Mörike gab sich nach der Lektüre des zuletzt erschienenen >MagikonSeherin< 1833 oder 1834 gelesen.1?1 Zumindest kannte er vor Kerners Besuch die Spukschilderung seiner Amtsvorgänger Hochstetter und Rheinwald in der »siebenten [fremden] Tatsache« und auch die Enttarnung des Geistes in der Lautfolge »R-sch«.' 7 2 Es ist anzunehmen, daß er in der selbst geschriebenen Liste der evangelischen Pfarrer das Kürzel »R-sch« schon dechiffriert hatte, wie er es 1855 gegenüber Theodor Storm schilderte. '73 Die früheste familiäre Erwähnung des Spuks datiert jedoch nach dem zweiten Kernerbesuch: Als Mörike in Mergentheim kurte, schrieb ihm die Mutter am 1 1 . September 1 8 3 7 von Rabauschaktivitäten. 174 Kerners Objektivitätsthese war somit in diesem speziellen Fall ins Schwanken gebracht. Der Beobachter Mörike blieb jedoch voller Geisterzutrauen und schrieb:
170 171
172 173
174
Kerner [3], Jg. 2, Heft 1,1842, S. 8. Storm zufolge las Mörike das Buch 1834. Aus dem Brief vom 18. August 1839 geht hervor, daß Mörike die >Seherin< weder 1834 noch 1839 selbst besaß. Vgl. H K G A 13, S. 64, Z. 13. Auch später scheint er kein eigenes Exemplar erworben oder als Geschenk erhalten zu haben. Vgl. Janssen, S. 43. Kerner [1], Zweiter Theil, S. 21 jf. »[···] geht er eines Sommernachmittags in sein Weinbergshäuschen hinauf, um dort, wie es komme, ein bischen zu lesen oder zu schlafen. Zufällig hat er unter seinen Büchern die erwähnte Seherin gegriffen und liest darin - die Geschichte steht S. 274 - was einem Pfarrer H. zu C. und dessen Nachfolger S. im Pfarrhause mit einem spukenden Amtsvorgänger Namens R-sch begegnet ist. Eben am Eindämmern, fährt es ihm durch den Kopf: »Ganz dieselben Wahrnehmungen hast du ja auch gemacht!« Die Anfangsbuchstaben der Pfarrer und der nächsten Vorgänger passen ebenfalls; nur der Name des Spukenden ist ihm nicht bekannt. Eiligst begiebt er sich auf sein Studirzimmer und schlägt im Kirchenregister nach; und da steht es! Rabausch hatte der Pfarrer geheißen, der hier vor längerer Zeit gelebt und über den noch allerlei finstere Erzählungen im Schwange gingen. - Von der Zeit an hätten er und seine Hausgenossen die Aeußerungen des Geistes mit Aufmerksamkeit beobachtet.« Theodor Storm: Meine Erinnerungen an Eduard Mörike. In: Briefwechsel mit Storm, S. 15 2f. H K G A 12, S.473. 88
Ich habe Alles mit dem lebhaftesten Interesse gelesen und mich dadurch in Vielem neu befestigt. Besonders merkwürdig war mir die Weimarische Tradition; und die Geschichte vom Mönchhof gibt Jedem die Wahrheit handgreiflich genug. Wie sich darin das Κ. K. Kreisamt so herrlich prostituirt! Das ist ja aufs Haar hin, fast überall, die Politik der großen Sandbüchsen! 175 Die Geister erschienen Mörike an dieser Stelle als eine Waffe der Stillen im Lande gegen die Amtsschimmel der Restauration. E r widersprach aus der geistergläubigen Innenperspektive dem politischen Vorwurf, Kerner sei ein »gut gewähltes Werkzeug in den Händen der Dunkelmänner«, da er das gemeine Volk auf seinem Rückfall in den »Köhlerglauben« bestärkte, statt es aufklärerisch zurechtzuweisen.' 7 6 Mörike stellte diese Kritik auf den Kopf. Die Poltergeister wurden bei ihm zu okkult wirksamen Irritationsmomenten im politischen Getriebe. Natur und Geisterwelt waren Residuen apolitischer Ursprünglichkeit. Mörike wies Kerner in seinem, den Spukbericht begleitenden Brief auf die früheren Spukbeobachter Hochstetter und Rheinwald hin, von denen er unterdessen offenbar weitergehende mündliche Berichte - auch über Vorfälle außerhalb Cleversulzbachs - erhalten hatte. Kerner fragte tatsächlich noch einmal bei diesen nach und veröffentlichte N a c h -
175
H K G A 13, S. 153, Z. 4-10. - »Eine Weimarische Tradition«: Spukgeschichte in: Kerner [3], Jg. 1, Heft 3 (1840), S. 269-276: Nach einem Bericht der Mrs. Jameson erzählte man bei einer Abendgesellschaft der Frau von Ahlefeld die Geschichte eines Weimarer Fürstahnherrn und Alchemisten, der den Stein der Weisen entdeckt, mit ins Grab genommen und den verflucht hatte, der je versuchen sollte, ihn herauszuholen. Herr Caumartin ging auf Befehl des Herzogs Ernst in die Gruft, kam bleich zurück und starb drei Tage später nach unerklärlichem Todeskampf mit dem Degen in der Hand auf seinem Zimmer. Die Erzählung wurde im >Magikon< dahingehend berichtigt, daß es der Sage nach einen Schatz gegeben habe, den der Erbauer des alten Weimarer Schlosses, Herzog Wilhelm, angeblich in seinem Grabgewölbe versteckt hatte. Um den Legenden ein Ende zu machen (aber auch wohl aus pekuniärem Interesse), suchte Herzog Ernst einen Freiwilligen, der in der Gruft nachsehen sollte. Ein Vertrauter, Herr von Commartin erklärte sich dazu bereit. Bei der Öffnung der aus mehreren verschachtelten Grabkammern hielt er jedoch nach der ersten Tür plötzlich erschreckt inne, ließ die Tür wieder verschließen und erzählte dem Herzog von einer geheimnisvollen Stimme. Einzelheiten wurden nie bekannt. Commartin verließ Weimar, nicht ohne zuvor sein nahes Sterbedatum exakt vorausgesagt zu haben. Er starb eines ruhigen Todes, wie es heißt, legte also keine Hand an sich.
176
Sternberg, S. 545.
89
tragsberichte im >MagikonPfarrbeschreibung von Klever-Sulzbach< hieß es über das zum Kameralamt Kochendorf gehörige Gebäude: E s steht am E n d e des Orts, von der Kirche 70. Schritte, von der Schule 1 2 5 . Schritte entfernt, ist frei, etwas feucht, angenehm gelegen, und gut erhalten, hat 3. heizbare Zimmer, einen schlechten Keller, wenig Hofplaz, Scheuer mit Stallung, Waschküche, und Garten an das Pfarrhaus anstoßend. 17 ®
Johannes Mährlen, der 1835 Mörikes Gast war, ergänzte das leicht düstere Bild um die prächtige Gartenseite: Gerade Wege führen durch den ganzen Garten, zu beiden Seiten breite R a batten, von unzähligen Nelken besetzt [...]. Dazwischen stehen auf schwank e n d e n ] Stielen jungfräuliche Mohnblumen [ . . . ] Nachtviolen, Lilien und Blumen aller A r t , welchen die Bewohner des Hauses ihre Sorgfalt und ihre Liebe widmen. [...] Von dem Hausflur, aus den Zimmern geht's eben und schnurgerade in die Gartenwege auf die Lauben zu. Mit einem Schritt steige ich von draußen in mein Schlafzimmer. 1 7 9
Das »Amtszimmer« Mörikes lag im zweiten Stock, vier Stiegen hoch, und enthielt das Archiv der Familienregister, Protokollbücher etc. Vor der Tür stand der von Mörike entworfene »Zwölffaecherkasten« zur Aktenvorsortierung. Eben diese »bei etage« - der zweite Oberstock, der den Ausgang zum Pfarrgarten bot, enthielt »hinten links« auch das Vikarszimmer. An der südlichen Stirnseite des Hauses, im dritten Oberstock, befand sich der Hausaltar. Auf Wunsch der Schwester Klara »bestimmte« Mörike Anfang Dezember 1840 diese »obere Stube«, die wegen »Straßenlärm«, Kälte und anderer »Obstakel« (Hindernisse) nicht bewohnbar
177
Nachträge finden sich sowohl in Kerners V o r w o r t zu Mörikes Bericht (Kerner [3], J g . 2, H e f t 1 (1842), S. jff.) als auch im übernächsten Heft: »aus einem Schreiben des H r n . Pfarrer Hochstetter«. (Kerner [3], J g . 2, H e f t 2, 1 8 4 2 , S. 4 3 1 f.
178
Zeller, S. 245.
179
Zeller, S. 2 4 i f .
90
war, zur »Kirche«. Ein früherer Standort des Hausaltars, noch ein letztes Stockwerk höher unterm Hausgiebel, hatte wegen Dachreparaturen geräumt werden müssen. Die Ausstaffierung dieser Zimmerkapelle wurde mit Akribie betrieben. Von den Hartlaubs kam per Paketpost ein uraltes Stundenglas, während Bruder Louis ein aus einer Schweizer Kirche stammendes Kruzifix schickte, das rückseitig ein gefüllter, weihrauchduftender Reliquienschrein war. Bücher, Vasenblumen, eine antike Hängelampe, ein Marienbild und ein Totenschädel komplettierten die Einrichtung. Als wir die Mutter hineinführten sagte sie: es ist schön; aber katholisch! schwärmerisch!180 Ob die fromme Installation zur Abwehr des ortsansässigen Poltergeists dienen sollte, wie Walter Hagen vermutete, 181 ist nicht zu ergründen. Von bloßer religiöser Inszenierung konnte aber auch nicht die Rede sein, denn sonntags wurde für die Schwester die »Kirche« geheizt. 182 Die paranormalen Phänomene hingen dem Cleversulzbacher Pfarrhaus nach Ortstradition seit dem Tod von Eberhard Ludwig Rabausch, Mörikes Amtsvorgänger in neunter Generation, an. Von 1746-1759 hatte dieser in Cleversulzbach seinen Dienst versehen und sei, so wollte es das lokale Gerücht, in seiner Amtsführung so liederlich und als Mensch so verderbt gewesen, daß sein Geist noch immer den Ort der einstigen Verruchtheit unsicher mache. Der Grund für die Verärgerung war ein genau zu bezeichnender: Als Rabausch 1759 Cleversulzbach verließ, und nach Gruppenbach »promovirte«, kam das >Ehe- und Totenbuch< der Jahre 1667 bis 1705 abhanden. 183 Die Gerüchteköche waren freilich zu faul gewesen, um dort ebenfalls nach »Spuckereien« zu suchen, denn die angebliche Schlechtigkeit des Rabauschs dürfte nicht mit seiner »Promotion« von ihm gewichen sein. Höchstwahrscheinlich war Herr Rabausch ein vollkommen ehrbarer Mann und die Ähnlichkeit seines Namens mit dem im somnambulen Erkenntnisschlaf der Schwester von Frau Häufle ausgestoßenen Laut (von Kerner in der >Seherin< zu l8o
H K G A i 3 , S. 145, Z. if. - Hausbeschreibung nach Goes, S. 46. - Zeller, S. 242f. - HKGA 14, Anm. S. 431 zu S. 64, Z. 6. - Marie von Hügel in: Kerner [3], Jg· 3. Heft 3 (1845), S. 314. Vgl. dagegen: HKGA 13, S. 145· - HKGA 13, S. 1 4 4 - HKGA 13, Anm. S. 474 zu S. 144, Z. 25. - HKGA 13, S. 144, Z. 7-23. 181 Hagen, S. 118. 182 HKGA 13, S. 145, Z. 2f. ,8 3 Schick, S. 30.
91
»R-sch« chiffriert) könnte rein zufällig gewesen oder einfach die Bedeutung von Dieb, Räuber (Rabuscher, rabuscher = Dieb, stehlen 184 ) gehabt haben. Mörike erkannte nicht die Vorbehalte, die Kerner eine Verschlüsselung der schön passenden Lautfolge hatten ratsam erscheinen lassen. Er freute sich seines Fundes in den Kirchenfolianten und setzte wieder den gebeutelten, aber sehr poetisch klingenden Rabausch in die eigenen Spuknotizen. Kerner ließ dann im >Magikon< sowohl Name als auch Chiffre weg, weil er Mörike, »nicht den Injurien der Distelfresser aussetzen«' 8 ' wollte, die ihm bei all seiner tatsächlichen Naivität doch auch Verleumdung, gar persönliche, unlautere Beweggründe zu einer solchen üblen Nachrede hätten unterstellen können. Was über den Cleversulzbacher Pfarrhausspuk im einzelnen bekannt geworden war, bevor Mörike im Januar 1841 seine Beobachtungen zusammenfaßte, stammte aus Berichten der Pfarrer Leyrer, Hochstetter und Rheinwald. Durch mündliche und schriftliche Zeugen wurde überdies Spukaktivität zu Zeiten der Pfarrer Binder und Wolf belegt. Ein Inhaltsauszug aus Mörikes eigenhändigem Verzeichnis >Evangelische Pfarrer zu Clever Sulzbach H K G A 13, Anm. S.485 zu S. 152, Z. 1 7 - 2 1 . 186 Bergold/Scheuffelen, S. 6. l8
92
Mörikes Schilderung übertraf an Umfang, Detailreichtum die der übrigen Observatoren. E r zitierte die meisten unabhängigen Zeugen. A u c h ließ er diese mit eigenen Texten zu Wort kommen, was die Glaubwürdigkeit seines Berichts erhöhte. Der völlig ohne Mörikes Zutun entstandene Beitrag Marie von Hügels bestätigte 1845 mehrere der von ihm berichteten Einzelheiten. Allerdings muß man die spezielle psychische Befindlichkeit der Frau von Hügel zur Zeit ihres Aufenthalts im Pfarrhaus berücksichtigen, fühlte sie sich doch, »als hätten sich Menschen und Geister« gegen sie »verschworen«.' 8 7 Berichtete Spukphänomene im Cleversulzbacher Pfarrhaus [wann & w o publiziert] [wer berichtet]
[Phänomen/wann]
1829 Seherin, S. 215
Klopftöne an Wänden Atmen unterm Bett Kugelrollen Schritte eines Mannes Türen öffnen sich selbst (stets vor dem Tod eines seiner Kinder) Atmen aus hohler Brust oft unterm Bett Klopfen u. a. Töne Schritte eines Mannes schwarze Gestalt
Kerner referiert: [Hochstetter]
[Rheinwald]
[weibl. Person im Haus]
1840 Magikon Jg.i,H.i
[Schwester d. Fr. Hauffe]
scharze Gestalt unter seinem Fenster {Beobachterin ruft: »R-sch! hebe dich weg von mir!«}
Kerner referiert: [Hochstetter/Rheinwald]
(siehe oben; außer: Gestalt/»R-sch«)
[Mörike]
Gehen, Werfen, Schuß Wassertropfen Lichterscheinung
'«7 Kerner [3], Jg. 3, Heft 3 (1845), S. 314· 93
[wann 8c wo publiziert] [wer berichtet]
[Phänomen/wann]
1842 Magikon
Kerner referiert: [Leyrer]
Bettdecke weggezogen Kind plötzlich unter der Wiege gelegen im Garten unheimlich
[Hochstetter]
(siehe oben und:) Magd sieht schwarze Mannsgestalt und Geisterhund (!) (siehe oben und:) Ton von Schwirrholz Ton vom Uhraufziehen Spiegel bewegt sich Magd sieht schwarze sich nähernde Gestalt weibl. Person wird von schwarzer Gestalt angehaucht u. berührt 19.-30. August 1834 Fallen, Kugelrollen länglicher Lichtschein
Jg- 2 . H . 1
[Rheinwald]
Mörike berichtet
2.-6. September 1834 Klopfen an der Haustür Seufzer
4. September 1834 abends vor zehn Uhr Knall, ähnlich Schuß Berührung der Läden Sausen in der Luft Geräusch eines rückenden Kastens Schritte im oberen Boden
14.-15. Sept. 1834 Klopfen (hören auch Mutter, Bruder und Schwester) 16. Okt. 1834 Klopfen auf dem Oberboden imagin. Ziegelwerfen generell: Atmen, Schnaufen, Tappen, Schlurfen, Metalltöne
94
[wann & wo publiziert] [wer berichtet]
Mörike referiert: [Baltasar Hermann] [Charlotte Mörike]
[Klara Mörike] [Karl Mörike]
[Johannes Mährlen] (dito Mutter u. Klara) Karl Mörike berichtet
Gottl. Friedr. Sattler berichtet 1842 Magikon
Hochstetter berichtet
Jg· 2> H . 3
1845 Magikon Jg· 3 . H . 3
Marie v. Hügel berichtet
[Phänomen/wann] Gertenschlagen Schnellen in der Luft Reißen e. dünnen Fadens {Spukmaximum 1834; im Herbst/Winter stärker; v.a. gegen 4 Uhr vorher bei Leyrer, Hochstetter; von diesem mündliche Erzählung) Berührung mit rauhem Gegenstand 14.-15. Sept. 1834 Kissen gelupft 7.-8. Okt. 1834 hellweißer Schein 13. Nov. 1 8 3 4 , 1 - 2 U h r Geisterhund 2$. Okt. 1834 feurige Zickzacklinie Schnarren 9.-15. Okt. 1834 purpurrote Helle 6. Sept. 1834 wandernder Schatten 14.-15. Sept. 1834 Lichtschein, Poltern 29. Okt. 1840 Flämmchen Spuk hält drei Jahre an; monatelang fast täglich {H. zankt den Geist aus und hat fortan Ruhe} Spuk bei den Pfarrern Wolf, Binder von Verwandten bezeugt Türschlagen, Wiehern Stöhnen, Gehen Wasserpatschen Klopfen am Bett Gestalt im blauen Kleid
Tabelle 3 95
A m 15. Februar bat Kerner um eine Ergänzung des Berichts, da er v o n neuerlichen Aktivitäten des Geistes erfahren hatte. 188 Mörike lieferte daraufhin am 26. M ä r z 1841 folgende Meldung, die im A b d r u c k später fehlte: Herr Sattler wurde in der Nacht, etwa Morgens um 4. Uhr, durch oder vielmehr gleichzeitig mit einem Knall von solcher Stärke aufgeweckt, daß er nach dem Erwachen noch die, nach verschiedenen Seiten gelegenen, Fenster seines Zimmers klirren hörte. Der Knall sey durchaus dem eines Feuergewehrs gleich gewesen u[nd] innerhalb des Zimmers geschehen. Vor Kurzem hörte und fühlte er, ganz hell u[nd] ruhig wachend, eine unerklärliche Bewegung der steinernen Wand zunächst seines Bettes, als würde sie in ihrer ganzen Masse mächtig erschüttert u[nd] wie gerückt. Die andre Seite dieser Wand gehört einem anstoßenden Gemach, worin sich kein Mensch befand. Mag das aber nicht Täuschung gewesen seyn?' 8 ' Eine Episode, v o n der im Briefwechsel mit Hartlaub berichtet wird, fehlte bereits im ursprünglichen Bericht: A l s es im Dezember 1840 beharrlich im Vikarszimmer geklingelt hatte, war der Hausherr M ö r i k e mit dem Vikar Sattler auf die Suche nach einer natürlichen Ursache gegangen: Wir fingen daher an, den Boden aufzubrechen und handthierten begierig drauf los mit Stemmeisen und Hammer, allein er war doppelt gelegt und wir krazten uns hinter den Ohren; die Schwierigkeiten wurden immer größer, zulezt waren wir nur froh, als wir die Bretter wieder in ihre alte Lage zusammengepfuscht hatten.1'0 Schwester Klara wollte dies später nicht nur nicht bestätigen, sondern bestritt es heftig gegenüber dem Mörike-Forscher Harry Maync: Mein Bruder hat niemalen den Boden im Geister-Pfarrhaus mit dem Vikar aufgebrochen. Da wurden Sie, Verehrtester, falsch berichtet. 1 ' 1 Hatte M ö r i k e die Episode erfunden, u m die fade Geisterchronik für Hartlaub etwas würziger zu machen? Anstelle eines »Glöckchens« wurde im Spukbericht nur v o m Klang einer Stahlseite und anderen metallischen Geräuschen gesprochen, die »teilweise eben gegenwärtig
Vgl. HKGA 13, Anm. S. 499 zu S. 161, Z. 19. HKGA 13, S. 161, Z. 7-18. '9° HKGA 13, S. 145, Z. 10-15. 191 HKGA 13, Anm. S. 474 zu S. 145, Z. 10-15. 188
l8 ?
96
wieder an der Reihe sind«, und die auch Hermann Kurz bei seinem Besuch 1838 in Cleversulzbach vernommen haben wollte. 192 Mörikes Spukerzählung gehörte zum Lebendigsten und Poetischsten, was im Magikon versammelt war, wenn auch freilich keineswegs zum Spektakulärsten. Kerners Einleitung, in der er langatmig die geisterspezifische Bedeutung des Wortfeldes »schlappen« (Schlappschuhe), »schlurfen«, »schlurgen« (die Stiftsschlurgerin von Oberstenfeld, das Gehen in Schlurgen) etc. herauszustellen bemüht war, zeigte den Unterschied von beider Interessen. Kerner blieb bei aller mystagogischen Verquertheit der um Ästhetik unbekümmerte Geisterwissenschaftler, der vor den »gemeinen Spukgeschichten« und ihrer »armseligen groben Geisterwelt« 1 ' 3 nicht haltmachte, während Mörike eher ein sensitivpoetischer Erzähler der ihm unerklärlichen Begebenheiten war. Mörike referierte die ihn häuslich betreffenden Vorfälle bei aller beteuerten »Gewissenhaftigkeit« doch ästhetisch abwägend und nicht ganz ohne ein Lächeln. So unterhielt ich mich eines Abends bei Licht und bei der tiefsten Stille mit einem meiner Hausgenossen allein in jenem Gartenzimmer, als dieser Ton in einer Pause des Gesprächs zwischen unsern beiden K ö p f e n mit solcher Deutlichkeit sich hören ließ, daß w i r zugleich uns lächelnd ansahen. 1 ' 4
Daß sich im Pfarrhaus bei Nacht der »Ernst« einstellte, wiewohl sich Mörikes bei Tage »Gewalt anthun« mußten, um sich »nicht darüber lustig zu machen«, 1 " hinderte den Pfarrer nicht daran, lustige Gespensterszenen zu Papier zu bringen oder ins Gelegenheitsgedicht einzubauen. 196 A m 27. Dezember 1841 schrieb er an Hartlaub: Unser nächster Nachbar, nur über die Straße, ist ausgezogen (was wir sehr zufrieden sind, wenn ein besserer nachkommt) u[nd] das große Haus steht schon ein paar Monate ganz leer, wenn man den Geist nicht zählen will welcher drin gehen soll. Neulich sah ich jedoch etwas Lebendiges am Fenster. Bei
192
Kerner [ j ] , Jg. 2, H e f t 1 (1842), S. 1 7 . - Jennings [2], S. 109. - Brief E m m a von
Suckows an Kerner v o m 4. N o v e m b e r 1839. "'3 Menzel, S. 2 i 6 f . ' M Kerner [3] J g . 2., H e f t 1 (1842), S. 1 7 . Kerner [3], Jg. 2., H e f t 1 (1842), S. 9. 196 »[...] Fliehen, husch! die Spukgestalten, / Die, v o m Kirchhof dort herüber / Zaun und Hecke leicht durchschlüpfend, / Bald in langen Schneegewanden / [ . . . ] / A u f des Nachbars Kunzen Wiese / Unter schwarzen Bäumen lauschen, / Husch und husch, auf Kling und Klang! [...]« Zit. nach Krauss, S. 126.
97
genauerem Hinblick warens 2. rostgelbe Hühner oder Hahn u[nd] Henne, die auf dem Simse standen u[nd] wie Mann u[nd] Frau zur Kurzweil durch die Scheiben sahen. Wie sie dorthin gekommen weiß ich nicht. Es war wie ein Grimmisches Mährchen. 1 ' 7 Kerners Derbheit und Gewalttätigkeit im Umgang mit Geistern und ihren Geschichten, von der Alexander von Sternberg anekdotische Beispiele lieferte 198 , waren ihm fremd. Den Geist als bösen Buben auszanken - ein approbiertes Mittel Pfarrer Hochstetters - mochte er offenbar ebenfalls nicht. Als später ungebeten eine gastierende Somnambule im Haus dem Ortsgeist wirklich eine Strafpredigt hielt, stand er wort- und wahrscheinlich sprachlos daneben. Die Ereignisse im Haus hatten mit dem Schlußstrich unter Mörikes Text nicht haltgemacht; sie durchs Beschreiben zu bannen - falls dies Mörikes heimliche Absicht bei der Arbeit für Kerner gewesen sein sollte - war nicht gelungen. Mörike sandte noch einen weiteren namentlich gezeichneten Bericht an Kerner, der wie >Der Spuk im Pfarrhause< im 1. Heft des zweiten >MagikonInsektenbelustigungen< von August Johann Rösel vom Rosenhof legt die Vermutung nahe, er habe als Heranwachsender auch Insekten gejagt und gesammelt.
'7 H K G A 14, S.136, Z. 21-29. Wispel unterhält sich mit einem Buchdrucker, dem »Uchrucker«, über seine Zweifel an Linn£s System der Arten. Vgl. Werke, S. 737. 19 Bezeichnung für jede Art von subjektivem Freiraum im Hobby. Vgl. Cohen/ Taylor, S. 97. 20 Der Zwölffächerkasten war Mörikes Ordnungssystem für die Cleversulzbacher Amtsgeschäfte. Vgl. Zeller, S. 242f. 21 Brief an Wilhelm Hartlaub vom 2. August 1842. H K G A 14, S. 52, Z. 33f. und S. J3, Z. 1. 18
119
Bereits in seiner Cleversulzbacher Amtszeit war er 1841 mit geologischen Problemen konfrontiert worden, wenn auch auf unvermutete Weise: D a ich auf dem Spaziergang neulich an einen unserer im Walde gegen Weinsberg gelegenen Steinbrüche kam u[nd] die hohen W ä n d e nachdenklich betrachtete, fielen mir an denselben besondre Risse auf, deren Entstehung ich mir nicht bestimmt erklären konnte. Ein hiesiger Maurer, der viel dort arbeitet, ein frommer gesprächiger Mann, sagte mir später: das sey von Christi Leiden her (er sagte es mit einiger Bescheidenheit weil ich als Pfarrer es hätte wissen sollen). Daher schriebe sich auch der sogenannte Bergschnitt (neml[ich] die langen öfters haushohen Wandungen u[nd] Fluchten, in die der Fels sich theile). E r sprach davon mit solcher Zuversicht, daß ich auch nicht den kleinsten Zweifel dagegen zu äußern fähig gewesen wäre. 2 2
Mörike dürfte sich über die physikotheologische Deutung der Naturerscheinung gefreut haben - hatte er doch Johann Heinrich Brockes, den Verfasser des >Irdischen Vergnügens in GottErsten SalzbriefGeschichte von der silbernen Kugel< hinterließ Mörike einen halbautobiographischen Schnappschuß, der ihn in der Haller oder Mergentheimer Zeit als lokalgeschichtlich interessierten Pensionär und Petrefaktensammler zeigt. »Knisei«, ein »ausgedienter Steuereinnehmer«, nimmt seinen »Ruhesitz« in einer »freien Reichstadt«: Von seinem früheren öffentlichen Amte her war ihm ein canzellistisches Bedürfnis, eine spielende Schreiblust geblieben, die er indes doch keineswegs allein im Wege seiner administrativen Pflichten, vielmehr mit ungleich größerem Vergnügen an Gegenständen übte, durch deren Pflege er in eine ehrenwerte, wenn auch etwas weitläufige Beziehung zur Wissenschaft trat. Herr Knisei war Naturaliensammler, daneben Altertümler und entwickelte [...] eine nicht zu verachtende compilatorische Tätigkeit für die Geschichte und Topographie der alten Reichstadt [...]. In erst gedachter Eigenschaft muß ihm ein liebevoller Sinn und ein geübtes Auge für kleine stille Einzelheiten der Natur, Lebendiges und Totes, Stein, Pflanze oder Käfer zugestanden werden, das immerhin schon weit mehr ist, als man bei einem ganz verknöcherten Pedanten, wie sich der gute Mann dem ersten Anschein nach darstellen mochte. Sein systematisch in zwei hohen Schränken aufgestelltes, schön catalogisiertes Cabinet von Petrefakten, ein größtenteils längst vor der Heirat erworbener Besitz, enthielt nach dem Zeugnis von Kennern, manches beneidenswerte Stück, häufig mit einem Signo exclamationis (!) zum Zeichen des selbstgemachten Funds versehn [...]. Einen eifrigen Steinsammler fand er [...] im Stadtapotheker, Herrn , einem entfernten Vetter seiner Frau [...]. Bei der geringen Achtung, welche Frau Sfusanne] für diese Studien ihres Mannes 121
hatte, bedurfte es schon einer so namhaften Autorität aus ihrer eigenen Verwandtschaft, um ihre Meinung von dem Werte solcher Raritäten einigermaßen zu verbessern. Demungeachtet blieben jene beiden Schränke nebst anderen Seltsamkeiten in einer abgelegenen unheizbaren Kammer des obern Stocks verwiesen, so daß der gute Knisei sich hier seiner besten Schätze stets nur durch einen Teil des Jahres recht nach Lust erfreuen konnte. An weitere Erwerbungen war außer dem was Gunst und Zufall brachte seit lang nicht mehr zu denken, es wäre denn daß sich bisweilen in der Stille mit Erdarbeitern und Werkleuten ein kleiner Handel machen ließ. 24 Mörike verwendete hier vielerlei Selbstbeobachtungen und autobiographische Fakten - stets leicht verdreht (Rothenburg/Hall, Frau/Schwester, Vetter der Frau/eigener Vetter 2 ') - zur lebensechten Zeichnung der Figur. Knisels »canzellistisches Bedürfnis«, die »spielende Schreiblust«, war auch Mörike eigen, wie Listen und Exzerpte belegen, die er ohne großen momentanen Nutzen anfertigte. In einer anderen Skizze zur geplanten Novelle werden sowohl die wissenschaftliche als auch (durch die Bedenken der Frau) die leicht manische, obskure Seite der Sammelleidenschaft angedeutet: Steuereinnehmer als Petrefaktensammler. Ein Verwandter Pfarrer auf dem Lande, bei welchem er erzogen ward, ein vorzüglicher Mann, früher Professor, hatte dem jungen Vetter efinen] Begriff v[on] der Bedeut[un]g dieser Wissenschaft beigebracht, die noch in ihrer Kindh[ei]t lag. Dessen Samml[un]g u[nd] Bibliothek war ihm als Erbe zugefallen. Die Ausbreitung Aufstell[un]g. der beiden lezteren ist heimlicher Grund des Ankaufs einer großen Wohnung. Dennoch erlaubt die Frau die Eröffnung der 3 großfen] Kisten nur nach u[nd] nach.26 Der geplanten Novelle lag der Wunschtraum eines jeden Sammlers zugrunde: eine große Kollektion erben, wie durch ein Wunder die eigene Sammlung vermehren können, sie und damit förmlich sich selbst mit einem Schlag vergrößern. D e m Petrefaktensammler Mörike geschah dies in Schwäbisch Hall tatsächlich: A m 4. Mai kam ein kleines Faß die Haller Herrengassenstiege heraufgepoltert; Wilhelm Hartlaub hatte das in Wermutshausen gesammelte Material besonders gut verpackt, weil er wußte, daß es dem Freund »noch über Glas u[nd] Porzellan« 2 ? ging. Als
24 25
16 27
Zit. nach Maync [1], S. 182. Maync vermutet, daß Carl F. W. Mörike in Neuenstadt hier Vorbild war. Maync [i], S. 191. Zeller, S. 291, Exponat Nr. 258. H K G A 14, Anm. S. 549 zu S. 150, Z. 14. 122
rechter Bruder »Staudigel« verfaßte er einen nur dem Empfänger ganz faßlichen Steinfaßbrief: Hieranbei folgt eine Ladung Stein an den Salzburger Märkle, welche demselben gegen eigenhändige von i.) ihme selbsten und 2.) seiner Frl. Schwester ausgestellten Bescheinigung, die der Überbringer hierorts vorzuweisen hat, zugestellet wird. Königliches Pfarramt Steinbeis.28 Spätestens in Hall sah sich auch Mörikes Schwester im Bannkreis der Steine. Ein Spaziergang, der gemütlich und harmlos begann, wurde durch die Verwendung ausgefällten Wilhelms-Glücker Salzes zum Würzen mitgenommener Vesperrettiche behutsam dem Steinreich angenähert und endete beim Steinesuchen.2? Klara verhielt sich gegenüber Mörikes Steinbegeisterung keineswegs reserviert. Sie durchstöberte mit dem Bruder nicht nur die steinreiche Ohren- oder Wettbachklinge, sondern rettete ihm auch einige, vor dem Wiederaufflackern der Steinleidenschaft an seinen Freund Otto Schmidlin verschenkte frühere Fundstücke, als sie den Cleversulzbacher Hausrat nach Hall expedierte.30 A n Hartlaub schrieb Mörike am 22. Mai 1844: Noch immer leb ich viel im Alterthum u[nd] auch nach Steinen wird noch bei Gelegenheit gesucht; in welcher Beziehung zwischen hier u[nd] der Wermutsh[äuser] Gegend wenig Unterschied ist. Indessen wird sich Agnes über meine um zwei Drittel vergrößerte Sammlung, wenn sie dieselbe nächstens sieht, verwundern. Clärchen hat mir nemlich noch einen guten Rest meiner alten, gewißermaßen schon an Schmidlin verschenkt gewesenen Sachen, nach denen er jedoch nicht sonderlich verlangte, gerettet. Ich fand darunter noch ein paar in meiner Ludwigsburger Schulzeit gesammelte Stücke mit Vergnügen wieder. Durch mein Vergessen blieb eine Versteinerung bei Euch zurück, die Ihr auf der Mauer des Kirchhoftörchens finden werdet.' 1 Auch jenes schmerzlich vermißte Stück ging ihm nicht verloren. Wilhelm Hartlaub fand tatsächlich den »Stein, der auf dem Thörlein lag«, und gab ihn der Tochter Agnes, die Mörike beim Besuch der Hartlaubs Mai/Juni in Hall damit überraschte.
28
H K G A 14, Anm. S. 549 zu S. 150, Ζ. ιγί. Vgl. auch das
Haushaltungs-Buch,
S- 44· 29
»Nicht weit davon [Wäldchen zehn Minuten vom Lindachwehr; Anm. T. W.] stieß mir am selben Nachmittfag] (d. ι8Taschenkalender< meldete vom August 1844 entsprechend, man »gehe so oft als mögl. der Petrefactologie nach«.57 Vorgestern stand ich während eines Gewitters im Schutz der steinernen Wasserleitung [Aquaedukt über den Wettbach; Anm T. W.] bei der Schlucht am Kirchhof und schlug so lang es regnete, ruhig die Steine zu, die ich noch neulich mit Clärchen bei Seite gethan. Unter der hochgesprengten Wölbung däuchte mir der starke Donner noch einmal so schön. Nachher erschien die gelbe Sonne wieder und ich stieg die steinigte Kluft zwischen herbstlichem Gesträuch, mit meinem Abendbrot in d[er] Tasche, langsam hinauf. Das sind meine köstlichsten Stunden. Gestern fand ich hinter der Kirchhof-Capelle, w o viele Felstrümmer den Berg herabgestürzt liegen eine mir unbekannte merkwürdige Versteinerung, deren einer dickerer Theil (daumenstark), wie ein Geisfuß gestaltet in einen schmalen Stiel ausläuft; eine feine, glatte knochenähnliche Masse, ohne Zweifel aber ein Meergeschöpf; es steckt halb eingeschlossen in einem Block des härtsten Muschelkalks, von tausend und aber tausend Schaalthierresten umgeben; man kann ihm nur mit dem Meisel beikommen. 3 8 Dem erwähnten Petrefakt wurde mit einem am 21. September erworbenen weiteren Sammelutensil (einem »Steinmeisel f.e. Petrefakt« 39 ) zuleibe gerückt - möglicherweise etwas zu ungestüm, wie die lakonische Eintragung »Reparatur des Minerfalien].Hammers« 4 ® vom 28. September vermuten läßt. Die zwischenzeitlich gemachten Funde an den klassischen Hauptsandstein-Basisbonebed-Fundstellen 41 von Rieden und Bibersfeld - bemerkenswerte Saurierzähne, Knochen- und Panzerfragmente - waren dagegen Lesefunde: man brauchte keinen Hammer. Mörike zeichnete sowohl die Rieden/Bibersfelder Tierfossilien als auch die Pflanzenversteinerungen von Steinbach/Hessental, die er am 22. Juli mitgebracht hatte, verfasste eine detaillierte zugehörige Beschreibung und schickte beides als >Studien eines angehenden Petrefaktensammlers
Musterkärtchen< auf. Der Nachbar Johann Karl Friedrich Seiferheld wurde zur komischen Hauptfigur einer schier unglaublichen Fundbegutachtungsgeschichte: Samstag Nachmittag 4. Uhr. HE. Seiferheld liegt langweilig im Fenster und sieht in die Straße spazieren. Eduard seinerseits gleichfalls. Nachdem man sich begrüßt, Gespräch wie folgt. E. Ei Herr Nachbar! Ich hätt eine Bitte. Wollten Sie mir nicht ein wenig musiciren - Ich sehe Ihr Ciavier noch offen. HE.S. Mit Vergnügen; was wünschen Sie? E. Spielen Sie nicht den hübschen Petrefaktenwalzer? HE.S. Den - wie? nein, ich kenn ihn noch gar nicht. E. Vielleicht GERVILLIA PERNOIDAS aus dem TrigonienMergel? HE.S. Bedaure. Gleichfalls nicht. Das ist wohl etwas ganz Neues? E. Acht tausend Jahr wenigstens. HE.S. (Befremdet, etwas beleidigt.) E. Nun, so spielen Sie ins Teufels Namen etwas aus den Hugenoten. (Es geschieht u[nd] dauert sehr lang) E. Ich danke. Apropos, wollten Sie doch ihrem Bruder, dem HE. Stadtrath sagen, das rundliche Ding was er immer seine Muskatnuß nenne sey richtig wie ich vermuthete nichts anderes als ein Stachel vom CIDARITES CORONATUS
HE.S. Gut. Gestern haben meine Buben auch eine sonderbare Versteinerung mit heimgebracht E. Versteinerung? was? wo? - warten Sie, ich komme hinüber 42
«
Der am 28. September geschriebene Brief mit Zeichnung (vgl. Mörikes Kalender von 1844) an den Stuttgarter Professor Johann Gottlieb Kurr (1798-1870), der seit 1832 am Polytechnikum Naturgeschichte unterrichtete und später, seit 1840, auch am Katharinenstift tätig war, ist nicht nachweisbar. H K G A 14, Anm. S. $82 zu S. 172, Z. i7ff. Vgl. Zeller, Abb. S. 347. Kurr war ein Jugendfreund von Mörikes Bruder Karl. H K G A 14, S. 173, Z. 14-27. 126
(Es wird das lange Bret geholt und über die Straße in Seiferheids Fenster gerichtet, wobei er aus Verblüffung keine Hand anlegt, sondern nur zusieht was es geben soll; dann wird der Schemel aufgelegt, ich setze mich hinauf und fahre wie der Blitz ins Haus, wobei eine Scheibe mitgeht.) E. Wo haben Sie sie? ist sie noch ganz? ΗE.S. Sie ist ganz hin. (hebt ein paar Scherben auf) E. Die Scheibe, so? Ich meine den Stein. - Ach da ist er (Es zeigt sich eine ganz gewöhnliche Muschel u[nd] schlechtes Exemplar) Richtig. So. Hm. Ja. Ein PLAGIOSTOMA STRIATUM; nett das müssen Sie aufheben. Ja und also den Glaser will ich gleich schicken. HE.S. Es thut mir unendlich leid, Herr Mörike. E. Bitte. Übrigens ich heiße nicht mehr so; ich schreibe mich >von Meerigek HE.S. Unterthäniger Diener.·**
Nicht ganz zu unrecht fühlt sich Eugen Ungerer durch diesen Text »an die Grenze des Glaubwürdigen geführt, als ob er [= Mörike; Anm. T. W.], mit aller Schalkhaftigkeit seines Herzens, gutmütig lächelnd, leise spottend, mit uns sein loses Spiel triebe«. Dennoch kommt Ungerer nicht umhin, »die Breite der Straße« zu bedenken, »die Höhe des Hauses« und überhaupt »die Gefährlichkeit des Unterfangens«. 4 ' Noch heute wird diese Flunkerei von vereidigten Häller Stadtführerinnen unbillig für bare Münze verkauft. Doch gleichwie: Der Text ist ein beredtes Zeugnis für die Besessenheit, die einen Sammler auszeichnet. Er enthält nicht nur einen trefflichen Paläontologenscherz (»mindestens achttausend Jahre« als Alter des - wie man heute weiß und damals schon dimensionsweise wissen konnte - mindestens ein bis zweihundert Millionen Jahre alten Braunjura 46 ), sondern auch die bemerkenswerte Beobachtung formaler Ähnlichkeit zwischen einem Seeigelstachel und einer Muskatnuß. Uber die Versteinerung des Namens Mörike zu »Meerigel« (= Seeigel) kann man nur staunen. Vom 9. bis 19. Oktober 1844 war Mörike zu Besuch in Wermutshausen, wo er bereits den bevorstehenden Umzug nach Mergentheim bekanntgab. Auf der Rückfahrt erzählte ihm in Roth am See ein »Apothekerchen« vom Crailsheimer Bonebed-Petrefaktenhändler Emanuel Weißman; durch Hartlaub sollte er im August 1846 Stücke von dort erhalten.4? 44
H K G A 14, S. 174, Z. 18-29; S. 175, Z. 1-28. Ungerer, S. 246. 46 Stratigraphisch ungebräuchlicher Ausdruck, der aber nicht sinnlos ist. 4 ? Vgl. H K G A 14, S. 178, Z. 22-27. H K G A 14, Anm. S. 592 zu S. 178, Z. 2$f. Briefe an Hartlaub, S. 161{. 45
127
Z u Hause fand Mörike ein Steinpaket von Charlotte Krehl vor. Sie schickte ihm einen hübschen Korall u[nd] TURBINITEN, einen ansehnlich großen und bis auf den fehlenden Kopf vortrefflich erhaltenen Fisch aus dem Öninger StinkKalk. [...] Von der Nürtinger Großmutter lag eine große Chocoladetafel bei, deren Format der Stinksteinplatte ungefähr entsprach [...]. 4 " Mit dem Ohninger »Stink-Stein« aus der tertiären oberen Süßwassermolasse beschäftigte sich Mörike in Mergentheim später noch intensiver. Im Haller »Abzugsstrudel« holte er schließlich den verabsäumten Besuch der Steinsammlung in der Realschule nach, wie eine Stelle in seinen an Kurr geschickten >Studien< beweist. 49 Wilhelm Mosapp führte ihn Ende Oktober durch das »gut geordnete Cabinet«, das mit lokalen Funden reich bestückt war. Der selbstgesammelte Fossilertrag von Mörikes Haller Zeit sah folgendermaßen aus (soweit die Etiketten der erhaltenen Sammlung darüber Aufschluß geben können - hinzuzufügen sind weitere, in den Studien genannte Stücke): - Zahn von Ceratodus palmatus Plien[inger]. Im Keupermergel zwischen Bibersfeld und Rieden unweit Schw. Hall - Panzerstücke v[on] Sauriern und Koprolithen. Beides gemischt bei Rietheim (Schwäbisch Hall) gefunden, [acht Stück] - Gervillia socialis (Quenstedt). Bronn. Avicula socialis Bronn Leth[äa Geognostica]. Tf. XI.f.2 Sch Hall. Niederstetten - Nach Prof. Kurrs Vermuthung Fragment eines Calamiten nov[a] spec[ies] bei Rieden unweit Sch. Hall - Zahn von Mastodonsaurus Jaegeri alberti Bronn Leth. T[abula]. XIII f[igura] 16. bei Bibersfeld unweit Schw. Hall.
48 49
Brief an die Hartlaubs vom 23. Oktober 1844. H K G A 14, S. 180, Z. j - 1 1 . An Wilhelm Mosapp schrieb Mörike zwischen dem 22. und 26. Oktober 1844: »Ich hätte heut in meinem Abzugsstrudel noch wohl ein Stündchen zu erübrigen u[nd] wünschte es zur Besichtigung der bewußten Sammlung Ihrer Realschule zu benützen [...]« H K G A 14, S. 180, Z. 2 i f f . Vgl. auch H K G A 14, Anm. S. 595 zu S. 180, Z. 23. Mörikes zogen am 29. Oktober und 1. November 1844 um. Vgl. H K G A 14, Anm. S. 594 zu S. 180, Z. i2f. Aus Mörikes Adnote zu Kurrs Bemerkung zur Fig. 3. der >Studien< geht hervor, daß die in der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe (HKGA 14, S. 595, Anm. zu S. 188, Z. 24f.) in Frage gestellte Besichtigung in der Tat stattgefunden hat. 128
Studien eines angehenden Petrefaktensammlers
Die im Anhang mitgeteilten >Studien eines angehenden Petrefaktensammlers. Abbildung und Beschreibung einiger in der Umgegend von Schwäbisch Hall gefundenen Petrefakten mit Bemerkungen von Professor Kurr< von 1844 s0 s i n d literaturwissenschaftlich in zweierlei Hinsicht von Interesse. Erstens dokumentiert der Text, wie genau Mörike reale Dinge wahrnahm und beschrieb; zweitens gewinnt Mörikes Verhältnis zur Naturwissenschaft bei aufmerksamer Lektüre des Textes schärfere Kontur. Das genaue Hinsehen, die kontemplative Sicht auf das Ding hatte vorderhand den Zweck, den wissenschaftlichen Namen einer bestimmten fossilen Tierart zu ermitteln. Wohl aus Furcht, sie nicht wiederzubekommen, gab Mörike seine Schätze nicht aus der Hand, sondern schickte nur papierne Stellvertreter, sprich: Zeichnungen. Durch zusätzliche, möglichst genaue Objektbeschreibungen wollte er die Stücke dem Adressaten Kurr veranschaulichen: Fig. 1. Knochenstück, schwärzlich; die dichtere Oberfläche, dunkler gefärbt, schwarzbraun, dem Ansehn nach hornig, ziemlich glänzend, von körnerartigen, nicht ganz regelmäßig gebildeten, oft ineinander übergehenden Erhabenheiten besät, erinnert sogleich an eine Panzerbekleidung. Fig. 2. Knochen; meist weißlich, zumal die glatt anzufühlende Oberfläche mit ihren ungleichen Gruben. Am Rand ist ihre, aus dünnen Schichten bestehende Masse etwas wulstig vorgequollen.' 1
Beigefügte Vorabbestimmungen sollten Mörikes eigene Sachkenntnis unter Beweis stellen, wobei mittels eingeschobener Eventualitätsfloskeln dem befragten Fachmann gleichzeitig Abbitte geleistet wurde: Fig. 9. Knochenstück vielleicht vom Fuß, mit einem Durchschnitt, welcher vielleicht nur ein sehr gerader ebener Bruch ist Fig. 10. Vielleicht eine Rippe; von Farbe weißlich und bläulich; glatt anzufühlen. Fig. X. zweifelhaftes Fragment [...] Equiseten, aber welche Arten? Mörike vermerkte »1844/45«, obwohl Kurrs Antwort bereits 1844 (vor dem 23. November) eingetroffen war; der genaue Termin ist nicht bekannt. Mörikes Text entstand vor dem 28. September 1844. Evtl. plante er eine Fortsetzung der >StudienMergentheim mit seinen Umgebungen hervorgeht: Die vorherrschende G e b i r g s = A r t des Taubergrundes [...] besteht aus K a l k stein [...], der an der großen Menge von Trochiten, glatten Terebratuliten, gestreiften Chamiten, Mytuliten, knorrigen Ammoniten u.s.w. kenntlich ist, desgleichen an dem vielfach zerklüfteten, nicht selten Erdfälle veranlassenden, und an der L u f t bald verwitternden Wellenkalk, in dem schöne H e r z muscheln, Bukkarditen, Musculiten, auch knorrige Ammoniten gefunden werden.'4
Agnes Hartlaub erhielt am 6. November seinen Dank für neuerliche Steingeschenke," Wilhelm Hartlaub besichtigte mit Mörike zusammen
54
Schönhuth, S. 4.
"
V g l . H K G A 14, S. 1 8 3 , Z . 6ff.
131
am I i . November das herzogliche Naturalienkabinett. 56 A m 19., nachdem die Hartlaubs wieder nach Wermutshausen zurückgekehrt waren, stellte Mörike dem Freund Doubletten aus der eigenen Sammlung in Aussicht: Das kleine Allerlei aus meiner Sammlung wodurch ich Dir am besten mich vergegenwärtigen kann, will ich das nächstemal Zusammenthun.' 7 Alltägliche Dinge erschienen in Fossilmetaphorik, etwa im Bericht von jenem denkwürdigen Kuchenkränzchen, bei dem die Schwester eine leere Kuchenplatte auftrug: Eine porzellanene Kuchen-Platte schleppt sie nachträglich noch herbei, ein Ding vom größten Ammoniten-Format, zu einer Torte für 16 Personen!' 8 Selbst als Mörike dem Freund Hartlaub seine Heiratsabsichten mitteilte (er erwog eine Verbindung mit Friederike Faber), versah er seine A n deutungen mit einem geologischen Zusatz: Wer mir zur Hochzeit schenken wollte, beliebe die Artikel aus der LETHÄA GEOGNOSTICA zu wählen, denn das ist jezt mein CapitalWesen! Insonderheit würde bei gegenwärtiger Veranlassung ein versteinertes Kind, wie man sie neuerdings bei Stetten, OberAmt Gerabronn, zuweilen findet, nicht unschicklich s e y n . " Mit >Lethäa GeognosticaLethaea< an. 60 56
'7 '8
60
Mörike schrieb ihm am 18. November 1844: »Das waren doch ein paar besonders vergnügliche Stunden (im Cabinet des Herzogs meine ich) [...]. Wir müssens wiederholen.« H K G A 14, S. 188, Z. 19-22. Theodor Mörike gegenüber verlautete am 23. November 1844: »Im Kabinet des hiesigen Herzogs [...] sah ich Sachen, daß ich als wie im Traum durch diese Sääle zu wandeln glaubte. Sehr Schönes hat er aber auch aus unserm inländischen LIAS, von Sauriern.« H K G A 14, S. 192, Z. 4-7. Brief an Wilhelm Hartlaub vom 19. November 1844. H K G A 14, S. 190, Z. 4ff. H K G A 14, S. i 9 o , Z . 2 9 f f . Brief an Wilhelm Hartlaub vom 18. November 1844. H K G A 14, S. 188, Z. 1 0 - 1 5 . Man vergleiche nur die bei Koschlig auf S. I22f. wiedergegebenen Zeichnungen mit Bronns Tafel XI. r
32
Abb. y. Im Mergentheimer Naturalienkabinett. Zeichnung von Eduard Mörike
!33
A m ι j. November 1844 besuchte Mörike den freigebigen Pfarrer und Hobbygeologen Ottmar Schönhuth in Wachbach, der ihm bereits von Hartlaub als Sachverständiger empfohlen worden und dem er im April 1840 bereits einmal begegnet war. 61 >Musterkärtchen< über theologische Mißdeutungen geologischer Erscheinungen gingen am 18. November nach Wermutshausen; 62 einen Tag vorher war die erste lokale Exkursion 61
62
Vgl. H K G A 13, S. 96, Z.z-}(. »Schönhuthiana. // Den Schönhuth hab ich neulich doch [...] besucht. Er wies mir unter Anderm seine weitläuftige Bibliothek und ein Kistchen mit Mineralien aus denen ich mir nach Belieben wählen solle. Vorläufig steckte ich ein Pilz-Corall, (2 Fäuste groß, vom Randen bei Schaffhausen, TRAGOS ACETABULUM), einen mir unbekannten, unstreitig seltenen COCHLITEN von unbekanntem Fundort u[nd] einen Hohentwieler Pechopal in meine Manteltaschen, mit der Versicherung, ihm bald ein Weiteres abzunehmen. Es ist nur Schad daß man mit diesem guten Kerl ein ordentliches Gespräch, bei seiner Hast und abspringenden Wesen unmöglich führen kann, da er sehr vieles weiß u[nd] manches versteht was uns interessirt.« H K G A 14, S. 186, Z. 14-28. Mörike besuchte Schönhuth laut >Kalender< (SNM 2688) am 15. November 1844. H K G A 14, Anm. S. 606 zu S. 186, Z. 1 5 - 1 8 . Brief an Wilhelm Hartlaub vom 18. November 1844: »Musterkärtchen u[nd] Lesefrüchte. Zwei biblisch-mineralogische. // 1. / Als Beilage zu einem Aufsatz über den Steinbruch hei Öningen u[nd] dessen Petrefakten (in den Denkschriften der Gesellschaft schwäbischer Arzte u[nd] Naturforscher. B. COTTA 1805. 1 Bd) von einem D. Karg zu Constanz, fand ich eine gute Abbildung des durch den alten Scheuchzer so berühmt gewordenen Petrefakts, in welchem er einen entschiedenen Anthropolithen entdeckt zu haben glaubte.« H K G A 14, S. 184, Z. 15-23. - Josef Maximilian Karg (1762-1808) war Arzt und Naturkundelehrer. In dem 1805 in Tübingen erschienenen ersten Band der »Denkschriften der vaterländischen Gesellschaft der Ärzte und Naturforscher Schwabens« schrieb er >Über den Steinbruch zu Ohingen bey Stein am Rheine und dessen PetrefacteFunde von Figurensteinen verschiedenster Art auf den höchsten Bergen der Schweiz« einer sie bildenden Naturkraft oder einer alles übersteigenden allgemeinen Flut zuzuschreiben seien und ließ sich dann von dem Englän[d]er J . WOODWARD von der Sintflutlehre überzeugen. In ihrem Bann läßt er die versteinerten Fische aus den jungtertiären Ablagerungen des Maarsees von Ohningen am Bodensee in einer >Piscium querelae et vindiciae< betitelten Schrift (1708) bewegte Klage darüber führen, daß man sie so verkenne: >Wir sind Fische, nicht nur ... tierähnliche Gestalten, sondern ein von den Wogen herbeigetragenes Geschlecht, das als Opfer fremden Wahnes unterginge Zur Abrundung des Erweises galt es nun, des Wahnes Urheber, den in der Sintflut untergegangenen Menschen zu finden, was SCHEUCHZER auch zu gelingen schien. Erst sprach er Ichthyosaurier-Wirbeln aus dem Lias von Altdorf im Frankenjura menschliche Herkunft zu und gelangte dann nach gezielter Suche in den Besitz erst eines Schädels und dann eines ihn menschlich dünkenden Skeletts von der Ohninger Fundstelle, dessen Knochenbau er aufs
134
unternommen worden, »nicht ohne einige Ausbeute«, wie Mörike an seinen Vetter T h e o d o r schrieb. 63 Dieser hatte ihm eigene Stücke z u m Geschenk angeboten, und Mörike griff » A M A B U S « - mit Freuden - zu, sich selbst rundheraus als »SteinNarr« bezeichnend. 64 A u s der aufgefrischten Jugendneigung w a r eine ausgewachsene »Leidenschaft« geworden. Jeder Besucher - sei's Stadtrat oder Maurer 6 '
-
bekam die Sammlung vorgeführt. D i e Freunde wurden indessen ermahnt, nicht zu lachen. A n Otto Schmidlin schrieb Mörike: Mir ists ein rechter passionierter Ernst damit. (Sähst D u nur meine Sammlung jezt u[nd] wie mein Schrank voll geognostischer Bücher, Charten u[nd] Zeichnungen liegt f...]). 6 6 Alle Möglichkeiten zur Vergrößerung der Sammlung wurden erwogen, Freunde und Bekannte in den Dienst der Sache gestellt. Außer Wilhelm und Agnes Hartlaub, Klara Mörike und Gretchen Speeth hatte Mörike noch an die zwei Dutzend weitere Steinfreunde, die er mit Bitten und Aufträgen bestürmte, sofern sie ihn nicht von sich aus beschenkten. 6 7 scheinbar genaueste beschrieb. Erst Jahrzehnte später wurde es zunächst als Wels, dann als Eidechse und 1811 von CUVIER endlich richtig als Riesensalamander gedeutet, wie er unter dem Namen Andrias scbeuchzeri noch heute mit zwei Unterarten in Ostasien vorkommt.« Holder [1], S. i66i. 63 Mörikes Erkundungsgang führte auf den südwestlich von Mergentheim gelegenen Trillberg, in dessen oberem Teil die Haupttrochitenbreccie des Trochitenkalks (Oberer Muschelkalk) mit Encrinus liliiformis ansteht. Vgl. das Etikett: »Turbiniten. Aus dem Muschelkalk, vom Trillberg bei Mergentheim.« Zeller, S. 58. 64 H K G A 14, S. 191, Z . 28 und Z . 30. 6 ' Vgl. den Brief an Wilhelm Hartlaub vom 20. und 22. März 1845 ( H K G A 14, S. 229, Ζ. 23ΙΪ.) und den Brief an die Hartlaubs vom 1. Dezember 1847. Briefe art Hartlaub, S. 295. 66 Brief an Otto Schmidlin vom 13. Juni 1845. H K G A 14, S. 253, Z . 3iff. 67 Personen, die ihm Steine schickten oder mit ihm tauschten, waren: Ottmar Schönhuth (Brief an Wilhelm Hartlaub vom 18. November 1844. H K G A 14, S. i86)/Theodor Mörike (Brief vom 23. November 1844. H K G A 14, S. 191)/ Johannes Mährlen (Brief vom 12. Januar 184J. H K G A 14, S. i99f.)/Felix Buttersack (Brief an die Hartlaubs vom 18. Januar 1845. H K G A 14, S. 204)/Franz Baur (Briefentwurf vom 27. Januar 1845. H K G A 14, S. 2o8f.)/Ferdinand Jung (Brief vom 27. Januar 1845. H K G A 14, S. 2ii)/Karl Mayer/Fritz Mayer (Brief an die Hardaubs vom 29. Januar 1845. H K G A 14, S. 215 und an Karl Mayer vom 2. März 1845. H K G A 14, S. 22j)/Christian Friedrich Bruckmann (Brief vom 30. Januar 1845. H K G A 14, S. 326, Erschlossene Briefe 123)/ Friedrich von Hartmann (Brief an Franz Baur vom 27. Januar 1845. H K G A 14, S. 209)/Karl Rominger (Brief an Karl Mayer vom 2. März 1845. H K G A 14, S. 225 und Brief an Karl Rominger vom 5. April 1845. H K G A 14, S. 330,
135
D i e eigenen Funde und Käufe 6 8 traten während der Mergentheimer Zeit hinter die generalsstabsmäßig vorbereiteten Aquisitionen und das E i n tauschen 6 ' bei örtlichen Tauschpartnern zurück: mit Hilfe der G e o l o gischen Karte w u r d e n die ehemaligen »Compromotionalen« auf ihre Ausbeutbarkeit hin eingeschätzt; Bekannte, wie mißliebig sie M ö r i k e auch im allgemeinen vorkamen, konnte der Steinaquisiteur wenigstens von dieser Seite benutzen, da von den Gebern an den Steinen nichts hängen bleibt. 70 Gegenüber Hartlaub hieß es am 29. Januar 1845: Gestern ging endlich einmal wieder ein Brief an C . Mayer in Tübingen ab. Gelegentlich] gab ich ihm auch Aufträge an seinen Bruder der beim Hüttenwesen zu Wasseralfingen (unweit Aalen) angestellt ist, - in was Affairen, wirst Du leicht errathen, in eben diesen: an den Helfer Baur in Göppingen durch FERDINAND JUNG. 71 Erschlossene Briefe I37)/Friedrich Krauß (Brief an Wilhelm Hartlaub vom 20. und 22. März 1845. H K G A 14, S. 229)/Charlotte Krehl (HaushaltungsBuch, S. 314; Kalendereintrag am 17. April 1845. H K G A 14, S. 328, Erschlossene Briefe I28)/Friedrich Ostertag (Brief vom 6. April 1845. H K G A 14, S. 3 3 1 , Erschlossene Briefe 138 und Brief an die Hartlaubs vom 2 1 . Mai 1845. H K G A 14, S. 248)/Eduard Freiherr von E y b (Brief an Wilhelm Hartlaub vom 7. Mai 1845. H K G A 14, S. 246)/Otto Schmidlin (Brief vom 13. Juni 1845. H K G A 14, S. 255)/Marie Möricke (Brief vom 4. August 1845. H K G A 14, S. 2Ö4)/Karl Gottlob Schick (Brief an die Hartlaubs vom 24. Oktober 1845. H K G A 14, S. 28I)/Karl Rau/Christoph Friedrich Fraas (Brief an Wilhelm Hartlaub vom 14. November 1845. H K G A 14, S. 284 und Anm. S. 748 zu S. 284, Z. 9ff.)/Karl Mörike (Brief an Otto Schmidlin vom 13. Juni 1845. H K G A 14, S. 2J5)/Louis Mörike (Petrefaktensendung am 13. März 1850. Vgl. Simon, (1981), Sp. I92)/Wilhelm Gramm (Brief an die Hartlaubs. H K G A 14 Anm. S. 636 zu S. 204, Z. 12-20). Auf petrefaktologische Anfragen bei den Studienfreunden Wilhelm Deininger (vgl. H K G A 14, Anm. S. 685 zu S. 240, Z. 29ff.) und Karl Friedrich Hermann Wagner (vgl. H K G A 14, Anm. S. 671 zu S. 232, Z. 22-27), sowie bei Hartlaubs Schwager Gottlieb Friedrich Rieth (vgl. H K G A 14, Anm. S. 608 zu S. 188, Z . i7f.) sind keine Reaktionen nachweisbar. 68
69
70
71
Im Haushaltungs-Buch steht unter dem 19. Januar 1845 der Eintrag: »Versteinerung (Maurer Bauer)« Haushaltungs-Buch, S. 88. Tauschgelegenheiten werden im Brief an Mährlen vom 12. Januar 1845 und im Briefentwurf für den Brief an Franz Baur vom 27. Januar 1845 erwähnt. Vgl. den Brief an Wilhelm Hartlaub vom 20. und 22. März 1845. H K G A 14, S. 229, Z. i6f. Brief an die Hartlaubs vom 29. Januar 1845. H K G A 14, S. 2 1 5 , Z. 1 4 - 1 8 . Den Wunsch nach Ergänzungen zur Sammlung äußerte er gegenüber Karl Mayers Bruder Fritz Mayer (1794-1884), dem Geschäftsführer der Wasseralfinger Hüttenwerke, wahrscheinlich im nicht erhaltenen Schreiben vom 28. Januar 136
Der Entwurf zum Bittbrief an Franz Baur vom 27. Januar 1845 offenbart die ganze Unbescheidenheit des begierigen Sammlers: Laß mich nunmehr auf meine Bitte kommen. Ich habe mich im lezten Jahr viel mit Geologie, aus früher Neigung für dieß Fach, beschäftigt, u[nd] zugleich angefangen, auf den Grund einer kleinen Mineraliensammlung die ich aus dem Staub hervorzog, die vorzugsweise charakteristischen Versteinerungen zunächst die schwäbischen, zu sammeln. Was der Muschelkalk bietet u[nd] der Keupersandstein hab ich so ziemlich vollständig aus diesen untern Gegenden zusammengebracht, dagegen das was ich aus den andern Formationen 72 besitze besonders aus dem L I A S , in dessen ergiebigster Mitte Du, Glücklicher, sitzest, theils in sehr Wenigem theils in unvollkomnen Exemplaren besteht. Du würdest mich daher zum größten Dank verpflichten, wenn Du mir was Du irgend in gut erhaltnen Exemplaren aus Deiner Nachbarschaft auftreiben kannst, zurücklegen wolltest. Du kommst vermöge Deines Amtes mit vielen Leuten in Berührung, die im Feld im Steinbruch u.s.w. arbeiten u[nd] Dir gern einen Gefallen erweisen, kennst manchen Pfarrer u[nd] Schullehrer der deßhalb Aufträge ertheilen wird, vielleicht gar träte Dir unser berühmter Petrefaktolog HE. D. H A R T M A N N um ein gutes Wörtchen Dieß u[nd] Jenes ab, was duzendfältig bei ihm liegt und endlich führt Dich Dein Spaziergang auch hie u[nd] da an einer Kleinigkeit vorüber welche Dich nicht beschwert u[nd] mir viel Freude macht. Ich weiß, es ist seit einer Reihe von Jahren an den merkwürdigsten Fundstätten, vorzüglich] in B O L L großes Reissen darum, die reichen Sammler nehmen die Brüche in Beschlag u[nd] haben die Arbeiter verwöhnt: indeß ich verlange ja auch nicht ganze oder halbe I C H T H Y O S A U R E N , bin vielmehr was diese betrifft auch wohl mit einem kleinern Knochenstück, sofern es kenntlich ist, zufrieden u[nd] die meisten der übrigen Sachen, C O N C H Y L I E N sind reichlich vorhanden und machen so großen Krieg nicht. Könntest Du von Einer S P E C I E S , insonderheit von den kleineren Sachen 3-5 Exfemplare] bekommen so wär es sehr erwünscht, weil ich hier in Mergentheim gute TauschGelegenheit habe. Mit den Bestimmungen darfst Du Dich nicht bemühen entweder weiß ich sie bereits oder ich kann sie leicht in m[einem] Handbuch finden. Dagegen
72
1845. Fritz Mayer ging im Brief an den Bruder Karl vom 8. März 1845 auf Mörikes Bitte um Petrefakten ein und berichtete, daß wegen des Schnees augenblicklich nichts zu machen wäre; außerdem sei den dortigen Sammlern nichts aus ihrem Besitz entbehrlich. Wie aus Mörikes Kalendereintragung zum 13. April 1847 hervorgeht, hat Fritz Mayer spätestens damals Versteinerungen geschickt. Vgl. H K G A 14, Anm. S.651 zu S . 2 1 5 , Z. i5ff. Am 19. April 1847 bedankte Mörike sich brieflich bei Karl Mayer für die »mannigfaltig[en], mir großenteils noch neuen oder nicht eigenen Spectiniten, Ostren, Ammoniten u.s.w.« Unveröffentlichte Briefe, S. 197. Formation: durch charakteristische Fossilien und chemische Zusammensetzung abgegrenzter erdgeschichtlicher Zeitabschnitt. Heute vom Begriff »System« ersetzt.
137
würdest Du so gut seyn jeder Art ein Zettelchen mit Bezeichnung der Fundstätte (der nächstgelegenen Ortschaft) beizulegen. Hast Du einigen Vorrath beisammen so gibst D u mir wohl mit ein paar Zeilen Nachricht damit ich Dir e[ine] Gelegenheit zur Hiehersendung bezeichne. (Bei der Verpackung wäre besfondere] Vorsicht nöthig, jedes einzelne Stück in besondres Papier, nach Umständen doppelt, einzuwickeln; zärtere Sachen zwischen Baumwolle oder Wat.) 73 Das Charakterbild des befehlshabenden Sammlers Mörike ist kein sonderlich gutes. Zuträger, die sich ihm verweigerten und Steine zurückhielten, wurden - wie der »Erz-Schab« Kurr - mit Schimpf übergössen: Der Helfer SCHICK muß eine rechte Katze seyn. Dem Schönhuth zeigte er CONCHYLIEN u[nd] Seesterne die er vor Dir verbarg, ließ ihm jedoch so wenig als Dir etwas davon für mich ab. Dafür hat OSTERTAG eine zweite ziemlich starke Sendung mit JuraPetrefakten durch Gelegenheit eines reisenden Fruchtwucherers gemacht (die große neue Schachtel war durch runde frischgebohrte Mauslöcher von Daumensdicke sehr lustig signalisirt) Es ist allerdings wieder »Schönes darunter«, nur repetirt er sich anfangen stark. Dir ist bereits einiges Neue davon zugedacht. Von Jung sah ich noch nichts. Seine Frau, schrieb er damals, sey krank. 74 Die Geschenke, mit welchem A u f w a n d sie auch verbunden gewesen sein mochten, entsprachen nicht immer den Wünschen des Auftraggebers und wurden dementsprechend bemäkelt. Johannes Mährlen wurde am 12. Januar 1845 versichert: Auch das Geringste wird willkommen seyn. 75 D e m w a r aber durchaus nicht so. Friedrich Ostertags Sendung aus Neresheim wurde mit dem Satz kommentiert: Die Neresheimer Petrefakten sind zum Theil interessant.76
73
74
75 76
Entwurf zu einem Brief an Franz Baur vom 27. Januar 1845. H K G A 14, S. 208, Z. 22-36 und S. 209, Z. 1 - 2 7 . Im Kommentar der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe zu den Zeilen 3of. (HKGA 14, Anm. S. 643 zu S. 208) muß es (für Lias) statt »Weißjura« Schwarzjura heißen. Brief an die Hartlaubs vom 24. Oktober 184$. H K G A 14, S. 281, Z. 18-27. Karl Gottlob Schick (1806-1862) war seit 1838 Diakon in Creglingen. Brief an Johannes Mährlen vom 12. Januar 1845. H K G A 14, S. 200, Z. 1 1 . H K G A 14, S. 248, Z. 15. Friedrich Ostertag, Oberamtsrichter in Neresheim, schickte am 17. Mai ein Paket mit Versteinerungen. Vgl. H K G A 14, Anm. S. 744 zu S. 281, Z. 21. 138
Als Ferdinand Jung im August 1846 aus der Gegend von Bad Boll (am 27. Januar 1845 beiläufig darum gebeten) Petrefakten schickte, rezensierte Mörike die Gabe gegenüber Hartlaub wie folgt: Von einer solange erwarteten Sendung aus einer so berühmten Gegend hofft man sich viel und Außerordentliches. Wohl kam hie und da etwas Hübsches zum Vorschein, doch wenig, das ich nicht schon hatte: kleine, verkieste Ammoniten, ein paar willkommene Fragmente von seltenen, größeren Arten, einige mittelmäßig erhaltene Muscheln wie trigonia navis, Pflanzenversteinerung, Algaziten im Liasschiefer (wovon Dir auch ein gutes Exemplar bestimmt ist) usw. Kein Fisch, kein Loligo (da von dem Dr. Hartmann doch ein solcher schon bei dem Helfer Baur für mich niedergelegt war), dagegen hundert und aber hundert miserable Kleinigkeiten wie Glieder vom Pentacrinus cingulatus und subangulatus mit unendlicher Mühe jedes einzeln in saubere Papierchen gewickelt und alles wohl in Sägspänen gebettet. Bei so beschaffenen Dingen ist's ein wenig spaßhaft, daß er diesen Transport cavalierement ohne Brief gesendet hat.77 Trotz »mancherlei Geringem und mehrfach schon Besitzandam« 78 brachte Mörike auf dem Wege der Steinbettelei den größten Teil seiner Kollektion zusammen. Die Sammlung erschien ihm als steinernes Denkmal seines innersten Freundeskreises. A n Marie Möricke, die ihm auch einige »Zierlichkeiten aus den versteinerten Gärten des alten Neptunus« 79 geschickt hatte, schrieb er: Besonders war mir jener größere A M M O N I T aus der Boller Gegend [...] höchst erwünscht. Indem der größte und der beste Theil meines kleinen Cabinets durch Beiträge von meinen liebsten Freunden zusammen kam, somit der Catalog desselben eine Art von Stammbuch bildet, durfte allerdings Ihr Name darin nicht fehlen.8® Wilhelm Hartlaub war unstrittig der größte Spender unter allen »Steinkorrespondenten«. Seine bedeutendsten Stammbucheinträge waren eine
77 78 79 80
Briefe an Hartlaub, S. z6zi. Brief an Wilhelm Hartlaub vom 13. April 1847. Briefe an Hartlaub, S. 281. Brief an Marie Möricke vom 4. August 1845. H K G A 14, S. 264, Ζ. Brief an Marie Möricke vom 4. August 1845. H K G A 14, S. 264, Z. 21-27. I m selben Brief hieß es: »Sie haben mir durch Ubersendung jener Zierlichkeiten aus den versteinerten Gärten des alten Neptunus [...] eine ganz vorzügliche Freude bereitet, welche Clärchen, da Niemand meine Leidenschaft in diesem Punkte besser kennt, und auch noch Andere herzlich mit mir theilten. Was Sie für mich erobert haben, fehlte bis dahin meiner Sammlung entweder ganz oder besaß ich es doch nur in unvollkommnen Proben.« H K G A 14, S. 264, Z. 14-21.
139
Chirotheriumsfährte (oder, was wahrscheinlicher ist, ein Abguß), für den sich Mörike am i. Dezember 1847 bedankte, sowie eine am 4. Dezember 1846, dem Tag der der Bergbauschutzheiligen Barbara, dankbar empfangene Steinplatte mit einem Schädel von Ichthyosaurus. 8 ' Die von allen Seiten eintreffenden Steinsendungen und die anschließenden Tauschgeschäfte vermehrten die Kollektion so rasch, daß sich der Sammler in Fachlektüre vertiefen mußte, um die Neuzugänge halbwegs richtig einschätzen zu können. A m 20. April 1845 meldete er Hartlaub, der sich paläontologisch immer intensiver mit ihm austauschte:82
81
82
Vgl. den Brief an Hartlaub vom 1. Dezember 1847: »Aber nun den größten, brüderlichsten Dank fürs Chirotherium (Schöpfers Fußtritt, Gottes Auge)! So prächtig hatte ich mir das Exemplar nicht vorgestellt; ich bin so glücklich damit, daß es jedermann, auch dem rüdesten Laien, gezeigt wird. Gestern sah es ein borstiger Maurer, Du kannst Dir denken, mit welchem Gesicht.« Briefe an Hartlaub, S. 295. Im Brief vom 4. Dezember 1846 schrieb Mörike dem Freund: »Die Barbarae / »Unmittelbar vor meinen Augen auf dem Tische steht die große Platte mit dem Ichthyosauruskopf [...].« Briefe an Hartlaub, S. 270. Beide Stücke sind verschollen. Wilhelm Hartlaub fragte am 26. April 1845 »nach den mir verheissenen Steinen«. Als er sie am 5. oder 6. Mai erhalten hatte, schrieb er an Mörike: »Deine Ostrea ist mir in Wahrheit ein schmerzlicher Anblick, sie hat das Heimweh dahin, wo sie eigentlich hingehörte!« H K G A 14, Anm. S. 691 zu S. 245, Z. 4 - 3 1 . Die Bemerkung betraf wohl die Schönheit des Stückes, das in Hartlaubs Sammlung evtl. unangenehm (weil den Rest herabsetzend) auffiel. Mörikes Gedicht »Eine hübsche Ostrea [...]« (vgl. H K G A 14, S. 245, Z. 4 - 1 1 ) war dem Geschenk beigefügt und erläuterte den Hintergrund: Mörike dankte symbolisch für Hartlaubs Herstellung des Sammlerkontakts zu Ottmar Schönhuth. - Am 14. November sandte Mörike Hartlaub einen weiteren »verheisenen Naturalien-Beitrag in Deine Sammlung dem, wie ich hoffe, bald noch Einiges aus Boll nachfolgen soll. Dein Interesse an der Sache freut mich innig und es ist mir eine Lust es künftig immerfort durch neue Gaben zu vermehren. Der Vermittler der Baiinger Sendung, die meist aus kleinen Amraoniten u[nd] Turbiniten bestand, ist Pfarrverweser CARL RAU aus Plattenhart.« H K G A 14, S. 284, Z. 6-12. Karl Gottlieb David Rau (1815-1883) war der Bruder von Mörikes früherer Verlobter Luise Rau. Wie aus Hartlaubs Brief vom 20. November 1845 hervorgeht, hatten die »Steinfreunde Rominger und Fraas« die Sendung zusammengestellt. Christoph Friedrich Fraas war wie Karl Rominger als Paläontologe und Sammler bekannt. Vgl. H K G A 14, Anm. S. 748 zu S. 284, Z. 9ff. - Eine Sendung Hartlaubs erhielt Mörike am 1 1 . Mai 1846: »Soeben (den 13.) erhalten wir Schachtel, Muschel usw. mit den geliebten Zeilen, bester, liebster, einziger Freund!« Briefe an Hartlaub, S. 253. Beim Besuch von den Hartlaubs in Mergentheim [vgl. Simon, (1981), Sp. 165] kam es am 22. Mai 1846 zum zweiten gemeinsamen Besuch im herzoglichen Naturalienkabinett. Mörike zeichnet die Szenerie im Haushaltungsbuch. Die Erläuterungen der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe (HKGA 14, Anm. 140
Gegenwärtig lese ich einen langen geolog. Aufsatz Quenstedts in Bauers SCHWABEN [...],83
und am 7. Mai 1845 berichtete er: Ich stecke gegenwärtig bis über die Ohren in den Versteinerungen Wirtembergs, naturgetreu abgebildet pp vom Major v[on] Z I E T E N , 72 Tafeln des größten Formats S T U T T G A R T 1830-33. Dem H E . V [ O N ] , E Y B gehörig - Du triffst das Werk natürlich noch bei mir im Haus. 84 An Eigenfunden aus der Mergentheimer Zeit sind durch Etiketten bezeugt: - Turbiniten. Aus dem Muschelkalk bei Mergentheim - [...] Fühler=[Tentakel]=Theilchen von Encrinfus] liliif[ormis]85
83
84
85
S. 608 zu S. 188, Z. 21 f.) wären dementsprechend zu berichtigen. - Im August 1846 erhielt Mörike weitere Fossilien von Hartlaub: »Weil nun der große Segen, wenn er einmal wieder anfängt, gern unverhofft in Haufen kommt, so habe ich auch durch Dich, mein bester W[ilhelm], fast gleichzeitig einen sehr erwünschten Beitrag in den Crailsheimer Saurierresten, ohne Zweifel Knochen vom Nothosaurus und Mastodonsaurus Jaegeri,* die ich in solcher Größe nicht von Hall mitbrachte, bekommen.« Briefe an Hartlaub, S. 263. * In der zitierten Briefausgabe steht »Seegeri«; es muß jedoch heißen: Jaegeri. Hartlaub hatte sich des Hinweises auf den Petrefaktenhändler Weißmann im Brief Mörikes vom 23. Oktober 1844 erinnert. H K G A 14, S. 240, Z. 3 if. Friedrich August Quenstedt: Das schwäbische Stufenland. In: Schwaben, wie es war und ist. [...] Hrsg. von Ludwig Bauer. Karlsruhe, 1842, S. 270-374. H K G A 14, S. 246, Z. 16-19. Karl Hartwig Friedrich David von Zieten: Die Versteinerungen Württembergs, oder naturgetreue Abbildungen der in den vollständigsten Sammlungen, namentlich der in dem Kabinet des OberamtsArzt D. Hartmann befindlichen Petrefacten, mit Angabe der GebirgsFormationen, in welchen dieselben vorkommen und der Fundorte. Stuttgart, 1830-1833. - Zu Mörikes geologischer Lektüre gehörten neben den erwähnten Aufsätzen Quenstedts und Kargs sowie Bronns >Lethaea Geognosticac Friedrich August Schmidt: Die wichtigsten Fundorte der Petrefakten in Württemberg. Stuttgart, 1838. - Ferdinand Hochstetten Populäre Mineralogie. Reutlingen, 1836. - Friedrich August Walchner: Mineralogie und Geognosie. Stuttgart, 1839. - August Emil Reuß: Die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation. Stuttgart, 1845. - Friedrich August Quenstedt: Das Flözgebirge Württembergs. Tübingen, 1843. - Eduard Freiherr von Eyb ( 1 8 0 1 - 1890) war Schloßherr und Rittergutsbesitzer im nahe Mergentheim gelegenen Dörzbach. Die vollständige Etikettenaufschrift lautet: »Die Körner auf diesem Stücke Enkrinitenkalk (v[on] Mergenth[eim]) sind vielleicht nichts anderes als getrennte u[nd] durch Verwitterung veränderte Fühler=(Tentakel)=Theilchen von Encrinfus]. liliif[ormis].« Auf dem Stein befindet sich die Tuscheaufschrift: »Mergentheim.« 141
- Saurierschneidezahn Placodus gigas [...] / Von Ed. Mörike gesammelt / Mergentheim - Natica gregaria Schl[lotheim] / Muschelkalk / v[on] Efduard] M[örike] gfesammelt]. / Mergentheim - Acrodus lateralis / Muschelkalk / von E. Mörike gesammelt / Mergentheim - eingewachsene Enkrinitenkrone / Mergentheim - 3 Petrefakten aus dem Muschelkalk / gesammelt von Ed. Mörike / Mergentheim. 8i
H a n d l a n g e r der Wissenschaft? A l s sich Mörikes Freunde bemühten, ihm ein Einkommen zu verschaffen, erhielt das Interesse für Paläontologie unvermutet eine praktische Wendung. A m 3 1 . März schrieb L u d w i g Bauer an Mörike, daß einige »gute Stuttgarter« den Vorsatz gefaßt hätten, einem leidenden Dichter ein freieres Daseyn zu verschaffen. 87 Bauer beabsichtigte, Mörike eine Auftragsarbeit für den Buchhändler Göpel abzutreten. Außerdem wollten einige vermögende Bürger eine A r t Ehrensalär für ihn einsetzen. Mörike war hocherfreut und prinzipiell mit allem einverstanden, wofern nur erst Aussicht vorhanden wäre eine bescheidene Stelle für mich daselbst zu finden.88 Im Brief an Bauer vom 17. April 1845 erklärte er den »verehrten Freunden«, daß er gerne bei einer der »in Stuttgart aufgestellten wissenschaftlichen Sammlungen« tätig wäre: Bei [...] den Bibliotheken, dem Münz- Medaillen Kunst u[nd] Alterthümer und NaturalienCabinet sind zuverläßig einzelne untergeordnete Geschäfte, für welche eine weitere Hand erwünscht seyn würde. Mit Freuden könnte ich die meinige dazu anbieten. Besonders läge auch eine Mitwirkung für die zulezt genannte Sammlung mir nicht zu fern, da eine große Neigung für diese Gegenstände wie Du weißt in meinem Wesen ist u[nd] ich seit bald 2 Jahren mich insbesondre viel mit Geologie u[nd] Petrefaktenkunde abgegeben habe. (Wie viel es bei der Pflege eines solchen Cabinet immer aufs Neue zu completiren [...] u[nd] dergleichen] gibt, wie unendliche Aufmerksamkeit u[nd] 86
87 88
Nicht zuzuordnen sind fünf unbestimmte, ebenfalls mit »Mergentheim« bezeichnete Stücke. Bauer, S. 99. H K G A 14, S. 2)6, Z. 3off. 142
Zeit dieß Alles, wenn es recht geschehen soll, erfordert weiß ich aus eigner Anschauung u[nd] Erfahrung. Auch meine Übung im Zeichnen dürfte, zumal behufs der Correspondenz die etwa ein vorstehender Professor im Interesse [...] der Wissenschaft führen sollte, hier von Nutzen seyn.) 8 '
Mörike legte Bauer seine Finanz Verhältnisse in allen mißlichen Details offen' 0 und erklärte sich dankbar bereit, die Buchhändlerarbeit zu übernehmen, allerdings von Mergentheim aus. Da der Verleger tägliche Rücksprache verlangte, ließ sich Bauers Plan nicht verwirklichen. Umso fester klammerte sich Mörike an den Gedanken, aus der amateurgeologischen Betätigung einen Broterwerb zu machen. Bauers Bemühungen, die auf die Königliche Bibliothek gerichtet waren, blieben erfolglos, wie er dem Freund am 15. Mai mitteilen mußte: [W]ir werden stets auf der Warte bleiben, und der Hochwacht pflegen, soweit unsre Augen reichen. Ich denke, Gott wird doch einmal seinen Segen dazu geben. 9 '
Eine Hilfsstelle am Naturalienkabinett wäre Mörike nach wie vor am liebsten gewesen. Im Brief an Schmidlin hieß es am 13. Juni 1845: Wenn meine Liebe zu diesem Fach fürs Erste nur das unscheinbare Mittel würde, mich an das Ziel meines innigsten Wunsches zu bringen - was hätt gegen sich?' 2
Um zur Erfüllung von Mörikes »innigstem Wunsch« - einem halbwegs gesicherten Auskommen - beizutragen, bat Wilhelm Hartlaub Mitte Juni 1845 Ludwig Bauer noch einmal nachdrücklich, sich wegen einer Stelle für Mörike beim Königlichen Naturalienkabinett umzuhören, was dieser auch tat, am 22. Juni aber einen Negativbescheid mitteilte.'5 Während die Freunde in Stuttgart »der Hochwacht pflegten«, um dem Mergentheimer Pensionär eine finanzielle und seelische Befreiung zu verschaffen, entwickelte sich in Mergentheim zwischen Eduard und Klara Mörike und Margarethe Speeth ein inniges Zusammenleben. Ende März 1845 waren Mörikes in die neue Wohnung bei Kaufmann Katzenberger am Großen Markt (heute Am Markt j ) umgezogen, die sie bereits am 14. Januar angemietet hatten. In die Freundschaftsbeziehung
H K G A 14, S. 237, Z . 7 - 2 3 . 9° H K G A 14, S. 238, Z. 1 5 - 1 8 und Z . 28-32. ?I Bauer, S . 1 0 1 . H K G A 14, S. 253, Z. 34 und S. 254, Z. 1. » H K G A 14, Anm. S. 705^ zu S. 253, Z. 27ff.
143
zwischen Klara und Margarethe, der Tochter des todkranken Hausbesitzers Valentin von Speeth, wurde Eduard im Laufe des Jahres immer stärker einbezogen. Als Margarethes Vater am 10. August 1845 starb, zog sie in die Wohnung der Mörikes. Etwa 40 Gedichte, sowie die »Idylle vom Bodensee< entstanden 1845 und 1846. Mörikes »vitaler Tonus«, der in Hall und Mergentheim 1845 »sein Minimum erreicht« hatte, wie es eine medizinische Dissertation von 1945 lieblos-positivistisch formuliert, lebte wieder auf: Mörike hatte wieder ein Liebeserlebnis.'4
Daß diese positive »vitale Tonusschwankung« jedoch augenblicks eine hemmende Wirkung auf die Steinliebhaberei gehabt hätte, wäre irrig anzunehmen. A m 22. August 1845 schenkte Mörike Margarethe Speeth das Gedicht >Göttliche ReminiszenzLithogra-
110
Briefe an Hartlaub, S. 319. Im Januar 1853 schrieb Mörike an Klara nach Mergentheim: »Wenn ich mich nur so 14 Tage in das Dachkämmerchen bei Euch zu meiner alten Steinkiste setzen könnte, die ich ja ganz gewiß festzugenagelt lassen wollte.« Zit. nach Maync [1], S. 191. 112 Die Erwähnung der »Pappenheimer Petrefakten«, die der Bruder ihm aus Bayern schicken wollte, beweist vor der Hand nur sein weiterbestehendes Interesse und nicht eigene Sammelanstrengungen. Vgl. Unveröffentlichte Briefe, S. 363. " 3 Vgl. Unveröffentlichte Briefe, S. 376. 114 Unveröffentlichte Briefe, S. 373. Bebenhausen liegt an der Grenze zwischen Lias und Keuper. Paläontologisch wurde es bekannt durch die Saurierreste des Rhät-Lias-Bonebeds. Interessanterweise war es »Professor Kurr von Stuttgart«, der 1830 diese Schicht in Haus- und Gartenmauern des Ortes wieder entdeckt hatte. Vgl. Miller Endlich, S. 5. An der äußeren Klostermauer am Autoparkplatz, einige Meter rechts vom Treppenaufgang, sind solche Steine noch heute zu sehen. Quenstedt hat anhand eines Fundstückes von 1704, das sich in den Sammlungen des Tübinger Geologischen Instituts befindet, nachgewiesen, daß das Bebenhausener Bonebed schon früher bekannt war. Vgl. Quenstedt [2], S. 13. - Der von Mörike erwähnte Ammonit entstammt höchstwahrscheinlich dem untersten Lias (alpha 1), der im sogenannten Schwäbischen Lineament (einer durch Bebenhausen verlaufenden, großräumigen Einsenkung) 200 Meter unterhalb seines gewöhnlichen Schichtverlaufs vorkommt und beispielsweise am Naturdenkmal Bettelbachverwerfung zutagetritt bzw. am nordwestlich gelegenen ehemaligen Steinbruch auf der Bergkuppe als Deckschicht erschlossen ist. 111
149
phiae Wirceburgensis< markiert. A n Hartlaub schrieb er am ι. Dezember 1847: Wenn Du wieder hierherkommst, mahne mich dran, daß ich Dir in Martins Wanderungen durch Franken usw. nähere Nachrichten über jene höchst merkwürdige, dem D. Beringer vor 120 Jahren gespielte Mystifikation mit falschen Petrefakten zeige. [...] Es waren größtenteils phantastische und rein unmögliche Versteinerungen, welche man ihn in einem Berg bei Würzburg finden ließ, auch Gottesaugen, hebräische Charaktere, der Name Jehova u[nd] dergl., was er denn alles zu erklären sucht. 1 1 5 Verfasser des 1726 erschienenen Buchs 1 1 6 war ein Doktorand der Medizin namens Georg Ludwig Hüber. Der Doktorvater, Unidekan Johann Bartholomäus A d a m Beringer, hatte das prächtig ausgestattete Werk dem Fürstbischof Christoph Franz von Hutten dediziert. 117 1862 erhielt
115 116
117
Briefe an Hartlaub, S. 29 j. >Lithographiae/Wirceburgensis,/Ducentis Lapidum Figuratorum, a Potiori/ insectiformium, Prodigiosis Imaginibus Exornatae/Specimen Primum,/ Quod/in Dissertatione Inaugurali Physico-Histori/ca, cum Annexis Corollariis Medicis,/Authoritate et Consensu/Inclytae Facultatis Medicae,/ In Alma Eoo-Francica Wirceburgensium/Universitate./Praeside/Praenobili, Clarissimo & Expertissimo Viro ac Domino/D. Joanne Bartholomaeo/ Adamo Beringer,/Philosphiae & Medicinae Doctore, ejusdemque Professore/Publ: Ordin: Facult: Medicae h.t. Decano & Seniore, Reverendissimi & Celissimi Pincipis Wirceburgensis Consiliario, 8c Archiatro, Aulae, nec non Principalis Seminarii DD. Nobilium/& Clericorum, ac Magni Hospitalis Julianaei/primo loco Medico,/Exatlantis de more rigidis Examinibus,/Pro Suprema Doctoratus Medici Laurea,/annexisque Privilegiis rite consequendis,/Publicae Litteratorum Disquisitioni submittit/Georgius Ludovicus Hueber/Herbipolensis, AA. LL. & Philosophiae Baccalaureus,/Medicinae Candidatus./in consueto auditorio medico./Anno M . D C C X X V I . Mense Majo, Die//Prostat Wirceburgi apud Philippum Wilhelmum Fuggart,/ Bibliopolam Aulico-Academicum./Typis Marci Antonii Engmann, Universitatis Typographie Mit der Druckgeschichte des Werks verhielt es sich etwas anders als Mörike berichtete. Nicht Beringer oder Hüber, sondern der Bischof Hutten hatte versucht, mit einer Ablösezahlung die Verbreitung der Restauflage zu unterdrücken. Der schlaue Verleger Fuggart behielt zwar das Geld, stampfte die Auflage aber nicht ein. Nach Huttens Tod 1729 wurden die aufwendig ausgestatteten Bücher rasch und gewinnbringend verkauft, weshalb die Erstauflage des Werks heute nicht selten ist. Die Publikation schadete Hüber bei seiner weiteren Karriere keineswegs; er wurde später fürstbischöflicher Leibarzt. Vgl. das ^Kleine Feuilleton der Frankfurter Zeitung< vom 26. Januar 1899. Eine zweite, 1767 von T. Göbhardt in Bamberg aus den letzten übriggebliebenen Exemplaren hergestellte »editio secunda« gehört zu den bibliophilen Kostbarkeiten. 150
Mörike durch Marie Bauer drei der Hüber untergeschobenen Falsifikate aus der Sammlung des Professors C o n z , " 8 von denen eines auf Tafel IX der >Lithographiae Wirceburgensis< wiederzuerkennen ist. Er beschrieb sie in einem Dankgedicht an den Spender, von dem die Botin drei unangenehme Küsse hatte ertragen müssen; 1
den mystifizierenden
Fossilartnamen »Palaeoniscus« entlehnte Mörike Bronns >Lethaea GeognosticaGedichte und Briefe Mörikes an seine Braut Margarethe von Speeth< heraus. Vgl. Unveröffentlichte Briefe, Anm. S. 576 zu S. 263. Sie verfaßte einen ausführlichen Bericht über die Angelegenheit. Vgl. Rochall, S. 91L Vgl. die Tafeln zu Bronns >Lethaea Geognosticac »Paleoniscus« (Taf. X, Abb. 3). - Mörike dankte Marie Bauer am 27. November 1862. Vgl. Unveröffentlichte Briefe, S. 363. Am 27. August 1845 hat Mörike für Klara und Gretchen selbst einen Ammoniten gefälscht und mit »Amonites margarita clara« etikettiert. Abbildung bei Holder [2], S. 13. Im Garten an der Ackerwand. Vgl. Prescher, S. 11. 151
Abb. 6: Einer von Mörikes Sammlungskästen: Zündholzschächtelchen mit Fossilien.
A b b . 7: Drei Würzburger Lügensteine aus Mörikes Sammlung 152
Abb. 8: Tafel aus den »Lithographiae Wirceburgensis«. Rechts außen, in der zweiten Reihe von oben ist eines der Stücke zu sehen, die später in Mörikes Besitz übergingen.
153
verspürte keine amtliche Pflicht zum allumfassenden, systematischen Sammeln."' Seine Sammlung ist eine reine Regionalsammlung, die wie der Sammler selbst die Grenzen der Südwestdeutschen Großscholle kaum überschreitet. 124 Er hatte zwar wie Goethe befreundete Zuträger, die ihm von Zeit zu Zeit Petrefakten schickten, und entwickelte eine der Goetheschen durchaus vergleichbare »Energie im Begehren«. 12 ' Im Gegensatz zu Goethe achtete er ausdrücklich zuerst auf Schönheit und Seltenheit seiner Objekte; nur bei den Ammoniten erstrebte er eine gewisse Vollständigkeit der Arten. Der Sammler Goethe betonte am 23. Oktober 1812 gegenüber dem Kanzler Müller: Mir ist der Besitz nötig, um den richtigen Begriff der Objekte zu bekommen. Frei v o n den Täuschungen, die die Begierde nach einem Gegenstand unterhält, läßt erst der Besitz mich ruhig und unbefangen urteilen. U n d so liebe ich den Besitz, nicht der beseßnen Sache, sondern meiner Bildung wegen, und weil er mich ruhiger macht. 1 1 6
Mörike war dagegen Ästhet und blieb in Fragen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis letztlich doch Laie. Er fühlte sich von Goethes Altersnaturphilosophie angezogen, ohne ein dem Goetheschen vergleichbares naturwissenschaftliches Selbststudium absolviert zu haben. Goethe hatte sich am Ende seines unermüdlichen, in alle Richtungen aktiven Forscherlebens in die Unabweislichkeit geschickt, ein gewisses menschliches Ignorabimus angesichts der Natur zu akzeptieren; zugleich aber betonte er im Brief an Wackenroder vom 21. Januar 1832, daß es das Ziel der Wissenschaften sein müsse, diesen Rest an Unerkennbarem so klein wie möglich zu halten. 127 Mörike befand sich
123
Goethe begann 1 7 7 7 , als er seine bergbauamtliche Tätigkeit aufnahm, mit dem Sammeln v o r allem aus praktischem Wissensdrang. E r sammelte fortan über 50 Jahre, sein ganzes weiteres Leben lang, besser gesagt: Goethe ließ sammeln; er nutzte seine weitreichenden Kontakte zum Eintausch und Kauf von z u m Teil seltenen, einzigartigen Stücken von überallher. D e r A l l z w e c k diener Stadelmann schleppte tonnenweise Gestein herbei. N i c h t zuletzt auch in seinem Sohn A u g u s t hatte Goethe einen begeisterten häuslichen M i t streiter.
124
In der Sammlung befindet sich ein versteinerter Fisch aus der Braunkohle von Bonn.
125
Vgl. das Kapitel >Goethe als Sammler< bei M a x Semper. Semper, S. 229. Müller, S. 4. Erich Trunz betont in »Goethe als Sammler< vor allem den Bildungsaspekt der Goetheschen Sammlungen. Die Naturaliensammlung wird indessen nur gestreift. Vgl. Trunz, S. 6 1 . Goethe, S. 468.
126
127
1
J4
demgegenüber lebenslang in einem Zustand des Staunens gegenüber den Naturrätseln. Der Glaube an okkulte Phänomene, an dem er bis zuletzt festhielt, zeigte deutlich die Brüchigkeit seiner Weltanschauung. Was er wahrnahm, war nicht - wie bei Goethe - die Ganzheit der Natur, sondern es waren nurmehr einzelne, versprengte und widerstreitende Teile: innere und äußere Natur. Einzig mit Komik konnte Mörike den Zwiespalt zwischen objektivem Erkenntnisinteresse und subjektiven Erkenntnisgrenzen überwinden. Die gefälschten Hüber-Petrefakten standen mit diesem Dilemma in einer symbolischen, kontrapunktischen Verbindung: Hüber hatte alle seine Hirngespinste durch die falschen Steine bestätigt gefunden - Mörike gelangte durch all die echten Steine nicht zur Erkenntnis. Im Gedicht >Göttliche Reminiszenz< nahm er, der andernorts die dogmatischen Mißdeutungen von Fossilien gebrandmarkt hatte, selbst Zuflucht zu biblischen Deutungsmustern. 128 Mörikes Forscherdrang ging in religiöses Staunen über. Doch waren die verschiedenen Arten der Lebewesen wirklich durch Gottes Benennung entstanden, tatsächlich unveränderlich und scharf voneinander abgegrenzt? Der Darwinismus war in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts noch keine allgemein akzeptierte Theorie. Friedrich Rolle, der im Jahr von Mörikes Ehrendoktordiplom bei Quenstedt promovierte, suchte als einer der ersten deutschen Geologen, Darwins Thesen in populärwissenschaftlichen Werken zu verbreiten. Die Evolutionisten stießen jedoch überall auf erbitterten Widerstand. Mörike wurde von diesen wissenschaftlichen Umwälzungen ebensowenig irritiert wie von der 48er Revolte. In paläontologischer Hinsicht hing er offenbar - das bewiesen die Reaktion auf Quenstedts Brief und die Absicht, eine gewisse Vollständigkeit seiner Sammlung in bestimmten Gattungen zu erreichen - Linnes Theorie von der Unveränderlichkeit der Arten an. E s gibt so viele Arten, w i e viele verschiedene Formen das unendliche Wesen (Infinitum Ens) von Anfang an hervorgebracht hat. [...] Alle wahre Kenntnis stützt sich auf die Kenntnis der Art; wenn diese fehlt, schwankt alles. 1 2 '
Mörike war zweifellos fasziniert von der Tätigkeit des Bestimmens, die im Prinzip ein menschliches Nachvollziehen des göttlichen Benen-
128
12
V g l . den Brief an die Hartlaubs v o m 22. und 30. A u g u s t 1 8 4 5 . H K G A 1 4 , S. 2 7 0 , Ζ . 1 - 1 2 . M i t »Wort v o n A n f a n g « ist auf die johanneische L o g o s gleichung (Joh. 1 , 1 ) angespielt.
9 Zit. nach Holder [1], S. 169.
155
nens ist. Nach dem Etikettieren der Sammlungsstücke mit respektablen lateinischen Gattungs- und Artbezeichnungen war sein Forscherdrang jedoch gestillt. Die Dinge waren beim Namen genannt und in der Folge für ihn nur noch ästhetisch - als Schaustücke - von Belang. Der literarische Ertrag der Petrefaktenbegeisterung war gering. Mörikes Plan der >Geschichte von der silbernen Kugel< zerschlug sich, und übrig blieben einzig und allein einige »antediluvianische«130 Gelegenheitsgedichte. Renate von Heydebrandt hat schlüssig den Kunstcharakter der Mörikeschen Gelegenheitslyrik herausgestellt. Allerdings handelt es sich bei den Gedichten nicht um Produkte eines naturwissenschaftlich oder naturphilosophisch ambitionierten Poeten. Mörike konnte sich nicht wie Goethe zurücklehnen und sich erfreuen, »im Wissen eine Lücke ausgefüllt«1*1 zu haben - er hatte zur Naturwissenschaft nichts Bahnbrechendes beigetragen. Mörikes Steintexte sind denn auch keine Lehrgedichte, sondern allenfalls sozialgeschichtlich interessante Schnappschüsse aus dem biedermeierlichen Sammlerleben. Das Gedicht über die Auster vom 2. Mai 1845 (>Eine hübsche OSTREAGeschichte von der silbernen Kugel< (Maync [1], S. 190), im Gedicht für Oppel (Martin [2], S. 10) und im Brief vom 13. April 1847 an Hartlaub. Briefe an Hartlaub, S. 282. »Antediluvianisch« ist abgeleitet von Diluvium, dem lateinischen Wort für Sintflut. Diluvium war früher die Bezeichnung für die geologische Altersstufe des Pleistözän (= Eiszeitalter, untere Abteilung des Quartär, begann vor ca. einer Jahrmillion und endete mit der Würmeiszeit vor ca. 12000 Jahren). Das Wort »antediluvianisch« bedeutete für Mörike nichts anderes als vorsintflutlich.
131
Goethe, S. 468. H K G A 14, S. 245, Z . 4 - 1 1 .
132
156
Ferner sehr vergnügt über einen großen Ammoniten N.N. Aber was ich hier entdecke! Wahrlich, eine Zwirkelschnecke! Größer als ein Jägerhaus Schöpfer, wo will das hinaus? 1 ' 3
Im Gedicht >Der Petrefaktensammler< hat Mörike das einzige ihm wichtige strukturelle Verbindungselement zwischen dem Petrefaktensammeln und der Poesie genannt: das Finden schöner Stücke. Im Fall des Petrefaktensammelns sind es schöne Steine, im Fall der Poesie schöne Worte oder Verse. Wenn es vom Steinesuchen heißt, es sei »vielleicht auch Poesie«, ist bereits eingestanden, daß es bis zu einem gewissen Grade unzweifelhaft nicht Poesie ist. Wo das Petrefaktensammeln keine Poesie mehr ist und außer ästhetischem Urteil auch wissenschaftliches Denken erfordert, konnte Mörike es nur unter Selbstverleugnung betreiben. Ihn begeisterte die ästhetische, rätselhafte, auf ungewisse Weise religiös-mythologische Seite der Fundstücke. Wenn ihn die Betrachtung der Steine wirklich »sehend« machte, wie Renate von Heydebrandt in Hinsicht auf ein etwaiges gewandeltes Naturverständnis des späten Mörike andeutet, 134 so sah er in einen der Wissenschaft nicht zugänglichen Bereich. 13 ' Die Fossilien blieben für ihn bei allem Interesse an Herkunft und Gestalt etwas Geheimnisvolles; sie spielten als Sammelobjekte die Rolle von »Vermittlern« 136 zwischen dem nachsinnenden Betrachter und einer versunkenen, unsichtbaren, imaginären Welt. Indem Mörike die geologische Wissenschaft auch von ihrer lächerlichen Seite betrachtete und den Sammler Knisei in der kuriosen - indes beileibe nicht ungewöhnlichen - Situation sich vorstellte, wie er auf der Steinhaide [...] eine verdorrte Blume, die benagelte Sohle eines alten Schuhs für eine Versteinerung137 133 134
135
136 137
Briefe an Hartlaub,
S. 28if.
»Der Abstand des Ich zum Naturphänomen [...] bildet das Neue gegenüber der früheren Phase. Wurde er seinerzeit überhaupt gespürt, wie im Besuch in Urach oder in Mein Fluß, so als Beraubtsein oder gar Qual. Jetzt macht er den Dichter sehend und unabhängig.« Heydebrand, S. 160. Walter Benjamin schrieb in dem Aufsatz >Ich packe meine Bibliothek aus - Eine Rede über das Sammeln«: »Man hat nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände seiner Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in Händen, so scheint er inspiriert durch sie hindurch, in ihre Ferne zu schauen.« Benjamin, S. 170. Pomian, S. 45. Maync [1], S. 189. 157
ansieht
grenzte er sich v o m Wissenschaftler und vom ernsthaften
Sammler ab: diese verstehen in ihren Affären normalerweise keinen Spaß! Eine rühmliche Ausnahme war der Quenstedtschüler Albert O p pel, der sich 1 8 5 6 in witziger Umkehr von Mörikes vormaliger Anfrage bei Quenstedt wegen eines poetischen Kommentars zur Chirotheriumsfährte an ihn wandte. 1 3 8 Er bekam durchaus keinen ernsthaften Diskussionsbeitrag, sondern einen komischen und poesiekritischen Text zur Antwort: Für HE. Oppel (den Geologen) welcher mich um eine poetische Etikette zu einem Exemplar von Chirotherium Kaupii aus den Heßberger Sandsteinbrüchen bei Hildburghausen ersuchte. Es sind die handförmigen Fußstapfen eines noch unbestimmten Thiers. Ob Riesenfrosch, ob Beutelthier, War beides noch nicht zu ergründen; Die klare Fährte hätten wir, Doch nur ein OPPEL wird die Bestie selber finden. Käm' es zuletzt auf einen batrachum heraus, So hieße er vielleicht nicht übel jambicus. Denn wenn der Frosch nicht etwa springt, vielmehr nur geht, setzt er den kleinen Vorderfuß zuerst vor sich, Den Hinterfuß derselben Seite setzt er nach, Den ungleich größern, eben wie figura zeigt, Und hat somit den regulären Jambengang. Ein ältres Muster dieses Verses findet sich Wohl schwerlich als in Heßbergs Stein=Codicibus. 138
Erläuterungen zu den Heßberger Funden bei Bronn, S. 193 und Quenstedt [1], S. ioof. Als Oppel sich an Mörike wandte, hielt man die Fährten in Geologenkreisen für die von Batrachomorpha, d. h. von Amphibien, Riesenfröschen oder Lurchen. Allmählich kam man von der Annahme ab, daß es sich um ein ganz bestimmtes Tier handelt, das die Spuren hinterlassen hatte, sondern sah darin Spuren von »Labyrinthodonten verschiedener Größe und Art«. Fraas, S. 192. Zeitweilig galten die unbestimmbaren Fährten als Leitfossilien für ihren Horizont im oberen Buntsandstein (unterste Stufe der Trias). Labyrinthodonten heißt eine Unterklasse von Amphibien, die eine charakteristische Zahn- und Schädeldachform aufweist. - Albert Oppel war Quenstedts stratigraphischem Ansatz verpflichtet, auch wenn er Quenstedts fortschrittliches Denken, die Art- und Gattungsgrenzen betreffend, nicht voll erkannte und am d'Orbignyschen, »linnäisch anmutenden Begriff der unveränderlichen Art« (zit. nach Holder [1], S. 184^) festhielt. - Zur Datierung des Textes vgl. Martin [1], S. 145. - Über Oppels Beziehung zu Mörike ist nichts bekannt. Wäre er ein »Freund« gewesen, wie Martin schreibt (Martin [2], S. 9), hätte Mörike ihn wohl einmal erwähnt. 158
Die heutgen Frösche, weiß man, unsre dichtenden, Bewegen sich aus angeborenem Instinct In diesen Maßen mit besondrer Leichtigkeit. Ich, meines Theils, Herr Doktor, gäbe ungesäumt Für einen einzgen, nur zur Noth erhaltenen Antediluvianischen Batrachier Von gegenwärtger Species die ganze Schaar Des neuesten diluvii, das den Parnaß Vom Fuße bis zum Gipfel deckt, mit Freuden hin, Und meine Jamben billig alle obendrein.139 Was hätte der Poet mit dem versteinerten Riesenfrosch angestellt? Wäre jener es wert gewesen, daß man die gesamte moderne Dichtung, inklusive Mörikescher Jamben f ü r ihn w ü r d e hingegeben haben? Hätte Mörike auch seine anderen Versmaße für ein Exemplar der vollständigen Versteinerung geopfert? - Es bleibt unergründlich. Die Chirotheriumsspur und die Fährte des Sammlers Mörike verloren sich im Sand.
13?
Martin [2], S.jf.
159
Ö ω 4 —» Μη
Ih υ Ρ*
C
:0 .s ^ 'δ -T3 Ö I i 1> 3 ^ -T3 3 w Λ -D
rt
X
S1 υ (S
JS
υ 3 ÖJ3 co α e 3 ο -Ο • -ö a JS α > ν c οO u> Ö ο C > υ pq C -ο ε £-a ω β α 3 ή υ C 3 bO τ3 α > »ι α e V 3 α ^ -α u Ja & § « ja : s Ί -ι C u » π
3
"öo
«
13
υ > -ο G Ο C υ -C 2
ε
Β
S
C
«3 3
·
-U " ' S 2 5 > Ν3 -α
-ω « ι.
®3 S
« Β Ο Ζ
bt>
-a
τϊ
C
3 -iä 3 C Ο δ .2P-S 6BJ3 -3 j C υ ο S S 3 C «2 ; ^ ωh ^ a « U t3 ^ -β - J5 3 uu 3 ffi « < Ν W
.δ § δ 15 S a ΐί * t δ a -s
ι
S I S
5 3 δ -fä g ^
«
s
& § e 5 J, Ο c -f!
-s s SP 3 S
-β .s •Μ
ε I Ο CA~
*
· ? ' S 55 * 3 «> ·3 c tx> g JB (Λ 3 e « § ö .a es rt U 2 * 2 Sb a Εe ο £ "3 ! ' S a 5 a ,S » w < J3 Sffl2 ΙΛ
8 ν bß Pi
~0
3> js U HH Ϊ 3 ^ Ν G h 00 C Ε
ν
2> c
1n-i -ο lE 3 X -·Ρ
CL.
• Β*
. Λ 3 < ΙΛ ι:
α, · «ο c > .
Ι -
ίκ
JS-Sl « Ι Ö ι. " OS Η S » Μ Μ
ε 8 & -Si ο s «υ ν» »5 I Hi s & ε •β 5ε5 Q ο Ν" 8 S 'S «Λ ε -3 0Q
W • 4 -8
§
δ υ -st h»
κ ο f. δ o s δ s υ β 3 Ε ι Κ Ν -J"! «>·Β * Ρ 3 0) C e ο >
Hh α
« öb ο
"8 ε
"c s to ν
•O Q § u -5 ^ •S .sp b Λ ιλ ε α g Ö s =is -I
δ.
" . J g ε „· " 2 ^ .a S i S c S
β j Λ " •c «
S Ό τ
Literaturverzeichnis
Texte Eduard Mörikes HKGA Eduard Mörike: Werke und Briefe. Historisch-Kritische Gesamtausgabe im Auftrag des Ministeriums für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst BadenWürttemberg und in Zusammenarbeit mit dem Schiller-Nationalmuseum Marbach a. N . Hrsg. von Hubert Arbogast, Hans-Henrik Krummacher, Herbert Meyer, Bernhard Zeller. Stuttgart, seit 1967.
Werke Eduard Mörike: Werke. Hrsg. von Herbert G. Göpfert. München, 1993. Haushaltungs-Buch Eduard Mörikes Haushaltungs-Buch. Wermutshausen - Hall - Mergentheim. Faksimile der Handschrift erläutert und eingeführt von Hans-Ulrich Simon. Vorwort von Helmut Bausinger. Marbach, 1994. Briefe an Hartlaub Freundeslieb' und Treu'. 250 Briefe Eduard Mörikes an Wilhelm Hartlaub. Hrsg. von Gotthilf Renz. Leipzig, 1938. Unveröffentlichte Briefe Eduard Mörike: Unveröffentlichte Briefe. Hrsg. von Friedrich Seebaß. Zweite Auflage. Stuttgart, 1945. Mörike in Ochsenwang Mörike in Ochsenwang. Bearbeitet von Thomas Scheuffelen. Marbach, 1983 (= Marbacher Magazin, 27). Briefwechsel mit Wischer Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Friedrich Theodor Vischer. Hrsg. von Robert Vischer. München, 1926. Briefwechsel mit Storm Theodor Storm - Eduard Mörike Theodor Storm - Margarethe Mörike: Briefwechsel. Kritische Ausgabe in Verbindung mit der Theodor-Storm-Gesellschaft. Hrsg. von Hildburg und Werner Kohlschmidt. Berlin, 1978.
166
Weitere Literatur Baader, Franz von: Schriften. Hrsg. von Max Pulver. Leipzig, 1921 (= Der Dom, Bücher der deutschen Mystik). Bauer, Ludwig: Briefe an Eduard Mörike. Hrsg. von Bernhard Zeller und HansUlrich Simon. Marbach, 1976 (= Marbacher Schriften, 12). Bender, Hans: Die Verborgene Wirklichkeit. Aufsätze zur Parapsychologie III. München, 1985. Benjamin, Walter: Angelus Novus - Ausgewählte Werke Bd. 2. Frankfurt am Main, 1966. Bergold, Albrecht und Scheuffelen, Thomas [Hg.]: Mörike-Museum Cleversulzbach im alten Schulhaus. Die Ausstellung. Neuenstadt, 1996. Bergold, Albrecht; Salchow, Jutta; Scheffler, Walter: Kerner Uhland Mörike. Schwäbische Dichtung im 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1980 (= Marbacher Kataloge, 34). Bock, Emil: Boten des Geistes. Schwäbische Geistesgeschichte und christliche Zukunft. Stuttgart, 19JJ. Boelcke, Willi Α.: Sozialgeschichte Baden-Württembergs 1800-1989. Stuttgart; Berlin; Köln, 1989. Boll, Karl Friedrich: Okkulte Phänomene im Leben und Werk von Theodor Storm. In: Neue Wissenschaft 1968, Heft 1/2, S. 89fr. Bonin, Werner F.: Lexikon der Parapsychologie. Bern, 1976. Braungart, Georg: Poetische »Heiligenpflege«: Jenseitskontakt und Trauerarbeit in An eine Äolsharfe. In: Gedichte von Eduard Mörike. Hrsg. von Mathias Mayer. Stuttgart, 1999, S. 104-129. Bronn, Heinrich Georg: Lethaea Geognostica, oder Abbildungen und Beschreibungen der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen [...]. Erster Band [...]. Stuttgart, 1835-1837. Burckhardt, Jacob: Weltgeschichtliche Betrachtungen. Hrsg. von Rudolf Marx. Stuttgart, 1938. Camerer, Wilhelm: Genealogische Nachrichten und Briefe zu Eduard Mörike's Jugendgeschichte. Stuttgart, 1910. Carus, Carl Gustav: Vorlesungen über Psychologie gehalten im Winter 1829/30. Dresden, 1831. Cohen, Stanley und Taylor, Laurie: Ausbruchsversuche. Identität und Widerstand in der modernen Lebenswelt. Frankfurt am Main, 1977. Corrodi, Paul: Das Urbild von Mörikes Peregrina. Nachdruck. Kirchheim, 1976. Dessoir, Max: Vom Jenseits der Seele. Die Geheimwissenschaften in kritischer Betrachtung. Stuttgart, 1917. Eschenmayer, Adolf Carl August: Psychologie in drei Teilen als empirische, reine und angewandte. Zum Gebrauch seiner Zuhörer. Nachdruck hrsg. von Peter Krumme. Frankfurt am Main, 1982. Fliegner, Susanne: Der Dichter und die Dilettanten. Eduard Mörike und die bürgerliche Geselligkeitskultur des 19. Jahrhunderts. Stuttgart, 1991. Fraas, Eberhard: Der Petrefaktensammler. Ein Leitfaden zum Bestimmen von Versteinerungen. Unveränderter Nachdruck mit zusätzlichen Registern der 167
Fossilnamen nach der geltenden Nomenklatur durch Hans Rieber. Stuttgart; Thun, 1978. Frei, Gebhard: Probleme der Parapsychologie. München, 1969. Fröschle, Hartmut: Ein Dokument der Spätromantik. Der Briefwechsel zwischen Justinus Kerner und Johann Friedrich von Meyer. In: Jahrbuch des Wiener Goethe-Vereins. Neue Folge der Chronik 80 (1976), S. 75-88. Geiger, Ludwig: Briefe von Justinus Kerner an Varnhagen von Ense, In: Nord und Süd 92 (o.J.), S. 76. Gerber, Nikolaus: Das Nachtgebiet der Natur im Verhältniß zur Wissenschaft, zur Aufklärung und zum Christenthum. Mergentheim, 1840. Goes, Albrecht: Mörike. Stuttgart, 1941. Goethe, Johann Wolfgang: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, 40 Bde. Hrsg. von Friedmar Apel u.a., Abt. I: Sämtliche Werke, Bd. 13: Sprüche in Prosa. Sämtliche Maximen und Reflexionen. Hrsg. von Harald Fricke. Frankfurt am Main, 1993 (= Bibliothek deutscher Klassiker, 102). - Briefe. Hrsg. von Karl Robert Mandelkow. München, 1988. Görres, Josef von: Ausgewählte Werke und Briefe, Bd. 1. 1797-1819. Hrsg. von Wilhelm Schellberg. Kempten, 1 9 1 1 . Grüsser, Otto-Joachim: Justinus Kerner 1786-1862. Berlin, 1987. Hagen, Walter: Legenden um Mörike. In: Ludwigsburger Geschichtsblätter 25 (1973), S. 1 1 1 - 1 2 4 . Hauff, Wilhelm: Gesammelte Werke. 4 Bde. Eingeleitet von Dr. A. Schulze. Leipzig, 1925. Heydebrand, Renate von: Eduard Mörikes Gedichtwerk. Beschreibung und Deutung der Formenvielfalt und ihrer Entwicklung. Stuttgart, 1972. Hitzig, Wilhelm: Zum Härteischen Klavierbau seit 1807. In: Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härtel auf die Jahre 1929/30. Leipzig, 1930, S. 177-187. Holder, Helmut [1]: Kurze Geschichte der Geologie und Paläontologie. Berlin; Heidelberg; N e w York; London; Paris; Tokyo, 1989. - [2]: Schwäbische Juraforschung zu Quenstedts Zeit. Sonderdruck aus: Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 1950. Huck, Jürgen: Adolf Mörike. Bruder des Dichters und Instrumentenbauer zu Neuss. In: Almanach für den Kreis Neuss. Neuss, 1984, S. 70-90. Immermann, Karl Leberecht: Münchhausen. Eine Geschichte in Arabesken. Leipzig, 1940. Janssen, Hans: Eduard Mörikes Bibliothek. In: Philobiblon 1984, H . 1, S. 38-47. Jehle, Martin Friedrich: Adolph Mörike, der Klavierbauer. In: Schwäbische Heimat 1975, Heft 3, S. 24iff. Jennings, Lee B. [1]: Neues zu Mörikes Okkultismus, in: Neue Wissenschaft. Zeitschrift für Grenzgebiete des Seelenlebens 1968, Heft 1/2, S. 72-86. - [2]: Geister und Germanisten: Literarisch-parapsychologische Betrachtungen zum Fall Kerner-Mörike, in: Psi und Psyche. Neue Forschungen zur Parapsychologie. Festschrift für Hans Bender. Hrsg. von Eberhard Bauer. Stuttgart, 1974, S. 95-109.
168
Jung-Stilling, Johann Heinrich: Theorie der Geisterkunde oder was von Ahnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden müßte. Nördlingen, 1987. Kant, Immanuel: Vorkritische Schriften bis 1768. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Bd. 2. Frankfurt am Main, 1968. Kauffmann, Fritz: Eduard Mörike und seine Freunde. Stuttgart, 1965. Kerner, Else: Aus meinem Leben. Weinsberg, 1967. Kerner, Justinus [1]: Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere. Zwei Theile. Stuttgart, 1829. - [2]: Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur durch eine Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt und den Naturforschern zum Bedenken mitgetheilt [...]. Stuttgart, 1836. - [Hg.] [3]: Magikon. Archiv für Beobachtungen aus dem Gebiete der Geisterkunde und des magnetischen und magischen Lebens nebst andern Zugaben. Stuttgart, 1840-1853. - [4]: Winterblüthen. Stuttgart, 1859. - [5]: Bilderbuch aus meiner Knabenzeit [1886]. Hrsg. von Günter Häntzschel. Frankfurt am Main, 1978. Kerner, Theobald: Justinus Kerners Briefwechsel mit seinen Freunden, 2 Bde., Stuttgart 1897. Koschlig, Manfred: Mörike in seiner Welt. Stuttgart, 1954. Krauss, Rudolf: Eduard Mörike als Gelegenheitsdichter. Aus seinem alltäglichen Leben. Stuttgart, 1895. Kurz, Hermann [1]: Sämtliche Werke in 12 Bänden. Hrsg. von Hermann Fischer. Leipzig, 1903. - [2]: Gespräch auf dem Kirchhof zu Cleversulzbach. Mitgeteilt von Otto Güntter. In: Jahresbericht des Schwäbischen Schillervereins 1912/13, S. 8. Kurz, Isolde: Hermann Kurz. Stuttgart, 1919. Lahnstein, Peter: Eduard Mörike. München, 1986. Maier, Ulrich: »Wer Freiheit liebt«. Theobald Kerner Dichter, Zeitkritiker und Demokrat. Weinsberg, 1992. Martin, Gerald P. R. [1]: Die Briefe Albert Oppels an Friedrich Rolle aus den Jahren 1852-1861. In: Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 1961, S. 124-278. -
[2]: Ein »Diskussionsbeitrag« Eduard Mörikes zum Chirotherium-Problem. In: Natur und Museum 96 (1966), S. 9f. - [3]: Ein Leben für die Wissenschaft. Erinnerungen an Dr. Friedrich Rolle. In: Friedrich Rolle 1827-1887. Zum Gedenken. Hrsg. vom Geologischen Arbeitskreis der Volkshochschule Bad Homburg vor der Höhe. Bad Homburg, 1987. Mayer, Karl [Hg.]: Nicolaus Lenau's Briefe an einen Freund. Stuttgart, 1853. Maync, Harry [1]: Zwei fragmentarische Prosadichtungen Eduard Mörikes. In: Euphorion 10 (1903), S. 180-193. - [2]: Eduard Mörike. Zweite, stark überarbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart; Berlin, 1913. 169
Menzel, Wolfgang: Die deutsche Literatur. Bd. i. Stuttgart, 1838. Meyer, Herbert [Hg.]: Eduard Mörike. Zeichnungen. München, 1952. Miller Endlich, Frederic: Das Bonebed Württembergs. Tübingen, 1870. Miyashita, Kenzo: Mörikes Verhältnis zu seinen Zeitgenossen. Frankfurt am Main, 1971. Mörike, Karl [1]: Uber die Verbesserung der Gemeindeverwaltung als Mittel zum National-Wohlstand. Esslingen, 1822. - [2]: Des Vaters Geburtstag. Lustspiel in fünf Akten. Stuttgart, 1838. Mörike, Klaus Dietrich [1]: Karl Mörike, der Bruder des Dichters. Zur Frage seiner »demokratischen Umtriebe«. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 1975, S. 192-207. - [2]: Charakter und Begabung bei den Geschwistern des Dichters Eduard Mörike. In: Archiv für Sippenforschung 57 (1975), S. 64-73. - [3]: Mörike. Moericke, Möricke aus Breddin, Ostpriegnitz. In: Schwäbisches Geschlechterbuch. Neunter Band. Bearbeitet von Otto Beuttenmüller. Limburg, 1975, S. 89-288. Müller, Kanzler von: Unterhaltungen mit Goethe. Kleine Ausgabe. Hrsg. von Ernst Grumach mit Anmerkungen von Renate Fischer-Lamberg. Weimar, 1959· Navratil, Leo: Schizophrenie und Dichtkunst. München, 1986. Niebelschütz, Wolf von: Mörike. Bremen, 1948. Nindorf, Emma von [= Emma von Suckow]: Reisescenen in Bayern, Tyrol und Schwaben. Stuttgart, 1840. Notter, Friedrich: Eduard Mörike und andere Essays. Hrsg. von Walter Hagen. Marbach, 1966. Oberhauser, Fred und Gabriele: Literarischer Führer durch Deutschland. Frankfurt am Main, 1983. Peirce, Charles Sanders: Lectures on Pragmatism/Vorlesungen über Pragmatismus. Hrsg. von Elisabeth Walter. Hamburg, 1973. Pomian, Krzysztof: Der Ursprung des Museums. Berlin, 1988. Prawer, Siegbert Salomon: Mörike und seine Leser. Versuch einer Wirkungsgeschichte. Mit einer Mörikebibliographie und einem Verzeichnis der wichtigsten Vertonungen. Stuttgart, i960. Prescher, Hans: Goethes Sammlungen zur Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Berlin, 1978. Quenstedt, Friedrich [1]: Das Flözgebirge Würtembergs. Tübingen, 1843. - [2]: Der Jura. 2 Bde. Fotomechanischer Nachdruck der Erstausgabe von 1858, erweitert und ergänzt durch die heute gültigen Fossilnamen, überarbeitet von Α. E. Richter. Korb, 1995. - [3]: Klar und Wahr. Tübingen, 1872. - [4]: Ueber Pterodactylus suevicus [...]. Tübingen, 1855. Räderer, Olaf: Die Uberwelt im Lichte sensitiver Wahrnehmung. Das Lebensmotiv von Justinus Kerner in der Formulierung Dr. Herbert Fritsches. In: Radiästhesie 3 (1992), S. 1-23. Rath, Hanns Wolfgang [1]: Eduard Mörikes magnetische Heilung durch Johann Christoph Blumhardt im Juli 1848. In: Deutsche Rundschau 1917, S. 243-253. 170
-
[2]: Familienbriefe aus dem Nachlasse Eduard Mörikes und Nachrichten über das Leben des älteren Bruders des Dichters nebst unveröffentlichten Briefen. In: Zeitschrift für Bücherfreunde N.F. 1919, S. 1 1 5 - 1 2 8 . - [3]: Mit offnem Visier für Eduard Mörike! Mit offnem Visier gegen Eduard Jockel! Eine notgedrungen öffentliche Verteidigungsschrift [...]. Ludwigsburg, 1921. Rheinwald, Kristin: Eduard Mörikes Briefe. Stuttgart, 1994. Rochall, W.: Mörike und die Lügensteine. In: Kosmos 58 (1962), S. 9if. Schelling, Friedrich Wilhelm Josef von: Ausgewählte Schriften, Bd. 4. Frankfurt am Main, 1985. Scheuffelen, Thomas; Dambacher Eva; Dieke, Hildegard: Land der Dichtung Dichters Lande. Stuttgart, 1981. Schick, Friedrich: Zu Cleversulzbach im Unterland, Mörike und Cleversulzbach. Cleversulzbach, 1925. Schönhuth, Ottmar: Mergentheim mit seinen Umgebungen. Mergentheim, 1844. Schopenhauer, Arthur: Parerga und Paralipomena. Bd. 1. Wiesbaden, 1946. Schott, Heinz u.a. [Hg.]: Justinus Kerner. Jubiläumsband zum 200. Geburtstag. Weinsberg, 1991. Schubert, Gotthilf Heinrich: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Dresden, 1808. Semper, Max: Die geologischen Studien Goethes. Beiträge zur Biographie Goethes und zur Geschichte der Methodenlehre der Geologie. Leipzig, 1914. Sengle, Friedrich [1]: Mörike-Probleme. Auseinandersetzung mit der neuesten Mörike-Literatur (1945-50). In: Germanisch-Romanische Monatsschrift N.F. II (1951/52), S. 36-47· [2]: Voraussetzungen und Erscheinungsformen der deutschen Restaurationsliteratur. In: DVJS X X X (1956), S. 268-294. - [3]: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. 3 Bde. Stuttgart, 1971-1980. Sievers, Ingeborg: Die vitalen Tonusschwankungen Eduard Mörikes. Dissertation. Marburg, 1945. Simon, Hans-Ulrich: Mörike Chronik. Stuttgart, 1981. Sloterdijk, Peter und Macho, Thomas H.: Weltrevolution der Seele. Bd. 2. München; Zürich, 1991. Spinoza, Baruch: Ethik. Aus dem Lateinischen von Jakob Stern. Hrsg. von Helmut Seidel. Frankfurt am Main, 1982. Sternberg, Alexander von: Erinnerungsblätter aus der Biedermeierzeit. Hrsg. von Joachim Kühn. Berlin, 1919. Strauß, David Friedrich: Ludwig Bauer. Leipzig, 1862. Teitge, Hans-Erich [Hg.]: Storms Briefwechsel mit Theodor Mommsen. Weimar, 1966. Trunz, Erich: Goethe als Sammler. Goethe-Jahrbuch 89 (1972), S. 1 3 - 6 1 . Ungerer, Eugen: Mörikes Aufenthalt in Wermutshausen und Schwäbisch Hall. In: Württembergisch-Franken, N . F. 24/25 (1949/50), S. 237-258. Vischer, Friedrich Theodor: Kritische Gänge. Bd. 3. Berlin; Wien, 1920.
-
171
Wander, Karl Friedrich Wilhelm: Deutsches Sprichwörterlexikon. Bd. 3. Nachdruck. Darmstadt, 1964. Weissberg, Liliane: Geistersprache. Philosophischer und literarischer Diskurs im späten achtzehnten Jahrhundert. Würzburg, 1990. Weydt, Günter: Literarisches Biedermeier. In: D V J S I X (1931), S. 628-651. Wilpert, Gero von: Die deutsche Gespenstergeschichte. Motiv - Form - Entwicklung. Stuttgart, 1994. Wittkop, Gregor [Hg.]: Hermann Kurz 1813-1873 - Eine Chronik zu Leben und Werk. In: »Ich bin zwischen die Zeiten gefallen.« Hermann Kurz. Schriftsteller des Realismus. Redakteur der Revolution. Ubersetzer und Literaturhistoriker. Katalog und Ausstellung zum 175. Geburtstag. Stadtmuseum Reutlingen. Reutlingen, 1988. Wyss, Beat: Trauer der Vollendung. Von der Ästhetik des Deutschen Idealismus zur Kulturkritik an der Moderne. München, 1985. Zeller, Bernhard [Hg.]: Eduard Mörike 1804. 1875.1975. Stuttgart, 1975 (= Kataloge zu den Sonderausstellungen im Schiller-Nationalmuseum, 25). Zemp, Werner: Mörike. Elemente und Anfänge. Frauenfeld; Leipzig, 1939.
172
Namenregister Nicht berücksichtigt sind Eduard Mörike, Autoren von Sekundärliteratur sowie Firmen- und Verlagsnamen. Verweise auf die Fußnoten erscheinen kursiv.
Ahlefeld, Charlotte Wilhelmine von 89 Andler, Rudolf Friedrich Wilhelm 74 Apel, Johann August 60 Ariost 85 Arlt (Obristleutnant von) 31
Carus, Carl Gustav 5 $ Chamisso, Adelbert von 117 Chesterfield, Philip Dormer Stanhope Lord of 52/ Clermont (Fabrikant) 38 Conz (Professor) 151 Cuvier, Georges Baron de 135
Baader, Franz 54L Bauer, Ludwig 10, 1 2 , 1 4 , 3 j, 37, 6jf., 70, 76, 1 4 1 - 1 4 3 Bauer, Marie 151 Baur, Franz ijß, i}6{., 139 Bayern, Maximilian Kronprinz von 55 Beethoven, Ludwig van 83 Bengel, Johann Albrecht 1 1 9 Benjamin, Walter 157 Beringer, Johann Bartholomäus Adam 150 Beyer, Susanne (geb. Schmid) 104 Bezzenberger, Dorothea 15 Bezzenberger, Friedrich 28, 31 Binder, Friedrich Christian 92,95 Bloß, Ludwig von 46 Blumhardt, Johann Christoph 60, 1 1 2 Böhme, Jakob 5 2 Bonpland, Aime 118 Brauer, Friedrich 9 Brentano, Clemens von 5 5, j 7, 60, 104 Brockes, Johann Heinrich 120 Bronn, Heinrich Georg 128,132, 141,14151,1)8 Bruckmann, Christian Friedrich i j ] Burckhardt, Jakob 59 Buttersack, Felix i j j
D'Orbigny, Alcide i$8 Dannecker, Johann Heinrich 7 Darwin, Charles 1 1 5 , 1 5 5 Deininger, Wilhelm 136 Diepenbrock, Melchior von Dittus, Gottliebin 60 Droste-Hülshoff, Anette von i i y Eckermann, Johann Peter 76 Emmerick, Katharina 60 Ense, Karl August Varnhagen von 49, 60
Eschenmayer, Adolf Carl August 54. 5 79 Eyb, Eduard Freiherr von 1 3 6 , 1 4 1 Faber, Friederike 132 Fecht, August Leopold 36, 41 f. Feghelm, Johanna Franziska 99 Fichte, Immanuel Hermann 54 Fichte, Johann Gottlieb 54 Fink (Schreiner) 41 Flad, Rudolf 10,12-14,17 Fraas, Christoph Friedrich ij6, 140 Fraas, Johanna 70 Franckh, Johann Gottlieb 72,92 Fuchs, Nikolaus 131 Fuggart, Philipp Wilhelm 15 ο Garrick, David
32
173
Geibel, Emanuel 111 Georgii, Charlotte von 72 Georgii, Friedrich Eberhard von 6,7, 8f., 98 Gerber, Nikolaus 49, 54, jzf. Gfrörer, August Friedrich 35 Goes, Albrecht 115 Goethe, August 154 Goethe, Johann Wolfgang 50,53, 59. 74, " 7 . i j i , I 5 4 - I 5 6 Göpel (Buchhändler) 142 Görres, Joseph von 54, j ; , S7 Gramm, Wilhelm Hallberger, Ludwig Wilhelm Friedrich 35 Hanselmann (Hauswirtin) 120 Hardegg, Hermann 10, 12, 14 Hartlaub, Agnes 118,120,123-125, 131. 135 Hartlaub, Konstanze 84, 91,126, i3if., 136,138, iss Hartlaub, Wilhelm 2 , 1 2 , 1 4 , 35,36, 37.42,47. 6 4, 7°. 7 8 - 8 I , 84-86, 91,96f., 99, 102, io4f., 107, io9f., 114, 118-120, 122-124,12(>> 127, 13if., 132, 134-136,138,139f., 143, 146, 150, i s s f . Hartmann, Friedrich von 13s, 137, 139. Hartmann, Julie 75 Hauff, Hermann 82 Hauff, Wilhelm ; 7 Hauffe, Friederike 49,55, j^f., 61 (Abb.), 68, 84, 91,93 Heckmann, Jakob 23 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm 53f· Heine, Heinrich 28 Hermann, Baltasar 95 Heyse, Paul 44 Hirzel, Gottlieb Friedrich 92 Hochstetter, Ferdinand 141 Hochstetter, Gottlob Ludwig 87-89,90,92-95, 98 Hölderlin, Friedrich i03f. Hölderlin, Marie Eleonore Heinrike (verw. Breunlin) I03f. Horaz 15 I
74
Hüber, Georg Ludwig 150, 155 Hügel, Albert von 106 Hügel, Elisabeth 107 Hügel, Marie von (geb. ÜxküllGyllenband) 91,93,95, i o j - i 11 Humboldt, Alexander von 104 Humboldt, August von 118 Hutten, Christoph Franz von 150 Immermann, Karl Leberecht
84
Jäger (Geologe) i6if. Jamblichus j y Jean Paul 59 Jung, Ferdinand 19,13}, 136, i38f., 143 Jung-Stilling, Johann Heinrich 60, 62, 79 Jünger, Ernst ιτγ Kaim, Franz Anton 41 Kant, Immanuel 52 Karg, Josef Maximilian 134,141 Katzenberger (Kaufmann) 143 Kauffmann, Ernst Friedrich 10,14, 104 Kausler, Rudolf 76 Keller, Adelbert 85 Kerner, Emma 75 Kerner, Justinus 2f., 31,49-114 Kerner, Karl Friedrich Freiherr von 31.71.83 Kerner, Rosa Maria 77 Kerner, Theobald 105-109,7/0, III
Klotz, Franz 26 Kosegarten, Ludwig Theobul ι ι γ Krantz, Adam August 116 Krauß, Friedrich 136 Krehl, Charlotte 124, 128,136 Kurr, Johann Gottlieb 2f., 126, 128-130, 138, 145, 147,149, 160 Kurz, Ernst 76 Kurz, Hermann 49,74, 76, 78, 81, M · . 97.99*· Kurz, Isolde 7S, 100 Lachner, Ignaz 3 5,46 Lenau, Nikolaus 55, 71
Leyrer, Christian David Eberhard Liesching, Samuel Gottlieb Linne, Carl von 779,155 Lohbauer, Pauline 7, i } Lohbauer, Rudolf 7,43 Luther, Martin 104 Lyell, Charles 115
3)
Mährlen, Anne Katherina 6JF., 69 Mährlen, Johannes I 4 I f·. 46-48, 7of., 94f., 126, IJ6F. Mörike, Karl Eduard August (Sohn von Karl Mörike) 22
Mörike, Karl Friedrich 5 Mörike, Klara 2, 11, 41, 75, 83^, 9of., 94-96,99, 108, 118, 120, 122-125, i3lf-> I35> 1 39. 143. 1 49, Mörike, Louis 30,
}8,
41,46T.,
jf., 18, 21-23, 27^-> 84,91, I02f.,
IJ6, 149 Mörike, Ludwig Gottlieb 23 Mörike, Luise 5, 9, 11-13, 17, 64,
66, 6 7 , 7 8
Mörike, Margarethe (geb. Speeth) 135. H3. I i ' Mörike, Theodor 130,132, 135 Mosapp, Wilhelm 128 Mozart, Wolfgang Amadeus 10, 12, i 4 f .,38 Müller, Kanzler Friedrich von 154 Nabokov, Vladimir IIJ Napoleon Bonaparte (Napoleon I.) 9, 28 Nast, Wilhelm 66 Neruda, Pablo ι ι γ Neuffer, Christoph Friedrich Ludwig 7 Neuffer, Klara 7, iof., 14 Niebelschütz, Wolf von 80 Normann-Ehrenfels, Carl Fürst von 46 Notter, Friedrich 772,113 Novalis 60 Oberlin, Johann Friedrich 60 Oetinger, Friedrich Christoph 52 Oppel, Albert
2, 776,
Ostertag, Friedrich
I}6,158
136, 138
Pappenheim, Fernande Gräfin von 84 Passavant, Johann Carl 57 Peirce, Charles Sanders }6 Peristi, Karl 44 Perty, Maximilian 113 Planck, Auguste Friederike Rosina (geb. Beyer) 7 Planck, Gottlob Friedrich 7 Plotin ]7 Porphyrius ^7
175
Probst (Oberamtsrichter)
28
Quenstedt, Friedrich August 1,116, i4*> 145-148, 149, 155. ! 5 8 Rabausch, Eberhard Ludwig 2,91 f. Raisch, Georg Konrad 112, 124 Rau, Karl Gottlieb David 136, 140 Rau, Luise 26,27,28-30, 32,40,64, 69-7i7 Salve, Friedrich 102 Sattler, Gottlieb Friedrich 9jf. Savigny, Friedrich Karl von J 7 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 51, 53, S4,79 Schelling, Karl Eberhard von 54 Scheuchzer, Johann Jakob 134 Schick, Karl Gottlob 136, 138 Schiller, Elisabetha Dorothea (geb. Kodweiß) 34, 3 7 2 , 74 Schiller, Friedrich 22, 34, 72, 74, 77, ι ™ Schiller, Luise (verw. Franckh) 72> 74 Schiaich, Johann Friedrich 75 Schlayer (Minister) 104 Schmalzigaug (Regierungskommissar) 26 Schmid, Christian 1 1 Schmidlin, Otto 119, 123, 135,136, 143 Schmidt, Friedrich August 141 Schnitzer, Karl 86 Schönhuth, Ottmar 1 3 1 , 1 3 4 , 1 3 } , 138,140 Schopenhauer, Arthur 53, 55 Schott (Regierungsrat) 24 Schreiner, Johann Georg 10,14 176
Schubert, Gotthilf Heinrich 79 Schütte, Theodor 29 Schütz, Franz 41 Schulz-Euler, Carl Friedrich 22 Schwab, Gustav 32,72 Schwab, Sophie 77 Schweikle, Karl Friedrich 39f. Schwind, Moritz von 49 Seebold, Margarete 1 1 1 Seiferheld, Johann Karl Friedrich 126 Seiz, Johann Philipp 118 Sekkel, Johann Christian 102 Seydelmann, Carl 32 Simpfendörfer, Karoline Luise 101 Sontheim, Johann Georg von 104 Speeth, Valentin von 144 Spinoza, Baruch 5 1 , 5 3 Stadelmann, Carl 154 Sternberg, Alexander von 79, 98 Storm, Theodor 49, 87, i i 2 f . Strauß, David Friedrich 37, 42, } 0 , 5 j f . , 62, 67-69, 80, 83f., 102, 106 Struensee, Johann Friedrich 57 Suckow, Emma von 62, 80-83, 97, i o 4 Swedenborg, Emanuel
53
Thum und Taxis, Maximilian Karl Fürst von 38 Thum und Taxis, Therese Fürstin von 71 Thum und Taxis, Wilhelmine Fürstin von 71 Tieck, Ludwig 71,99, 100, 1 0 1 , 1 0 4 Uhland, Ernst Ludwig Gottlieb 13 Uhland, Ludwig 13, 67, 68, 71, j 2 , 84, 107 Vetter, Maria Ludwig 92 Vischer, Friedrich Theodor 49, ßo, 69L, io2f., 148
37,42,
Wächter, August Freiherr von 46 Wackenroder, Heinrich Wilhelm Ferdinand 154 Wagner, Hermann 136
Waiblingen Wilhelm 7 , 1 0 Walchner, Friedrich August 141 Walcker, Eberhard Friedrich 42 Weber, Carl Maria von 8,3 8 Weimar, Ernst Herzog von 89 Weimar, Wilhelm Herzog von 89 Weißmann, Emmanuel 117,141 Wendt, Amadeus 69 Wispel, Liebmund Amadeus Evangelist (Professor) 119, 151 Wittelsbach, Otto Prinz von 54 Woodward J. (Geologe) 134 Wolf, Gottlieb Friedrich 92,95
Württemberg, Alexander Graf von 84 Württemberg, Friedrich I. König von 7 Württemberg, Marie Prinzessin von 86 Württemberg, Wilhelm I. König von 7. 9 . 3 5 . 7 2 Zieten, Karl Hartwig Friedrich David 1 4 1 , 148 Zimmermann, Wilhelm 72 Zumsteeg, Emilie 32 Zumsteeg, Johann Rudolf 38
177
Abbildungsnachweise
Abb. I, S. 16: HKGA 10, S. 56 Abb. 2, S. 25: Eigenhändige Zusätze in Karl Mörikes Handexemplar von >Über die Verbesserung der Gemeindeverwaltung [...]



![Humanvermögensrechnung: Instrumentarium zur Ergänzung der unternehmerischen Rechnungslegung. Konzepte und Erfahrungen [Reprint 2019 ed.]
9783110860351, 9783110088533](https://dokumen.pub/img/200x200/humanvermgensrechnung-instrumentarium-zur-ergnzung-der-unternehmerischen-rechnungslegung-konzepte-und-erfahrungen-reprint-2019nbsped-9783110860351-9783110088533.jpg)

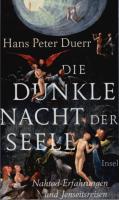
![Götter, Geister und Dämonen: Unheilsmächte bei Aischylos - Zwischen Aberglauben und Theatralik [Reprint 2011 ed.]
3598777280, 9783598777288](https://dokumen.pub/img/200x200/gtter-geister-und-dmonen-unheilsmchte-bei-aischylos-zwischen-aberglauben-und-theatralik-reprint-2011-ed-3598777280-9783598777288.jpg)


![Brüder, Geister und Fossilien: Eduard Mörikes Erfahrungen der Umwelt [Reprint 2014 ed.]
9783110925746, 9783484321083](https://dokumen.pub/img/200x200/brder-geister-und-fossilien-eduard-mrikes-erfahrungen-der-umwelt-reprint-2014nbsped-9783110925746-9783484321083.jpg)