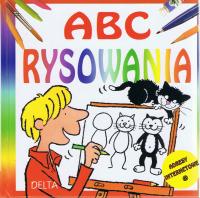ABC für Zwangserkrankte: Tipps einer ehemals Betroffenen 9783666462634, 3525462638, 9783525462638
115 65 318KB
German Pages [108] Year 2006
Polecaj historie
Citation preview
Ulrike S. / Hans Reinecker
ABC für Zwangserkrankte Tipps einer ehemals Betroffenen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.ddb.de› abrufbar. ISBN 10: 3-525-46263-8 ISBN 13: 978-3-525-46263-8 © 2006, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen. Internet: www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. Satz: SchwabScantechnik, Göttingen Druck und Bindung: Hubert & Co., Göttingen Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhalt Vorwort 7 Aberglaube 9 · Aidsängste 11 Alkohol 20 · Alternativen 21 · Angehörige 22 Angst 25 · Aushalten 26 · Bereitschaft 28 Brainy 29 · Demut 30 · Dinge 31 Durchhalten 36 · Eigenverantwortung 36 Energie 38 · Feind 39 · Freiheit 40 Gedanken 40 · Genuss 43 · Gesundheit 44 Gewohnheit 47 · Heimlichkeit 48 · Hölle 49 Humor 50 · Impulsiv 51 · Informationen 51 Job 53 · Konfrontation 56 · Kotherapeut/ Kotherapeutin 65 · Liebe 67 · Medikamente 68 Modelllernen 69 · Motivation 71 · Mut 73 Nie 75 · Normal 75 · OCD 76 · Offenheit 77 Perfektionismus 78 · Prinzipiell 78 · Q 79 Reaktionsverhinderung 79 · Ressourcenaktivierung 80 Risiko 83 · Rückfall 83 · Schamgefühle 85 Selbsthilfe 88 · Show 89 · Sicherheit 90 Stress 91 · Therapeutinnen und Therapeuten 92 Übungen 93 · Ungewissheit 94 · Verantwortung 95 Vergleichen 95 · Verhaltenstherapie 96 · Vermeiden 98 Vertrauen 99 · Vorlieben 99 · Warum? 101 Widerstand 101 · Wiederholungen 102 Xylophon 103 · Y 104 · Zeit 104 · Zweifel 105 Zuversicht 106 Literatur 107
5
Vorwort Zunächst ein paar Worte zu meiner Person. Ich war 27 Jahre lang zwangskrank: Kontroll- und Waschzwang, zwanghafter Ekel vor den Ausscheidungen anderer, ausgenommen jenen der eigenen Familie; Angst vor »Gift«, zwanghaftes Bedürfnis, die Wahrheit zu sagen, zwanghafte Schuldgefühle, Lesezwang und vieles mehr … Nach zwei Jahren Kognitiver Verhaltenstherapie konnte ich meine Krankheit überwinden und anschließend an meine eigene Therapie war ich 12 Jahre lang Kotherapeutin bei meinem früheren Therapeuten. Seit 14 Jahren bin ich gesund. Ich bin verheiratet, Mutter von drei Kindern und habe auch Enkelkinder. Dinge, die ich gern tue, sind Zeichnen, Malen, Lesen, Wassergymnastik im »nicht ganz sauberen« Schwimmbadwasser, Verwöhnen meines Zwergkaninchens, mich immer wieder einmal bewusst daran erfreuen, dass mein Umgang mit Familie und Enkelkindern ein zwangsfreier ist. Bei meinen Kontakten mit ehemalig oder noch am Zwang Erkrankten habe ich eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl, deshalb liegt mir das Schreiben für Betroffene recht am Herzen. Dieser Ratgeber setzt in gewisser Weise die Überlegungen aus meinen beiden früheren Büchern1 fort. Professor Hans Reinecker hat Ergänzungen aus fachlicher Sicht zu den Stichwörtern beigetragen. Ulrike S.
1 Ulrike S.; Crombach, G.; Reinecker, H. (2003): Der Weg aus der Zwangserkrankung. Bericht einer Betroffenen für ihre Leidensgefährten. 4. Auflage. Göttingen. Ulrike S.; Crombach, G.; Reinecker, H. (2002): Hilfreiche Briefe an Zwangskranke. Göttingen.
7
Aberglaube Der Aberglaube ist der kleine Bruder des Zwangs. In irgendeiner Weise sind sehr viele Menschen abergläubisch. Kennen Sie dieses Sprichwort: »Spinne am Morgen bringt Unglück und Sorgen. Spinne am Abend bringt Glück und Gaben.« Sie hören das, erinnern sich bei morgendlichem oder abendlichem Spinnenwahrnehmen an den Spruch, lächeln wahrscheinlich drüber und wissen: Die morgendliche Spinne war nicht Schuld, dass der Chef Sie blöd angesprochen hat, und die abendliche Spinne war auch nicht zuständig dafür, dass Sie beim Ratespiel im TV das Teeservice gewonnen haben (wobei Sie ohnedies lieber das Kurwochenende im Thermenhotel gewonnen hätten!). Lernpsychologisch gesehen handelt es sich beim Aberglauben um eine Verknüpfung von Dingen, Handlungen oder Ereignissen, die nichts miteinander zu tun haben – die allerdings mehrfach gemeinsam auftreten. So schafft der Mensch eine für ihn sinnvolle Verbindung. Sicher kennen Sie Basketball- oder Tennisspieler, die vor einem Wurf oder Schlag den Ball ein paar Mal auftippen. Das sind alles Handlungen, die irgendwann (zufällig) mit einem geglückten Schlag oder Wurf verbunden waren und die nun wie selbstverständlich durchgeführt werden. Anders beim Zwang: Der kann behaupten, Sie sollten besser gar keiner Spinne begegnen (auch nicht im Tierbilderbuch). Sie sollen darauf achten, dass eine Spinne nicht auf Ihrer frischen Wäsche herumkrabbelt, sonst müssen Sie alles wieder waschen (und den Wäschekorb schrubben). Sie sollten möglichst nicht einmal an eine Spinne denken, sonst müssen Sie Handlungen wiederholen, etwas reinigen, »gute Gegengedanken« oder »gute Gegenbilder« haben. Wer so von Spinnen geplagt wird, ist nicht abergläubisch, sondern wohl zwanghaft. Ich habe einmal einen jungen Mann betreut, der litt unter zwanghafter Spinnenangst. Die Wohnung von all dem 9
freizuhalten, was mit Spinnen zu tun hat, war ihm ausgesprochen wichtig. Er mochte allerdings auch außerhalb der eigenen Wohnung keinen indirekten und schon gar keinen direkten Kontakt mit Spinnen. Einmal haben wir im Wald geübt. Da ging er auf dem breiten Waldweg mit angewinkelten Armen und eingezogenem Kopf. So groß waren die Angst und der Ekel, mit Spinnen in Berührung zu kommen und eventuell Kontakte mit Spinnen über Körper und Kleidung in die Wohnung einzuschleppen. Wir konnten uns auch auf der Zwangsebene gut verstehen. Sein »Schmutz« hatte die gleichen Folgen und Befürchtungen wie »mein Schmutz«. So hatte ich keinerlei Schwierigkeiten, mich einzufühlen. Um einen – gefürchteten und doch erwünschten – Hausbesuch ist er nicht herumgekommen. Heute – Jahre danach – »beklagt« er sich noch, ich sei mit einer »Riesenspinne« (dabei breitet er beschreibend die Arme weit aus) ins Haus gekommen. Es war keine Riesenspinne, da hat der Zwang wieder einmal übertrieben. Sonst hätte ich sie ja auch gar nicht in das kleine Marmeladenglas hineinstecken können. Außerdem wäre ich selbst überfordert gewesen, mit einer Riesenspinne zu üben. Vor dem Hausbesuch mit der Spinne hatte ich eine Vorübung geplant, zum sich Gewöhnen an die Tatsache: Es gibt kein Leben ganz ohne Spinnen in dieser Welt. Mit viel Mühe habe ich erst einmal mit Buntstift ein Spinnennetz gezeichnet und recht detailgenau ein Spinnlein ins Netz gesetzt. Glauben Sie, er habe sich über das Kunstwerk gefreut? Hat er nicht. Nicht einmal anfassen wollte er das Zeichenblatt. Schon gar nicht »beschmutzen« wollte er die Wand in der Küche mit so einer ekligen Zeichnung. Später hat er das dann doch geschafft, aber noch lange das Gefühl gehabt, dass die Wand schmutzig sei. Die Spinnen mag er (und auch ich) noch heute nicht. Aber hinter einer Spinne herputzen muss er nicht mehr. Er duldet auch mal eine in der Wohnung (um in Übung zu 10
bleiben), aber nach einer begrenzten Aufenthaltserlaubnis muss sie raus. Nein, die Spinne wird nicht umgebracht, sie wird auch nicht mit dem Staubsauger aufgesaugt. Das hätte ich, die als Tierliebhaberin sogar das Leben von grauslichen Spinnen schützt, nicht geduldet. Er nimmt die Spinne mit einem Taschentuch auf und wirft sie aus dem Fenster. Und anschließend wäscht er seine Hände – nicht! Ist er nicht toll?
Aidsängste Ängste vor Aids werden vom Zwang sehr phantasievoll und sehr irreführend hochgespielt! Wenn ich hier von den zwanghaften Aidsängsten sprechen möchte, dann habe ich einen besonderen Grund dafür. Ich habe in meinen zwei Büchern für Betroffene (s. Fußnote 1, Seite 7) geblättert und festgestellt, dass die Aidszwänge eigentlich zu kurz gekommen sind. Schade, dabei habe ich doch einiges zu diesem Thema an KotherapieErfahrung dazugewonnen. Drei an zwanghafter Aidsangst leidende junge Leute habe ich begleitet. Das will ich gern weitergeben. Das tue ich also jetzt, in diesem Ratgeber von A bis Z. Wollen wir es angehen, das Problem rund um Aids und vor allem, was der Zwang daraus macht! Ich erzähle einfach einiges aus dem Therapiealltag von den drei Betroffenen und wie es ihnen gelungen ist, mit ihren übergroßen Ängsten fertig zu werden. Drei recht Geplagte sind das, denen der Zwang allerhand falsche Vorstellungen einredet, um ihnen das Leben schwer zu machen. Einige Male pro Woche sind wir dort unterwegs, wo sie allein in Notstand geraten würden. »Geh lieber nicht dorthin, mach einen Umweg drum herum!«, warnt der Zwang, »Nicht anfassen, vorsichtshalber desinfi11
zieren, waschen oder wegwerfen, vor allem die Wohnung vor Gefahren bewahren, an anderen nicht schuldig werden – sicher ist sicher!«, so argumentiert der Zwang. Da sind die Straßen mit den merkwürdigen Flecken auf dem Asphalt, trocken oder womöglich noch nass. Da werden Kaffeehaustische verdächtig, weil winzig kleine Brösel lebensbedrohend sein könnten. Alles Rote wird zur Gefahr. Wann ist Rot wirklich Rot? Ist Rotbraun einmal Rot gewesen? »Mir ist jeder Fleck verdächtig!«, sagt eine meiner drei Aidsängstlichen, »der kann auch grün oder blau sein, ich mag keine Flecken, die sind für mich zum Anzweifeln.« Kein Wunder, es ist ja die »Zweifelkrankheit«, die hier bald alles in Frage stellt. Fast schon überall möchte der Zwang warnen: »Achtung, Achtung«, sagt er, »hier könnte Gefahr bestehen! Hier könnte etwas passieren! Kannst du das verantworten?« »Wer weiß«, sagt der Zwang, »wann du die Rechnung für deine Unachtsamkeit und deinen Leichtsinn bezahlen musst! Vielleicht erst in weiter Zukunft?!« »Kommen Sie alle drei mit mir«, widerspreche ich dem Zwang, »ich begleite Sie überall dorthin, wo Sie in Gedanken daran schon unangenehme Gefühle bekommen, weil Sie noch zwangskrank sind – und wo in Wirklichkeit die reine Harmlosigkeit herrscht.« »Wobei kann ich mich wirklich anstecken?«, das ist zunächst die bange Frage bei den Überängstlichen. Wenn Betroffene mit der Information über die wirkliche Ansteckungsgefahr zufrieden zu stellen wären, dann hätten sie wohl gar keine Zwangserkrankung. Denn typisch für den Zwang ist, dass die Befürchtungen sich immer mehr und immer weiter von dem Ursprung, von der Tatsächlichkeit einer Befürchtung, in diesem Fall der realen Ansteckungsgefahr, entfernen. Die Befürchtungen des Zwangskranken haben aber einen wahren Kern (hier: Aids kann ansteckend sein) – unrealistisch und völlig überzogen werden diese Ängste erst 12
durch den Zwang. Es ist wichtig, in der Therapie die Realität der Befürchtung und dementsprechend angemessenes Standardverhalten zu besprechen. Über die wirkliche Gefahr einer Ansteckung durch Aids unterrichte ich meine »Schützlinge« kurz und bündig und so dürfen auch Sie das annehmen, liebe Ratsuchende. Kurz und bündig ist gut, denn der Zwang liebt im Gegenteil lange Diskussionen: »Wäre es nicht doch möglich, dass …?«; »Hast du wohl bedacht, dass …?«; »Es könnte doch die Ausnahme gelten, dass …?«; »Weißt du, wie das in zehn Jahren aussieht?«; »Ist Wissenschaft wirklich so verlässlich?« Solche Verunsicherungen liebt der Zwang. Hier möchte ich als Aufforderung zum Vertrauenfassen aus dem Vorwort von G. Crombrach unseres Buches »Hilfreiche Briefe für Zwangskranke« zitieren: »Ich vertraue auf die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Zwangsbehandlung auch dann wirksam ist, wenn die Unbegründetheit meiner langfristigen Befürchtungen nicht bewiesen werden kann (z. B. Strahlenschaden, Aids, Hölle). Wissenschaft ist im Prinzip vernünftig, ausschließlich Beweisbares gibt es nun mal nicht auf dieser Welt. Aids kann ansteckend sein. Das ist keine Zwangsvorstellung. Der Zwang hat seine eigenen Gesetze – hierbei handelt es sich nicht um reale Befürchtungen, sondern um zwanghafte, sprich aufgezwungene und wirklichkeitsferne Befürchtungen. Die unüberwindbare, stets präsente Furcht, sich an Aids anzustecken, sich dadurch die Freiheit in Entscheidung und Handeln nehmen zu lassen, das hat mit dem vernünftigen Umgang mit dieser Krankheit nichts mehr zu tun. Das ist behandelbar, so wie die Zwangsangst wegen Schmutz, Schuld, brennendem Haus auch. »Sie haben es noch relativ gut gehabt mit Ihrem Zwang – Ihr größtes Risiko war, zu dreckig zu werden. Das kann man abwaschen. Ich mit meiner Aidsangst fürchte die Krankheit und den Tod«, das wurde mir schon des Öfteren von Betroffenen gesagt. Die hatten mich um die Art meiner 13
Zwänge »beneidet«. Mir wäre es damals so manches Mal ziemlich gleich gewesen, an einer schweren Krankheit zu leiden, dann wäre ein Ende absehbar gewesen. Ich denke, es kommt bei der Zwangserkrankung nicht auf die Realität der Befürchtung an, sondern auf die Angst mit all ihren Folgen. Auf die Beunruhigung, die Einschränkungen im Leben, die der Zwang verursacht. Ob Stecknadel, Stein auf dem Wanderweg, Staub, Dreck, Sorge um Schuld, Verdammung, Seelenverlust, schlechte Gedanken oder Aids – es kommt auf innere Qual an, so beschreibt sehr treffend Hansruedi Ambühl diese Gefühle in dem Buch: »Zwang verstehen und behandeln« (Ambühl u. Meier 2003). Nun kurz und bündig zur realen Ansteckungsgefahr bei Aids, wie ich sie meinen »Schützlingen« erkläre: Handelt es sich bei dieser Befürchtung um einen Fall von »eins, zwei, drei?«. Was bedeutet »eins, zwei, drei«? Das bedeutet, wer sicher sein will, nicht mit HIV infiziert zu werden, – der darf im Park beim Fixen nicht die Nadel verwenden, die im Kreis reihum geht (Sie fixen ja ohnedies nicht, nicht wahr?!); – der sollte keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit HIV-positiven Menschen haben (eine Betreuerin der Aidsberatungsstelle hat mir erst kürzlich mit Bedauern von der »Kondommüdigkeit« der jungen Leute ganz allgemein berichtet); – der sollte keine Bluttransfusionen in Ländern bekommen, deren Hygienebedingungen, vor allem im medizinischen Bereich, zweifelhaft sind (lieber Versicherung für Reiserücktransport abschließen; Einmalspritzen mitnehmen). Alles andere ist Diskussion mit dem Zwang, der dann immer noch »Ja, aber …« sagt. Darauf lassen wir uns gar nicht ein. Dieses »eins, zwei, drei« gilt auch für die unbestimmte Zukunft, für die Zeit in vielen Jahren. Außenstehende, die nichts vom Zwang verstehen, die 14
mögen Sie verwundert fragen: »Wie stellst du dir denn überhaupt vor, auf solch unsinnige Weise angesteckt zu werden? Wie soll denn das funktionieren? Viren in HIVpositivem Blut, in Sperma – wohl möglich –, aber was hat das mit Schuhbändern zu tun und mit der Zigarette, die du nur steril zwischen den Lippen halten darfst? Was hat Aidsinfektion mit dem Fleck auf der Straße, mit dem rosa Schein im Wasser, mit dem Pflaster auf der Straße zu tun? Oder gar, dass nichts mehr rot sein darf?« Sie kennen das verständnislose Kopfschütteln, wohl gar das Tippen mit dem Zeigefinger an den Kopf, das besagen soll: »Der oder die tickt nicht mehr ganz richtig.« Was tun? – Ich habe mir vorgenommen (nach Gesprächen der Patientin mit dem Therapeuten), eine vorsichtige Schritt-für-Schritt-Kotherapie mit der Betroffenen zu beginnen. Sie erschrickt vor Rot in jeder Form, ob als Nagellack, Lippenstift (den sie so gerne tragen würde!), dem weiß-roten Plastikabsperrband an Baustellen oder einer in Rot gehaltenen Schrift auf einem Informationsblatt. Wir werden uns auch an den Hilfssatz halten: Über Dinge geht nichts! Eine Betroffene fürchtete sich vor dem Buch, das ein Aidskranker in der Hand hatte. Dieser kleine Satz ist uns auch behilflich, wenn wir Geländer anfassen und auch Türklinken, wenn wir uns in der Ambulanz schon recht müde auf einen Stuhl setzen und gedankliche Bearbeitung der zwanghaften Sorgen abhalten. Wie viele Stunden habe ich früher selbst in Arztwartezimmern stehend verbracht, weil mich mein zwanghafter Ekel vor »Schmutz« nicht auf einem Stuhl sitzen ließ. Einem weißen Arztkittel brauchen wir nicht in großem Bogen auszuweichen, und vom Ständer auf dem Gang nehmen wir uns ein Informationsblatt mit für daheim. Auch ich nehme solch ein Blatt zu mir mit nach Hause, denn es gilt auch für mich: immer am Ball bleiben! Immer wieder einmal ein wenig Herausforderung suchen. »Und was ist mit der Spritze, die ich im Park im Gras fin15
den könnte?«, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Ich konnte bei der Aidsberatungsstelle anrufen und mich informieren. Ich bin dann sogar selbst hingegangen, dort konnte ich feststellen, dass Leute, die in der Beratungsstelle arbeiten, keineswegs lebensmüde sind. Sie wissen einfach um »eins, zwei, drei« Bescheid, das genügt. »Also mit der Spritze ist es so«, sagte man mir, »dort, wo sie noch feucht sein könnte, also drinnen in der Nadel, da könnte ein mögliches Virus noch leben. Einem Kind, das solch eine Spritze im Gras entdeckt, werden Sie diese natürlich wegnehmen. Vorn an der Spitze der Nadel hat das Virus innerhalb kürzester Zeit keine Chance mehr, weil es im eingetrockneten Blut nicht überleben kann. Dieses Virus ist halt äußerst sensibel und hält nicht annähernd so viel aus, wie Aidszwangskranke (und auch Nichtinformierte) ihm zutrauen.« In meiner Zwangszeit habe ich allzu sehr das Ausgespuckte auf der Straße registriert, so wie der Aidsängstliche jede Spritze sieht, jeden roten Fleck. Er bemerkt jeden Kratzer am eigenen Finger und jedes Tüpfelchen an der Hand des anderen. Spritzen mit Nadeln habe ich nie gesehen, darauf war ich eben nicht »spezialisiert«. Ich blieb in meiner kranken Zeit sowieso möglichst zu Hause, um keine mich ängstigenden Kontakte aufzunehmen. An dieses »eingesperrt sein« möchte ich nicht mehr zurückdenken müssen. Das mache ich nur, weil ich Ihnen erzählen möchte, wie herrlich es ist, wieder hinausgehen zu dürfen. Das »Risiko« ist es wert! Nun zu Herrn Felix. Er gehört zu den Dreien, die ich zurzeit betreue. Mit »kontaminierten« Fingern nach einer Übung auf der Straße Schokolade essen, das schmeckt ihm nicht besonders. Schokolade ist bei den Aidszwängen ohnedies nicht sehr beliebt. Die Farbe? Ist das das Braun, das sich mit der Zeit aus Rot gebildet hat? Die Finger werden klebrig, darf man sie ablecken? Herr Felix ist mutig, er braucht nicht allzu viel Zeit, bis die Schokolade im Mund landet. Obwohl er doch nie so genau weiß, ob er sich nicht 16
an der Wange aufgebissen hat. Die mögliche Wunde? (»Für eine Infektion viel zu klein«, sagte mir ein Fachmann.) Schnell antworten, der Zwang lebt von der Bedeutung, die man ihm beimisst. Zu langes Überlegen heißt, da ist etwas bedeutend. Also: Über Dinge geht es nicht! Die Schokolade ist ein Ding! Und: Mit dem Zwang diskutiert man nicht! Hier herrscht kein Fall von »eins, zwei, drei«! Oder auch: »Eins, zwei, drei ist nicht dabei!« (das hat Herr Felix kreiert). Bedenken Sie, als »Nochpatient«: Sie können es sich gar nicht erlauben, Sie können sich’s gar nicht leisten, ohne dieses Sicherheit vermittelnde »eins, zwei, drei« erfolgreich Therapie zu machen. Zu schnell verwickelt Sie sonst der Zwang in endlose Diskussionen. Trotzdem hat solch eine erste Schokoladenmahlzeit dem Herrn Felix gar nicht so recht geschmeckt. Er hat sie hinuntergewürgt, als ob er Stacheldraht essen müsste. Das hat sich inzwischen enorm gebessert. Er befriedigt mittlerweile seine Lust auf Süßes und Schokolade auf jedem Therapiegang. »Ihr Vergleich mit den Schlangen bewährt sich«, sagte ich zum Therapeuten. Mit der Farbe Rot geht es manchen Aidszwängen so wie mit der Schlange auf dem Weg beim Ausflug. »Hilfe, eine Schlange!«, schreien wir erst einmal. Und was ist es wirklich? Eine harmlose Blindschleiche! Also heißt es bei den Flecken auf der Straße, bei den Flecken auf der Polsterung im Zug, beim kleinen Flecken auf der Jacke, bei den Wasserpfützen, bei den braunen Bröselchen auf dem Kaffeehaustisch, bei der rot umrandeten Fahrverbotstafel: Lauter Blindschleichen! Das ist kurz und resolut entgegnet, und das missfällt dem Zwang! Schauen Sie doch den anderen, den nicht am Zwang Erkrankten zu, das können Sie jetzt, innerhalb der Therapie, schon wagen. Nehmen Sie sie doch zum Modelllernen. Sind diese etwa verantwortungslos oder nicht informiert oder sind sie denn gleichgültig oder gar lebensmüde? Nein, 17
sind sie nicht. Sie leiden nicht an einer Zwangserkrankung. Diese glücklichen anderen fühlen sich nicht gezwungen, eine Jacke mit einem rötlichen Fleck wegzuwerfen, und sie verspüren durch diese Aktion auch nicht die Erleichterung, »das Richtige« getan zu haben. Die anderen wissen um »eins, zwei, drei« und sie vertrauen, dass dieses Wissen genügt. Die Gedanken eines Zwangserkrankten haben bei diesen keinen Zugang. Weshalb sollte dieses Denken mit Hilfe einer Verhaltenstherapie nicht auch bei Ihnen wieder ganz selbstverständlich werden? »Aids hat in Ihrem Leben keinen Platz«, so der Therapeut zu den Patienten. Eine an Aidszwang Erkrankte hatte in irgendeinem Winkel ihres zwanghaften Denkens den Partner in Verdacht, infiziert zu sein. Nachdem der unbegründete Verdacht sie schon seit Jahren so gequält hatte und die Frau mit dem Partner keinen körperlichen Kontakt mehr ertragen konnte, ging das Paar per Therapieempfehlung zum Aidstest. Nach dem Test, der natürlich negativ war, sollte der »vielleicht doch infizierte« Freund selbstverständlich kein Thema mehr sein, so lautete die dezidierte Empfehlung des Therapeuten. Schon bei der Blutabnahme saß der Zwang mit auf dem Sessel: »Ist die Nadel wohl steril?« Bei uns in Mitteleuropa darf man diesbezüglich ganz besonders Vertrauen haben und Verantwortung abgeben. »Kann wohl nichts verwechselt werden? Ist der Test verlässlich?« Später dann sogar, beim Testergebnis: »Kann ich meinen Augen trauen – steht da wirklich: Testergebnis negativ?« Der Nimmersatt Zwang möchte nie Ruhe geben. Doch ohne Vertrauen geht es nicht: Vertrauen zum Freund, Vertrauen zu den Kompetenten in Fragen von Gesundheit und medizinischem Wissen, Vertrauen zum Therapeuten und ein klein wenig auch die Bereitschaft zum Risiko. Sonst kann der Zwang von einem verlangen, den Rest des Lebens unter der Glasglocke zu verbringen, wo er wohl auch noch keine Ruhe geben wird! 18
Man diskutiert nicht mit dem Zwang. Tote Materie nannte der Therapeut all die Viren und Keime, die der Zwangsängstliche auf Dingen fürchtet. Das Virus taugt nichts mehr, sage ich, das ist futsch. Was bleibt, das ist vielleicht ein wenig eklig (zum Beispiel ein weggeworfenes Wundpflaster auf der Straße), aber »aus dem Reich der harmlosen Blindschleichen«. Ein schönes Wort, dieses harmlos, da kann man wieder erleichtert durchatmen. Da lernt man zu erkennen, dass man durch alte Vorstellungen irregeleitet wurde; dass man auf Zwangslügen hereingefallen ist; dass eigentlich so sehr Gefürchtetes nicht passieren wird. Professor Hans Reinecker von der Universität Bamberg hat dafür ein schönes Bild, wie man hilfreiche Gedanken und neues Handeln miteinander verbinden kann: Das müsse passieren wie bei einem Reißverschluss. Vom Üben mit Herrn Felix werde ich Ihnen zum Ausklang noch erzählen. Ich möchte also auf der Aidsstation der Hautklinik ein paar Prospekte aus dem Vorraum holen, zum Anfassengetrauen für meine »Schützlinge«. Der Herr Felix ist heute gut aufgelegt und sagt: »Ich möchte mit.« Wir gehen hinein und nun begegnen wir einem womöglich tatsächlich Erkrankten; er sieht schlecht aus und sorgenvoll. Nun ist bei all dem Leid, das meinem Schützling da begegnet war, eines bemerkenswert: Der Schreck des Herrn Felix war gar nicht so groß, er hätte sich solch eine bewusste Begegnung mit einem – mit ziemlicher Sicherheit – an Aids Erkrankten viel angstbesetzter vorgestellt. Das Mitleid mit dem anderen, die eigentlich immer nur in der Vorstellung größere Angst, der gesunde Menschenverstand, der im Begriff war, wieder mittun zu können, die Freude und der Stolz, neue Kräfte in sich entdecken zu können, das alles dürfte eine große Rolle gespielt haben. Verhaltenstherapie ist Erlebenstherapie. Herr Felix hat an diesem Tag etwas sehr Schönes für sich erlebt. Wobei wir uns im Nach19
gespräch voll Respekt vor dem Leid des Erkrankten verhalten haben. »Ich habe Angst, ich könnte zu unbesorgt werden!«, war die Sorge einer noch Erkrankten. Haben Sie diese Befürchtung auch schon einmal gehabt? Sie, die Aidsängstlichen? Denken Sie einfach an »eins, zwei, drei«, dann brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Zu übermütig gegenüber früher so Gefürchtetem zu werden, diese Sorge braucht wohl keiner »von uns« zu haben. Das liegt uns einfach nicht!
Alkohol Als mir dieses Stichwort eingefallen ist, habe ich gedacht, ich werde nicht viel darüber schreiben können, denn bezüglich Alkohol fehlt mir die eigene Erfahrung. Ich habe, um vor der Therapie über die Runden zu kommen – von Jahr zu Jahr höher dosiert –, Tranquilizer gebraucht. In der Therapie musste ich sie mir dann wieder mühsam abgewöhnen, um bewusster erleben und lernen zu können. Alkohol als »Beruhigungsmittel« spielt vor allem bei Angststörungen eine verhängnisvolle Rolle. Dort wird Alkohol eingesetzt, um die Angst in verschiedenen Situationen durchstehen zu können. Personen, die an Zwängen leiden, greifen eher selten zum Alkohol; zu groß ist das Bedürfnis nach Kontrolle, die Angst, nicht mehr alles (vor allem sich selbst) im Griff zu haben. In der Kotherapie ist mir allerdings Alkohol als Alleszerstörer immer wieder begegnet. Ich habe noch regelmäßig Kontakt zu einem jungen Mann, der nach langen Therapiejahren wegen seiner Zwänge und sonstigen Lebensprobleme sein ausgeprägtes Alkoholproblem einfach nicht in den Griff bekommen konnte. Geschafft hatte er das dann mit 20
Hilfe der »Anonymen Alkoholiker«. Dort geht er nun regelmäßig zu den Treffen, obwohl er schon erfreulich lange trocken ist. Er fühlt sich in diesem Kreis Gleichbetroffener wohl, unterstützt und verstanden und hat zudem nette Bekanntschaften geschlossen. Für ihn sei das der wichtigste Schritt für sein neues Leben gewesen, sagt er heute. Sonst wäre »alles den Bach hinuntergeronnen«. Auch von anderen »zusätzlich Betroffenen« habe ich Gutes von dieser Einrichtung der Anonymen Alkoholiker gehört.
Alternativen Wenn Sie Ihren Zwang dauerhaft bewältigen wollen, müssen Sie für die Zeit, die die Rituale in Ihrem Leben eingenommen haben, Alternativen entwickeln. Suchen Sie nach Dingen und Tätigkeiten, die Sie früher gern getan haben, und trauen Sie sich zu, diese wieder tun zu können. Ein junger Mann mit Berührungsängsten hat langsam wiederentdeckt, wie große Freude ihm das Tanzen und auch Gymnastik in einer Gruppe macht. Seine Berührungsängste hatten alle Kontakte verhindert. Er lernt mittlerweile, sich auf eine Matte im Turnsaal zu legen, seine Haare werden »schmutzig«, er lernt, das auszuhalten, sogar zu genießen – und er gibt dem Zwang so immer weniger Raum. Bezweifeln Sie, weil Sie im Umgang mit dem Zwang noch nicht so weit sind, dass es auch genussvoll sein kann, nicht mehr so sauber, so perfekt, so kontrolliert, so den Erfordernissen Ihres Zwangs angepasst sein zu müssen? Nachgeben zu können, sich dreinfinden zu können in neue Erkenntnisse und es wieder zu schaffen, auf einer nicht ganz sauberen Turnmatte zu liegen? Probieren Sie’s doch! Da können sich nach den ersten »Verwirrungsmomenten« auch ganz tolle Gefühle breit machen. Der Zwang? Der 21
fühlt sich aufs Nebengleis verdrängt – und das ist gut so. (Nachzulesen in: »Ich bezwinge meinen Zwang« von G. Gielen, S. Bracht, H. Reinecker, 2005).
Angehörige Beim Stichwort »Angehörige« bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen. Die »Angehörigen« wollten mich schon dazu veranlassen, in Fachbüchern über das Thema der mitbetroffenen Angehörigen nachzublättern. Aber das wollte ich nun auch wieder nicht. In Fachbüchern Hilfe holen, das könnten Sie ja selbst. Das hat nichts mit den Erfahrungen einer ehemals Betroffenen und mit dem Selbsterlebten in der Kotherapie zu tun. Angehörige, Familienmitglieder sind in der Regel an der Entstehung von Zwangsstörungen beteiligt: Eine Mutter stellt einen Teller so hin, wie der Sohn es wünscht, ein Vater kontrolliert für die Tochter noch einmal, ob die Tür geschlossen und das Autoradio ausgeschaltet ist. Aus der gut gemeinten Hilfe und Unterstützung wird letztlich eine gegenseitige Abhängigkeit. Der Zwang kann sich unter anderem auch deshalb aufrechterhalten, weil die Angehörigen eine entsprechende Unterstützung leisten. Sie bieten dem Zwang gewissermaßen Nahrung, weil sie die Rituale für den Betroffenen durchführen. In einem späteren Stadium der Erkrankung wird das für Angehörige oft zu einer massiven Belastung. Nicht wenige wenden sich an Fachleute, weil sie die Situation nicht mehr aushalten. Der Zwang verlangt von den Angehörigen so viel an Zeit und Aufwand, dass damit das eigene Leben massiv beeinträchtigt wird. Angehörige, so habe ich gelernt, werden angeleitet, mit ihren Zwangserkrankten in dieser Weise zu reden: »Ich lie22
be dich, aber nicht deinen Zwang.« Das klingt klar und einfach – wenn es in der Realität nur so einfach wäre. Denn die Liebe zum Erkrankten, diese Liebe ist argen Geduldsproben ausgesetzt. Manchmal hängt sich der Zwang auch mit derartiger Penetranz und Wucht an den Erkrankten, dass die beiden schwer voneinander zu trennen sind. Da hat man den Eindruck, als ob der Hilfsgedanke »Ich bin nicht mein Zwang /Ich bin nicht mein Zwangsgedanke« schier nicht mehr zutreffen möchte. Diesen Zustand kennen und benennen Betroffene als »Zwangsrausch«. Es ist ein Zustand, der mit größter Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein an das Zwangssymptom einhergeht. Wenn Zwangskranke sich im Zwangsrausch befinden, dann können Sie als Angehöriger diese nur noch in den Arm nehmen (wenn Erkrankte das vom Zwang her zulassen dürfen!). Reden hilft in dieser Situation wenig. Sachliche Argumente sind fehl am Platz. Da hilft oft nur abwarten, bis das Ärgste vorbei ist. Es gibt von Seiten der Angehörigen Wutausbrüche, Widerstand, Unverständnis und Resignation. Dann wiederum löst der Erkrankte beim Angehörigen viel Mitleid aus und das große Bedürfnis, ihm irgendwie zu helfen. »Stell dich nicht so an, mach es einfach wie ich«, solch eine unrealistische und kränkende »Hilfestellung« darf ein Angehöriger nicht geben. Der Erkrankte fühlt sich dabei nur noch mehr unverstanden und trostlos. So handeln und denken wie Gesunde, das würde er ja selbst so gern! »Du solltest eine Therapie aufsuchen!«, dieser Rat ist schon besser, aber mit viel »wenn und aber« verbunden. Der ganz und gar nicht risikofreudige Zwangspatient möchte vieles bedenken, bevor er sich zu einer Therapie entschließt. Seit Theresas Zwänge-Seite im Internet (www.zwaenge.at) steht, ist die Suche auch in Österreich zum Glück leichter geworden. In der Schweiz und in Deutschland gibt es diese segensreiche Einrichtung schon seit längerer Zeit (www.zwaenge.de bzw. www.zwang.ch). Angehörige mögen wohl so manches Ungewöhnliche 23
am Erkrankten beobachten. Dieses Rütteln an der Tür und dieser »Reinlichkeitsfimmel«, diese merkwürdige Nachfragerei, dieses ständige sich Absichern, das mag Angehörigen schon zu denken geben. Aber sie können sich keinen Reim daraus machen. Dass sich da eine womöglich schwere seelische Erkrankung entwickelt, das erfahren sie oft sehr lange nicht. Der einzige Mitwisser in meiner Krankheit war mein Mann. Natürlich hat auch er unter meinen Ansprüchen als Zwangskranke gelitten. Den Kindern meine Nöte einzugestehen habe ich einfach nicht geschafft. Ob das richtig war oder falsch, das weiß ich heute noch nicht. Aber natürlich habe ich auch die Kinder durch meine Zwanghaftigkeit eingeschränkt. Eine Folge des ständigen Drucks auf mich durch das zwanghafte Verhalten war die Veränderung meines Wesens, und darunter hat die Familie natürlich auch zu leiden gehabt. Das zu erwähnen tut mir jetzt noch weh. Meine Kinder reagieren heute sehr unterschiedlich in ihrem Wissen um die einst zwangskranke Mutter. Für zwei von ihnen ist meine Erkrankung immer noch ein Tabuthema, sie haben genug unter den Ansprüchen der Zwangsmutter gelitten. Das dritte Kind reagiert ähnlich, aber es ist stolz auf die »schreibende Mutter«. Ich wollte lieber, es hätte nie Anlass haben müssen, auf so etwas stolz zu sein. Ich wünschte, meine Kinder hätten immer eine gesunde Mutter gehabt. Ich kann nichts für meine Erkrankung, das habe ich schon so oft gehört. Ich sage das auch immer wieder zu den von mir Betreuten. Das große Bedauern kann mir jedoch niemand abnehmen.
24
Angst Lassen Sie sich Ihrer Ängste wegen nicht belächeln und demütigen. Nehmen Sie Ihr Leiden nicht schicksalsergeben in Kauf. Tief Luft holen und sich zu einer Therapie aufraffen, das ist jetzt gefragt. Kognitive Verhaltenstherapie ist das, was Sie brauchen, wenn sie unter Zwangsängsten leiden. Verhaltenstherapeuten helfen Ihnen in Gesprächen und ganz praktisch im Tun beim Verändern Ihrer krankhaften Verhaltensweisen. Sie werden mit Ihnen die möglichen Ursachen der Erkrankung erforschen und Ihnen bei der Bewältigung von Lebensproblemen überhaupt eine Unterstützung sein. »Ohne herauszufinden, woher die Zwanghaftigkeit rührt, ist ein Gesundwerden für Zwangskranke gar nicht möglich.« So hörte ich die etwas trotzigen Worte einer »Psychoanalyse-Anhängerin«. Ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Vielen Betroffenen hilft es, wenn sie nach Erklärungen suchen und meinen, diese in ihrer Biographie oder in speziellen Verletzungen gefunden zu haben. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, die Angst aber kann nur durch konkretes Tun und Handeln bewältigt werden. Sie sollten auch wissen, dass Angst ein wichtiges menschliches Gefühl darstellt, das für das Leben und Überleben unverzichtbar ist. Wenn die Angst, die Unruhe, der Ekel (und wie all die Gefühle bei Zwangserkrankten heißen mögen) Sie aber am Leben hindern, dann sollte die Angst für Sie ein Signal sein, sich therapeutische Hilfe zu holen.
25
Aushalten Das ist ein Zauberwort, ein ganz wichtiger Begriff in der Therapie. Aushalten, auch wenn der Zwang sagt: »Schau doch lieber noch einmal nach! Frag doch lieber noch einmal nach! Noch eine Wiederholung, dann fühlst du dich gut, dann bist du verantwortungsvoll!« Der Zwang ist ein ganz mieser Verführer. Der Zwang bekommt nie genug! Nicht nachgeben, der Zwang ist ein schlechter Berater. Aushalten, auch wenn das Gefühl noch so zum Befriedigen des Zwangs drängt. Erkennen, dass das schlechte Gefühl von der Erkrankung kommt, nicht von einer Wirklichkeit. Fragen Sie sich: »Wer will, dass ich reinigen oder wegwerfen oder mich entschuldigen oder wiederholen oder mich vergewissern und all das tun soll, das mir so viel Leid beschert? Wer will, dass ich mich schon wieder demütige und nachgeben muss? Bin das ich oder ist es der Zwang?« Seien wir ehrlich, das weiß ich noch aus meinen eigenen Zwangsjahren und dann auch aus der Zeit meiner Therapie: Man spürt schon deutlich, ob der Zwang unterwegs ist oder nicht. Das ist doch so ein unangenehmes Ziehen in der Brust, so ein Gefühl von Ängstlichkeit und Bedrängnis, das sich in zwanghaften Situationen unverkennbar einstellt. Wenn Sie ehrlich gegenüber sich selbst sind, dann werden Sie leicht erkennen, woher der Wind weht. Ob Sie das Vernünftige tun dürfen oder das vom Zwang Aufgedrängte tun müssen. Seien Sie mutig und erkennen Sie: Das ist eine Zwangsangelegenheit, jetzt bin ich gefordert. Jetzt will ich an das Gelernte in der Therapie denken. Die Stimme des Zwangs, die höre ich wohl, das darf sein. Diese Stimme wird schon leiser werden, wenn ich jetzt aushalte. Sagen Sie nicht: Wie dumm habe ich mich angestellt, dass mich der Zwang schon wieder erwischt hat! Nehmen Sie das »Pech«, in eine zwanghafte Situation geraten zu sein, als Chance. Bedenken Sie bitte: Wer ständig vermei26
det, hat keine Gelegenheit, sich im Aushalten zu üben. Sie wollen sich doch wieder des Lebens erfreuen können! Wenn Ihnen wieder »etwas passiert ist« (so habe ich das immer genannt, wenn ich zwanghaft geworden war), dann könnten Sie auch so denken: »Verflixt, jetzt hab ich schon wieder den Zwang am Hals. Aber diesmal hat der sich getäuscht. Ich akzeptiere das ›Missgeschick‹ und mache eine Übung draus.« Sie könnten sich sagen: »Es ist sehr schwer für mich zum Aushalten. Aber ich möchte trotzdem nicht nachgeben.« Dieses trotzdem ist ein wichtiges Wörtchen. Trotz schlechten Gefühls nicht nachgeben. Dem Zwang trotzen. Nehmen Sie das kleine gewichtige Wort in Ihren Therapiewortschatz auf! Mag sein, dass Sie sich sagen: »Ich kann das nicht, das kommt gar nicht in Frage. Das ist zu schwer für mich.« Ist es nicht. Das glauben Sie vielleicht zunächst. Probieren Sie, was in Ihnen steckt. Sie werden es nicht bereuen. Sie können aushalten in vollem Bewusstsein, was Sie da nun aushalten müssen; Sie können auch aushalten, indem Sie sich gedanklich ablenken, indem Sie irgendetwas tun, das Ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkt. Immer wieder anders, immer wieder in anderen Variationen üben! Sie können das Aushalten auch so lernen, wie ich es neulich mit jemandem besprochen habe. Der junge Mann leidet an Kontrollzwängen – das Licht, der Herd, das Auto, Sie wissen ja. »Ein wenig plagt mich ja auch der Waschzwang«, sagt er. Da gibt es zum Beispiel den Kollegen im Betrieb, der seinen Kugelschreiber ausborgen möchte. Gern leiht ihn der junge Mann nicht her; der Kollege wird den Kugelschreiber »beschmutzen«. Auf jeden Fall muss ihn der junge Mann nachher säubern. Lernen Sie das Aushalten von unangenehmen Gefühlen und das Verzichten auf Rituale auch auf dieser Ebene, beim für Sie sozusagen leichteren Zwang. Verkneifen Sie sich das Abwischen des Schreibzeugs. Wenn Sie hier Erfolg haben, werden Sie 27
auch für Ihre schwieriger zu bewältigenden Kontrollzwänge profitieren. Erfolg bringt Erfolg! Wenn Sie sich üben im Aushalten von unangenehmen Gefühlen (auch von Anspannung, sogar von Angst), dann werden die Zwänge an Bedeutung verlieren. Was hält Sie davon ab, den Widerstand zu wagen? Was fürchten Sie? Ich habe in meiner Therapie nie bereut, etwas gewagt zu haben. Doch einmal, da muss ich ehrlich sein, war ich zu schnell. Ich wollte zu viele Zwischenschritte auslassen und Neues im Alleingang angehen. Ich habe mich sozusagen übernommen. In Wirklichkeit ist natürlich auch nichts passiert; es kann nichts passieren, wenn man gegen den Zwang arbeitet. Aber ich hatte mich zu sehr angestrengt. Ehrgeiz ist gut in der Therapie, aber übertreiben soll man auch hier nicht. Ich habe dann schon gelernt mit meinen Kräften hauszuhalten, damit mir nicht vorzeitig »die Luft ausgeht«.
Bereitschaft Es geht hier um die Bereitschaft, von alten Vorstellungen zu lassen, zum Beispiel: »Ich darf nie krank werden, das will ich mir gar nicht vorstellen!« »Ich muss immer ganz sauber sein, das gibt mir Sicherheit!« »Ich darf mir nie etwas zu Schulden kommen lassen, ich halte Kritik nicht aus.« »Nur ich trage die alleinige Verantwortung. Die anderen sind nachlässig.« »Ich darf keine Fehler machen, sonst mag man mich nicht mehr.« »Ich muss perfekt sein, sonst fühle ich mich als Versager.« »Ich muss immer richtig beten, sonst straft mich Gott!« »Ich muss mich absolut verständlich ausdrücken. Ich muss andererseits ganz exakt verstehen, was andere sagen. Sonst gibt es nicht wieder gutzumachende Missverständnisse mit argen Konsequenzen.« »Ich zieh 28
mich in mein Schneckenhaus zurück, dann kann mich niemand verletzen!«. Die Bereitschaft, solche Ansprüche aufzugeben, kann außerordentlich angenehme Gefühle auslösen. Es ist, als ob man sich endlich einmal etwas ganz Besonderes gönnen würde! Auf einem Kalenderblatt, das ich gerade abreiße, steht geschrieben: »Führe jede Tat deines Lebens so aus, als ob es deine letzte sei.« Das finde ich nun für »unsereins« keinen guten Rat. Das zielt hin auf möglichst Fehlerfreies und Hundertprozentiges. So ein Ratschlag könnte einen neurotisch machen. Würde ich mir für dieses Buch solch eine Anleitung allzu sehr zu Herzen nehmen, dann könnte ich meine Gedanken und Tipps von A–Z für Sie niemals aus der Hand geben. Dann müsste ich mir endlos überlegen, ob all das Gesagte fehlerfrei und lückenlos sei. Dass dies nicht möglich ist, das muss ich und das müssen Sie hinnehmen. Recht brauchbar und ziemlich hilfreich für Sie, das soll das Büchlein sein – dann wäre ich schon sehr zufrieden!
Brainy »Brainy« ist ein Computerprogramm, entwickelt von Christoph Wölk und Andreas Seebeck, in welchem der virtuelle Kotherapeut »Brainy« Sie auf dem Bildschirm bei der Unterlassung der Zwangsrituale unterstützen kann. Das ist sicher keine gleichwertige Alternative zum Kontakt mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin; im Alltag, zu Hause kann das Programm Sie dabei aber unterstützen, Ihre Übungen auch ganz konsequent durchzuführen. Auf der Internetseite www.zwaenge.de habe ich einen bemerkenswerten Bericht von einer Betroffenen gelesen. Die Patientin hatte unter massivem Zwangsgrübeln gelit29
ten. Sie hatte, ausgehend von »Brainy«, zusätzlich sehr engagiert und phantasievoll neue Ideen zur Bewältigung ihres Leidens entwickelt.2
Demut Demut in der Therapie heißt: Es gibt einen Bereich in meinem Leben, in dem ich mir eingestehen muss, dass ich krankheitshalber einen falschen Weg eingeschlagen habe. Ich lerne einzusehen, dass ich mich deshalb den Erfahrungen und den Erkenntnissen des Therapeuten anvertrauen soll. In der Therapie heißt es: »Einmal Händewaschen sollte genügen.« »Ein aufmerksamer Blick für die Herdknöpfe ist der Weg zum Erfolg.« »Nicht nachfragen, das ist Ihr sicheres Rezept.« »Ungefähre Ordnung im Schrank, das wird Sie gesund machen.« »Ein Fleck auf der Weste hat mit Gefahr, an Aids zu erkranken, nichts zu tun.« Wenn Sie also solche Sätze hören, dann dürfen Sie wohl darüber diskutieren. Aber auch wenn Sie nicht gleich von Anfang an einsehen können, dass all das hilfreich und richtig ist, dann rate ich Ihnen: Tun Sie’s einfach doch! Vertrauen Sie dem Therapeuten. Die eigene Einsicht hinkt manchmal nach, sie stellt sich oft erst mit dem Abbau von Angst ein – dann darf der gesunde Menschenverstand wieder zu Wort kommen. Der Abbau von Angst braucht auch das Tun und die vielen Wiederholungen. Veränderung braucht Zeit. Seien Sie nicht ungeduldig mit sich selbst, wenn Sie einen Zwang, unter dem Sie zwanzig Jahre lang gelitten haben, nicht in zwei Wochen oder in zwei Monaten in den Griff bekommen.
2 Auch in »Z-Aktuell« Nr. 106 (März 2006) erschienen.
30
Lassen Sie sich führen. Das nenne ich die Demut in der Therapie.
Dinge Mit Dingen, Zuständen, Situationen kann man reden; so tun, als ob sie Personen wären. Das kann helfen, damit leichter fertig zu werden, falls sich der Zwang drauf gesetzt hat. Ich konnte zum Beispiel mit einer Türklinke vor einem Geschäft reden, die von sich behauptete, unberührbar zu sein. »Wozu bist du denn eigentlich da? Soll ich vielleicht durchs Schlüsselloch hinein!« Meine Freundin kann auch gut mit Dingen reden. Zum Blumentopf, der seit einem Jahr keine Blüten mehr zeigt, sagt sie: »Wenn du nicht bald blühst, kommst du auf den Kompost!« Solches Sprechen kann sich auch bei Zwangsangelegenheiten bewähren. Nicht jedem liegt das, manche finden das kindisch. Ich sage: Jedem seinen eigenen Umgang mit dem Zwang innerhalb der Therapie. Was hilft, das gilt. »Tu nicht so giftig«, können Sie zu einem Spülmittel sagen, das von sich behauptet, »Gift« zu sein. So, als ob Sie die Absicht hätten, zu Mittag Spülmittel in die Suppe zu gießen. Sie getrauen sich nicht, Brot und Spülmittel in den gleichen Einkaufskorb zu legen? Sie müssen womöglich in getrennten Einkaufsgängen Putzmittel, Schuhcreme, Waschmittel und dann wieder Essbares kaufen? Legen Sie das Brot und das Geschirrspülmittel nebeneinander in den Einkaufskorb und sagen Sie zum Beispiel: »Ihr zwei, ihr werdet euch jetzt miteinander vertragen, das wäre doch gelacht! Schön zusammenrücken, es kommt noch Nachschub!« Als ob Sie mit unfolgsamen Kindern redeten. Und dann kein Zurechtrücken und leicht Auseinanderschieben mehr von Brot und Spülmittel, das wäre gemogelt. 31
»Danke schön, so etwas liebe ich!«, denke ich heute, wenn dicht hinter mir jemand niest. Mittlerweile komme ich mit ein, zwei eventuellen Tröpfchen davon zurecht – denn: »Ein bissel darf sein!« – und kann das bald vergessen. Die »Beschmutzung« wird für Erkrankte viel öfter vermutet, als dass sie wirklich passiert. Wenn in der Zeit der Krankheit jemand in meiner Nähe gehustet oder geniest hat, wenn irgendwo Unangenehmes verspritzt wurde oder verbreitet wurde, da habe ich fast immer das Gefühl gehabt: Jetzt hat es mich erwischt! In der Justiz gilt der Grundsatz: »Im Zweifelsfall für den Angeklagten.« Im Zwang, in der Zweifelkrankeit bezichtigt uns der Zwang eher, beschmutzt worden oder in eine vom Zwang besetzte Situation geraten zu sein, als dass er uns davon freispricht. Also mahnt der Zwang: »Sicher ist sicher! Übe dein Ritual aus!« Der Patient überschätzt gerade bei unangenehmen Dingen und Ereignissen die Gefahr, deshalb ist er auf der Suche nach totaler Sicherheit. Diese vermeintliche Sicherheit bietet ihm scheinbar der Zwang – mit all den bekannten Begleiterscheinungen. Früher, vor der Therapie, verspürte ich in solchen Situationen Ärger, auch ohnmächtigen Zorn, Verzweiflung. Der Stadtbesuch musste abgebrochen werden, denn so »verdreckt« war ich nicht mehr in der Stimmung, etwas zu erledigen. Da waren doch alle folgenden Handlungen negativ besetzt! Also gleich nach Hause, Kleider in die Wäsche, duschen, Frust, schlechte Laune, Ratlosigkeit. Und wieder ein Schritt zurück. So war das bei mir vor der Therapie. »Bravo, geschafft!«, sage ich heute ärgerlich zum Schlüsselbund, der auf die Straße fällt. Ich erhebe den Schlüsselbund also zur Person, die Schelte bekommt. Das hilft mir. Der Zwang ist ein gefräßiges Monster, das habe ich kürzlich zu einer Betroffenen gesagt. Sie hat mich groß angeschaut und regelrecht beneidet. Ihre zwanghaften Schuldgefühle lassen diese saftige Benennung ihres Peinigers noch 32
nicht zu. Sie wird (mit Hilfe der kognitiven Verhaltenstherapie) sicher noch lernen, sich gegen den Zwang zu wehren. Lieber wehrhaft als zwanghaft! Was den Schlüsselbund betrifft, der auf die Straße fällt, habe ich übrigens noch weiter gelernt. Lesen Sie, bitte: Mit der »normalen« Straße kann ich jetzt gut umgehen. Unter einer normalen Straße verstehe ich solch eine, von der ich zwar vermuten kann, dass all das, was ich eklig finde, drauf vorhanden ist. Aber ich sehe nichts Konkretes. Diese »Verdünnung« zu ertragen, das habe ich gelernt. Ich weiß von der Straße zwar mehr als andere »Normale«, aber ich habe mich mit diesem erweiterten Bewusstsein versöhnt. Ich kann damit umgehen. Entweder helfe ich mir mit meinem Sprüchlein »Ein bissel darf sein«. Oder ich wende einen Trick, eine andere Taktik an: Ich tue so (im Denken und Handeln), als ob der Schlüsselbund gar nicht hinuntergefallen wäre. Als hätte das gar nicht stattgefunden. Das ist nicht Vermeidung (ich höre da schon Stimmen von Fachleuten), sondern das ist eine Variation im Umgang mit einem lästigen Schlüsselbund. Ich habe diesen Trick aus meiner Therapie übernommen. Ein Besucher hatte unsere Toilette benutzt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. »Tun Sie, als ob er sie gar nicht benutzt hätte!«, so war diesmal der Ratschlag des Therapeuten. Immer darf man so allerdings nicht verfahren. Wir sollen ja auch lernen, mit Herausforderungen bewusst umzugehen. Es sind diese zwei Hilfsmittel, die ich heute, als Gesunde, in speziellen Situationen, die früher zwangsbesetzt waren, sehr schnell als Problemlöser zur Hand habe: »Ein bissel darf sein« und »Ich tu so, als ob gar nichts stattgefunden hätte«. Also brauche ich mir keine Gedanken zu machen und ich muss auch nichts tun. Ich denke, das funktioniert nicht nur für Waschzwänge in der Therapie. Noch nie allerdings hatte ich das Pech, dass mir der Schlüssel oder sonst ein Ding, das man schwer entbehren kann, in einen Hundekothaufen oder in kräftig Ausge33
spucktes gefallen ist. So etwas blieb mir bisher erspart. Sie entschuldigen bitte dieses grausliche Thema, aber vielleicht hilft Ihnen zu hören, wie man mit solch einer Stresssituation fertig wird. Ich habe das getan, was ich beim Schreiben öfters tue: Ich frage jemand, der dieses komische Problem besonders gut versteht, also Nochbetroffene oder ehemals Betroffene, die allerdings diesbezüglich keine Zwänge haben oder hatten (nur den ganz normalen Ekel). In diesem Fall fragte ich Theresa. Sie betreut die österreichische Zwänge-Seite im Internet. Theresa sagt: »Ich hebe den Schlüssel mit einem Papiertaschentuch auf und trage ihn nach Hause, dort wird er gewaschen.« »Und wenn du kein solches Taschentuch dabei hast?«, frage ich sie, weil ich das Pech kenne, das sich gern in Zwangssituationen hinzugesellt. Auch hier weiß Theresa einen Ausweg: »Dann hebe ich ihn mit spitzen Fingern auf, gehe ins nächste Geschäft und frage nach einer Tüte.« Bravo, gut geraten! Jetzt muss mir das nur noch passieren. Schimpfen werde ich dann mit dem Schlüsselbund sicher, und zwar recht heftig, aber ich werde dabei an Theresa denken, an ihre Munterkeit, an ihre prima Arbeit für die Zwänge-Seite. Das wird mir zusätzlich Unterstützung sein. Eine andere »Beraterin«, die gar nicht weiß, was ein Zwang ist, die aber auch mit allzu Unappetitlichem nicht gern Umgang hat, würde die Sache so angehen: »Nicht einmal mit spitzen Fingern würde ich den Schlüsselbund anfassen, wenn ich kein Taschentuch dabei hätte. Ich würde einen Passanten bitten, mir ein Papiertaschentuch zu geben. Ich würde die Schlüssel daheim in die Dusche legen (da geht das am besten) und ordentlich drüberbrausen.« Ich werde einfach kopieren, was meine beiden Ratgeber in solch einem Fall auch machen würden. In solch besonderen Situationen halte ich mich noch immer gern an mir vertrauenswürdige Vorbilder. Gestern hatte ich mich mit einem Patienten, Herrn R., 34
getroffen. Sein Problem sind zwanghafte Gedanken und Bilder aggressiven Inhalts. Nach dem Gespräch im Kaffeehaus stehen wir noch auf der Straße. »Komm, machen wir noch schnell ein Experiment«, habe ich ihn ermuntert. Ich hatte eine Packung Tomaten fürs Abendessen mit dabei. »Schau, da habe ich Cherry-Tomaten gekauft, die kennst du doch. Wie wär’s, wenn du bis zu dem Geschäft da drüben gingest, da gibt es so schöne Sportartikel in der Auslage. In zwei Minuten treffen wir uns wieder, ich warte hier auf dich. Du darfst in dieser Zeit an alles denken, nur nicht an die Cherry-Tomaten.« Er, der von sich verlangt hatte, keine Bilder aggressiven Inhalts und keine »schlechten Gedanken« haben zu dürfen, kam nach etwa zwei Minuten zu mir zurück, ein Lächeln im Gesicht: »Ich habe nur an CherryTomaten gedacht!« Geschichte am Nebengleis: Während ich auf die Rückkehr von Herrn R. wartete, ist mir die Packung mit den Tomaten auf die Straße gefallen. Das war weiter kein Problem für den Moment, denn die Tomaten waren ja verpackt. Daheim dann will ich sie in den Kühlschrank einräumen, da sagt der Verführer: »Die Straße kommt nicht in den Kühlschrank.« Ich wäre beinahe drauf hereingefallen. Und während ich mir ein paar Mal vorsage: »Die Straße kommt nicht in den Kühlschrank, die Straße kommt nicht in den Kühlschrank«, geh ich zum Kühlschrank und stelle die Packung hinein. Dazu sage ich: »Jetzt ist die Straße im Kühlschrank.« Ich habe da etwas von Trotz verspürt; weil ich mir nicht mehr gefallen lasse, dass mich jemand so dümmlich bevormundet – und schon gar nicht frühere Zwanghaftigkeit! Ich habe durch die Therapie gelernt, dem Zwang gegenüber nicht mehr sprachlos zu sein aus lauter Angst und Anspannung. Ich weiß meine Sache zu verteidigen, zumindest dem Zwang gegenüber habe ich das letzte Wort! Versuchen Sie das auch und erfahren Sie, wie wohl das tut!
35
Durchhalten Nicht auf halbem Weg eine Therapie beenden. Nicht denken: »Jetzt funktioniere ich wieder. Das reicht mir.« Es könnte sein, dass es eben doch noch nicht reicht und dass profunde Therapie das Leben noch mehr bereichert und zudem Rückfälle verhindert. Bei Problemen mit der Therapie oder mit dem Therapeuten sollte man diese lieber ausdiskutieren und mutig ansprechen, als die Therapie abbrechen. »Ich möchte diese Therapie nicht mehr fortsetzen«, erklärte eine junge Frau in der Kotherapie. »Ich fühle mich bei den Hausbesuchen nicht wohl; ich muss da Dinge tun, die ich nicht mag.« In einer anderen Therapie sucht sie nun Hilfe. Ich wünsche ihr, dass sie dort auch auf Verhaltenstherapie stößt und lernt, unangenehme Gefühle beim Konfrontieren mit dem Zwang auszuhalten. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie die Frau gesund werden sollte. Eine vorangegangene reine Gesprächstherapie hatte keine Erfolge bezüglich des Zwangsverhaltens gebracht. Es ist also Durchhalten gefragt, darin unterstützen Sie Therapeut und Kotherapeut.
Eigenverantwortung Mit fortschreitender Therapie Eigenverantwortung zu übernehmen bedeutet, dass Sie durch die Therapie lernen werden, in Bereichen noch bestehender Zwanghaftigkeit immer eigenständiger zu überlegen, zu entscheiden und zu handeln. Ich weiß nicht, wie ihre momentane Befindlichkeit ist. Sehr, sehr unterschiedlich wird sie jeweils jemand erleben, der oder die hier gerade das Buch liest. Für mich hat der Begriff »Eigenverantwortung« und die Aufforderung dazu, 36
diese zu übernehmen, heute einen anderen »Geschmack auf der Zunge« als in anfänglicher Therapiezeit. Damals war »Eigenverantwortung übernehmen« für mich verwandt mit dem mahnenden Begriff »sich Konfrontationen stellen«, und zwar insofern, als man in der Therapie ständig aufgefordert wird, etwas zu erbringen. Und weil der Zwang so mächtig sein kann, braucht es manchmal den leicht erhobenen und hilfreichen therapeutischen Zeigefinger. Die vorher besprochene Demut in der Therapie ist hier gefragt! Bei Kindern heißt es gern: »Wenn du dies, das und jenes nicht tust, gibt es heute Abend kein Sandmännchen im Fernsehen.« (Wie pädagogisch sinnvoll solche Erpressungsversuche sind, wollen wir dahingestellt lassen.) In der Therapie gibt es keinen wirklichen Erfolg, wenn wir mit der Zeit nicht die Sicherheit vermittelnde Hand loslassen und in Eigenverantwortung handeln können. Selbständigkeit und Selbstsicherheit gewinnen Sie nur, wenn Sie Dinge auch in Eigenverantwortung tun und wenn Sie nicht jedes Mal nach Rückversicherungen suchen. Patienten müssen sich viel Mühe geben, bis sie wieder die Sicherheit erleben können: Bezüglich meiner überstandenen Erkrankung kann ich jetzt praktisch ohne »Anweisungen« und Hilfestellungen leben. Jetzt spricht kein Zwang mehr, und deshalb weiß ich nun selbst, was Not tut. Es ist für Zwangspatienten nicht leicht, manchmal geradezu Kinderleichtes wieder lernen zu müssen und dieses – nur scheinbar Leichte – dann auch noch allein, also eigenverantwortlich, zu schaffen. Wenn Sie sich vorstellen können, der Therapeut sieht Ihnen zu und klopft Ihnen anerkennend auf die Schulter, dann wird Ihnen das beim Therapiemachen im Alleingang auch eine Hilfe sein. Zudem werden Sie den Stolz und die Freude über diese neue Selbständigkeit erleben!
37
Energie Energie tanken können wir, indem wir immer wieder einmal Ruhepausen einlegen. Ich sage das bewusst deshalb, weil ich das in meiner Therapie nicht besonders gut praktizieren konnte. Richtig von mir selbst (nicht vom Therapeuten) getrieben habe ich mich manchmal gefühlt. Das hatte mich in einem Abschnitt der Therapie so weit gebracht, dass ich wohl noch den unbedingten Willen zum Weitermachen hatte, aber die Kräfte (körperlich und seelisch) mir beinahe ausgegangen wären. Da ist rasten angesagt und – sehr wichtig – sich selbst belohnen. Nicht immer kommen ausreichend Lob und Anerkennung vom Partner, von der Familie. (Wenn doch, umso besser!) Die anderen können meist gar nicht wirklich erkennen, was Sie leisten. Oder erwarten Sie, dass jemand nachvollziehen kann, wie schwer es Ihnen zum Beispiel gefallen ist, nicht nachzufragen, was Sie nicht »hundertprozentig genau« verstanden haben? Oder wie schwer Ihnen der Entschluss gefallen ist, von nun an die Schuhbänder nicht mehr dreifach zu knüpfen, damit sie ja nicht Straßenkontakt bekommen? Dass Sie das den halben Tag gedanklich beschäftigt hat, bis sich endlich das Nachlassen der Anspannung dank Ihrer Standhaftigkeit eingestellt hat? Nein, da müssen Sie sich schon selbst auf die Schulter klopfen können und sich etwas zum Naschen gönnen oder einen Kinobesuch (der ist womöglich ohnedies mit einer Übung verbunden!) oder sich ein ausgedehntes Telefongespräch mit jemand Nettem erlauben. Mein Rat: Nehmen Sie die Sache ausreichend ernst, aber bedenken Sie: Gut Ding braucht Weile – und Ruhepausen und Belohnungen! Übrigens: Ich habe in der ersten Übungszeit immer Traubenzucker zu Belohnungszwecken und zur Stärkung bei mir gehabt.
38
Feind »Werfen Sie ihn hinaus, den Feind in Ihrem Haus!« Das haben Sie vielleicht schon gehört als Anleitung zum Kampf gegen den Zwang. – Ich will Ihnen etwas Heiteres erzählen. Es gibt bei uns in Österreich ein Toilettenpapier, da steht auf jedem Blättchen ein kluger Spruch geschrieben. Nicht unbelehrt sollten wir also die Toilette verlassen! Recht pädagogisch wirkt das manchmal für mich, die ich doch die Tochter eines Pädagogen bin und eigentlich schon genug habe von Belehrungen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Aber nun, da ich an einem Ratgeber schreibe, muss ich manchmal »gescheit« sein, sonst wird das kein Ratgeber! Was könnte in den Ratgeber passen? Da steht zum Beispiel auf einem Toilettenblättchen: »Liebe deine Feinde, denn sie verraten deine Fehler.« Der Spruch stammt von Benjamin Franklin, belehrt das Blättchen. Was hat das mit unserem Hilfs-ABC zu tun? Ich bin vor kurzem einer Therapeutin begegnet, die dazu aufforderte, den Zwang auch als Freund zu sehen. Wie bitte?! Damals konnte ich diese Anleitung nicht nachvollziehen. Aber die Erklärung dazu hatte mir dann eingeleuchtet: Der Zwang weist auf etwas hin. Er sagt etwas. Das darf man nicht überhören. Gerade, wenn Sie in Zwangsnot sind, spricht er sogar noch deutlicher, was wirklich die Mitursache für die Zwanghaftigkeit sein könnte. Es ist halt eine etwas kranke Art, wie der Zwang seine Freundschaft kundtut – und nur ein Freund auf Zeit (ein »Lebensabschnittsgefährte«).
39
Freiheit Zwangsabbau und Freiheit vom Zwang kann erlebt werden, wie neugeboren zu sein. Bitte, glauben Sie mir das, auch wenn Ihnen der Entschluss zu einer Therapie und die Therapie selbst große Schwierigkeiten bereiten. Ich habe von einer Betroffenen gehört, die fast ebenso lange unter Zwängen gelitten hatte wie ich. Jetzt, als Gesunde, sei sie fast dankbar für die Erfahrungen aus ihrer Erkrankung, meint sie. Jetzt wisse sie ihre Freiheit erst richtig zu schätzen. Ich für mich selbst finde, dass der Preis dafür zu hoch war. Außerdem gab es Mitleidende durch meine Erkrankung. Aber wer weiß schon wirklich um den Sinn des Leids? Dabei ist diese Freiheit für uns alle sehr relativ: Wir sind im Lauf unseres Lebens in vielfache Gewohnheiten, Rituale und Zwänge eingebunden.
Gedanken Gedanken sind frei! Niemand ist für seine aufdringlichen Gedanken verantwortlich. Die Gedanken kommen und gehen. Lassen Sie sie an sich vorübergehen, wie eine dunkle Wolke am Himmel. Die bleibt auch nicht immer da oben hängen! Je weniger Bedeutung Sie solchen unsinnigen Gedanken beimessen, desto schneller werden Sie diese wieder los. Nicht erschrecken – das ist eine wichtige Taktik gegen diese Gedanken. Auch, wenn die Gedanken noch so merkwürdig, für Sie beschämend oder bedrohlich erscheinen mögen. Ein Hilfssatz, der sich schnell sagen lässt: Blödsinn, ich bin nicht meine Zwangsgedanken! Fühlen Sie sich nicht als schlecht, schuldig, verantwortungslos oder unfähig wegen Ihrer Zwangsgedanken. Diskutieren Sie nicht mit dem Inhalt Ihrer Zwangsgedanken. 40
Auch hier gilt: Mit dem Zwang (mit dem Inhalt des Zwangsgedankens) diskutiert man nicht! Reine Zwangsgedanken, ohne Handlungsebene, seien schwer zu behandeln, höre ich. Ich habe auch selbst reine Zwangsgedanken gehabt und mit der Zeit und mit entsprechender Anleitung damit umzugehen gelernt. Ein Betroffener hatte Pech gehabt: »Ich bin in der Therapie gefragt worden, ob ich meine Mutter eigentlich wirklich liebe.« (Um dieses Thema hatten seine aufdringlichen Gedanken ständig gekreist.) Auch bei den Zwangsgedanken ohne Handlungsebene rate ich gern, diese zur Person zu erheben. Dann haben Sie es nicht mit etwas Abstraktem, sondern zum Beispiel mit einer lästigen Person zu tun, die sich in Ihren Gedanken wichtig machen will. Ganz praktisch: Ihnen schießt also wieder einmal so ein aufdringlicher Gedanke ein. Nicht erschrecken, schnell reagieren: »Na, da bist du ja wieder, du lästiger Kerl. Richtig klebrig bist du. Glaubst, du könntest mir Angst einjagen. Eigentlich sollte ich dich zur Tür hinauswerfen. Aber weißt du was, jetzt wirst du dich wundern. Kannst ruhig dableiben, da drüben in der Ecke oder unterm Tisch ist Platz für dich. Zeit habe ich allerdings keine für dich und Lust auch keine, mich mit deinem dummen Gerede abzugeben. Wenn dir langweilig wird, kannst wieder gehen, mir ist das egal.« Lassen Sie die Gedanken unerschrocken zu, wie lästige Mitbewohner. »Ich gewöhne mich daran, zurzeit komische Gedanken zu haben.« Lassen Sie sie zu, wie eine lästige Begleitung, wie Hintergrundmusik. Sie hören sie zwar, aber sie hat keine Bedeutung für Sie. »Bleib lei da«, sagt eine Südtirolerin in ihrer Mundart (»lei« = nur). Haben Sie schon einmal probiert, einen Ohrwurm loszuwerden? Als ich an diesem »ABC« zu schreiben begonnen hatte, da war mein Ohrwurm das Liedchen: ABC, die Katze lief im Schnee. Nichts zu machen, der Ohrwurm war einfach da. Daran sehen Sie, wie viel unmöglicher es ist, 41
sich gegen einen Gedanken zu wehren, von dem Sie glauben, der darf nicht sein, ich will diesen Gedanken unbedingt loshaben, er macht mir Angst. Also: Als unsinnigen Zwangsgedanken erkennen, zulassen, sogar herholen dürfen Sie ihn, wenn Sie aktiv üben wollen. Sie dürfen, wenn Sie mutig sind, den Gedanken zu einer phantasievollen Geschichte ausbauen, die dem Zwang den Wind aus den Segeln nimmt. Nicht wegdrängen, nicht erschrecken, dem Inhalt keine Bedeutung beimessen. Nicht erwarten, dass diese Ihre Bemühungen gleich Früchte tragen. Auch hier gilt: Gewöhnung an den neuen Umgang mit Zwangsgedanken braucht Zeit und ernsthaftes Üben. Sie können sich auch sehen wie ein außenstehender Beobachter, das schafft mehr Abstand zu Ihnen und Ihren Gedanken: »Da sitzt sie nun und grübelt, sicher hat sie wieder Zwangsgedanken. Ganz abwesend wirkt sie. Man sieht ihr an, dass sie ängstlich ist. Wahrscheinlich geht ihr Puls schneller, der Hals scheint ihr wie zugeschnürt. Sie sollte wissen, dass auch andere Leute aufdringliche und unsinnige Gedanken haben, das möchte ich ihr sagen. Das ist normal. Ihr Problem ist, dass ihr Zwang und ihre Angst (nicht die Wirklichkeit) ihre Gedanken zu groß und bedeutend werden lässt.« Etwas Kurioses: Ein Betroffener (nämlich der mit der »mangelnden Mutterliebe«) fühlt sich verunsichert, wenn er keine diesbezüglichen Zwangsgedanken hat. »Aha«, sagt der Zwang, »jetzt ist es dir anscheinend egal, ob du deine Mutter liebst!« Wahrhaft ein schlechter Berater, der Zwang. »Freuen Sie sich und genießen Sie’s, Sie sind auf einem guten Weg«, das darf ich ihm sagen. Leiden Sie unter aggressiven Zwangsgedanken? Leiden Sie unter Bildern oder Vorstellungen aggressiver Natur? Haben Sie Angst, Sie könnten derlei in die Tat umsetzen? Zum Beispiel das geliebte Kind verletzen oder sexuell aggressiv handeln? 42
Seien Sie beruhigt, gerade Sie werden nichts dergleichen tun. Ich habe schon von verzagten Zwangspatienten gehört, die sich von solchen Meldungen beunruhigen ließen: »Sie werden zu 99,9 Prozent niemals so etwas tun.« Das ist einfach vollkommen unnötige Spitzfindigkeit, die absolut gar nichts bringt. Wozu soll das gut sein? Diese 0,1 Prozent sind einfach Quatsch, so wie der Zwang auch! (Siehe unter Q!) Schon Ihre Reaktion auf solche aufgezwungenen Gedanken zeigt Ihnen – wenn auch auf sehr unangenehme Weise – was Sie wirklich wollen. Da gibt es nichts zum Anzweifeln. Trauen Sie sich selbst wieder über den Weg. Sie werden »es« nicht tun, auch nicht, wenn Sie unkonzentriert oder abgelenkt oder gar in Hypnose sind (eine Befürchtung von Betroffenen mit derartigen Zwangsgedanken). Noch ein Rat: Lassen Sie sich nicht immer wieder die Versicherung geben, wie harmlos Sie in Wirklichkeit sind. Sagen Sie sich nicht ständig, dass Sie doch eine gute Mutter (ein guter Vater) sind und keiner Fliege etwas zuleide tun können. Das fällt unter Zwangsbefriedigung und neigt zum Ausufern!
Genuss Seien Sie nicht traurig, wenn Sie als sehr leidende Zwangskranke mit dem Begriff Genuss noch nicht viel anfangen können. Vielleicht löst die Aufforderung an Sie, etwas zu genießen, in Ihrem momentanen Zustand eher noch schmerzliche Gefühle aus oder auch Gefühle von Neid gegenüber solchen, die das so gut können. Ich könnte Sie sehr gut verstehen. Mit einem Berg von Zwängen, an dem noch gearbeitet werden soll, und womöglich sonstigen Lebensproblemen dazu lässt es sich nun mal nicht so gut genießen. 43
»Stellen Sie sich etwas Schönes vor«, wurde ich in der ersten Zeit der Therapie aufgefordert. Ein guter Rat, aber was tun, wenn das Herz dabei so schwer ist? Genießen habe ich mittlerweile recht gut gelernt; das passiert nicht nur im Moment des Erlebens, sondern auch nachher, in der Erinnerung. Echtes Genießen hat mit Liebe zu sich selbst zu tun, damit, sich selbst Freude bereiten zu können und sich selbst etwas gönnen zu dürfen. Sie sind schon auf einem guten Weg, wenn Sie inneres Behagen zulassen können, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Wir kennen ihn doch, den Zwang, der einem so oft die Freude vermiesen möchte. Darin sind wir uns einig, das habe ich mit vielen Betroffenen besprochen: Wir sind, vor allem mit dem Abbau der Zwänge, gut im Genießen der kleinen Dinge des Lebens. Seit meinem Gesundwerden kann ich zum Beispiel den Christbaum in unserem Wohnzimmer ganz anders genießen. Gut gewachsen muss er sein, schön geschmückt und eine Freude zum Anschauen, wenn am Abend die Kerzen brennen. Ist er »sauber«? Ach, diese Bedenken sind doch Schnee von gestern! Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie durch die Therapie lernen, Gelegenheiten zum Genießen dankbar und fröhlich und unbeschwert wahrzunehmen.
Gesundheit Ob ich jetzt wirklich ganz gesund bin, werde ich von Betroffenen manchmal gefragt. Ich habe mir über diese Frage immer wieder einmal Gedanken gemacht. Ich werde Ihnen, so gut ich es vermag, Antwort darauf geben. Ich bin bestimmt gesund vom Zwang. Von mir behaupten zu wollen, ganz gesund zu sein, also hundertprozentig, das wäre ein Vollkommenheitsanspruch, dessen Erfüllung 44
es nicht gibt. Überhaupt: Wer ist schon ganz gesund von Zwängen? Wer reagiert immer »normal« und hat keine Störgedanken? Und was genau ist vollkommene Gesundheit? Die Weltgesundheitsorganisation versteht darunter ein vollkommenes körperliches und seelisches Wohlbefinden, und nicht nur das Fehlen von Krankheit. Ich erlebe Situationen, die ich früher als Zwangserkrankte gefürchtet habe, manchmal anders als so genannte Normale. Manchmal erlebe ich solche Situationen bewusster oder auch empfindlicher, sogar auch mal als störender als Menschen, die das Thema Schmutz beziehungsweise Sauberkeit oder das Thema »Verantwortlichkeit für andere« und anderes nie als Zwang erlebt haben. So gesehen hat es wenig Sinn zu fragen, ob ich »ganz gesund« bin. Ich fühle mich gesund, ich bin in meinem Denken und in meinen Handlungen nicht eingeschränkt und ich kann insgesamt so leben, wie ich das möchte. Es sind eigentlich nie mehr als kleine gedankliche Belästigungen oder Missempfindungen, die natürlich auch stimmungsabhängig sind. Wenn ich müde und genervt aus dem Zug aussteige, verärgert, weil ich unterwegs den Anschlusszug verpasst habe, dann fühle ich mich eher »schmutzig«, als wenn ich die Zugfahrt in angenehmer Unterhaltung im Speisewagen bei einer Tasse Kaffee verbracht habe. Das kennen Sie sicher auch, und derartiges erleben wohl auch die »Normalen«. Vor allem während der Therapiezeit ließen Erfolgserlebnisse und gute Stimmung die Zwänge schmelzen, während sich der Zwang gern zu Misserfolgen und Minderwertigkeitsgefühlen gesellt hat. Es gibt also im Lauf eines Tages ab und zu kleine Belästigungen, die von mir mehr oder weniger empfindlich erlebt werden oder die mich an frühere Zwanghaftigkeit erinnern. Situationen, Befindlichkeiten, Zustände, Ansprüche an mich und an die anderen waren einmal sehr bedeutend. Ein kleiner »Abglanz« davon wird mir sicher erhalten bleiben. 45
Manchmal ärgere ich mich regelrecht über mich selbst: Ich habe den Eindruck, dass ich bei der Beantwortung der Frage, ob ich wohl ganz gesund bin, zu strenge Maßstäbe anlege. War ich doch auch in der Therapie, beim Üben, manchmal zu streng mit mir selbst! Ich habe durch die Therapie jede Menge an Hilfreichem mitbekommen. Dadurch kann ich sehr vieles lässiger, großzügiger und selbstsicherer abtun als »Normale«. Dass ich gesund geworden bin, kann mich heute noch fröhlich und dankbar stimmen. Das ist nicht ein permanentes Jubilieren, das wäre wohl auch zu anstrengend. Außerdem gewöhnt man sich ja leider recht schnell an etwas Gutes. Ich spüre diese Freude am Gesundsein, wenn das Wieder-Funktionieren von ziemlicher Wichtigkeit ist (zum Beispiel wenn die Mutter wieder einmal gestürzt ist und ins Krankenhaus gebracht werden muss); aber ich kann die Freude auch in recht unbedeutenden Situationen erleben, einfach weil das Handeln und Überlegen oft so unkompliziert geworden ist. Ich muss mich nicht mehr unnötigerweise fürchten! Ich gehe noch heute gern zum ganz gewöhnlichen Lebensmitteleinkauf (es sei denn, ich muss viel schleppen). Schnell aus dem Haus, die einzige Vorkehrung ist vielleicht etwas Lippenstift. In der kranken Zeit hatte sich das zunehmend zum »Katastrophenunternehmen« entwickelt. Heute kann mich eine so simple Angelegenheit wie Lebensmitteleinkauf (vielleicht kaufe ich etwas besonders Leckeres, vielleicht treffe ich jemand Netten) auch 14 Jahre nach Therapieende noch froh und dankbar stimmen! Ich weiß von Patienten, die nicht das Glück – oder was immer mir geholfen hat – erleben können, Zwänge so abzulegen wie ich. Aber auch solche, die »nur« Teilerfolge haben, können wieder ein normales Leben führen und sich des Lebens erfreuen.
46
Gewohnheit »Es ist alles eine Frage der Gewohnheit«, so hieß es in der Therapie. Eine Frage der Gewohnheit, sich an Neues, im Moment noch sehr Angst machendes Verhalten zu gewöhnen? Ich war fast empört, als ich das in der Therapie zum ersten Mal gesagt bekam. »Der Therapeut hat doch gar keine Ahnung, wie sehr ich mich fürchte«, habe ich gedacht und: »Nie werde ich mich daran gewöhnen, Geld unbekümmert (und vielleicht gar noch mit angenehmen Gefühlen verbunden) in die Hand zu bekommen«. Lassen Sie sich überzeugen. Das, was ich damals so angezweifelt habe, habe ich dann wirklich erlebt: Ich muss zunächst Gefürchtetes oft und oft wiederholen, dann wird das auch für mich zur Selbstverständlichkeit. »Ich kann doch nicht all das, was mein Leben zwanghaft belastet, ständig wiederholen, damit es mir zur Gewohnheit wird«, habe ich in der ersten Therapiezeit gedacht. Trösten Sie sich, das brauchen Sie auch nicht. Sie werden erfahren, dass Sie viel von dem, was Sie lernen, auch auf andere Bereiche übertragen können. Wenn Sie sich das Wieder-Angreifen von Türklinken erobert haben, dann werden Sie das auch beim Anfassen vom Geländer im Treppenhaus schaffen. Wenn Sie sich durch fleißiges Üben dran gewöhnen, den Herdknopf nur einmal aufmerksam zu kontrollieren, dann werden Sie auch beim Abschließen der Autotür selbstsicherer werden. Übung macht den Meister und Erfolg bringt Erfolg. Und: Der Erfolg liegt in der Wiederholung! Aufmunternde selbstklebende Zettelchen, da und dort in der Wohnung an Türstock oder Wand geheftet, könnten Sie zum fleißigen Wiederholen motivieren. (Achtung: Diese Zettelchen sind bei uneingeweihtem Besuch zu entfernen; nicht jeder versteht, wenn er auf einem Zettel liest: »Immer wieder den Klodeckel anfassen!« – »Licht und Kaffeemaschine beim Weggehen nicht abschalten!« – »Immer 47
wieder etwas auf den Boden fallen lassen.« – »Socken in die Besteckschublade geben.« Solche Anweisungen versteht nur unsereins.)
Heimlichkeit Die Zwangsstörung wird auch als »heimliche Krankheit« bezeichnet. Gemeint ist damit, dass Patienten ihre Zwänge selbst den nächsten Angehörigen gegenüber so lange verheimlichen wie nur irgendwie möglich. Das hat mit Scham wegen der eigenen Gedanken und Handlungen zu tun. Mir als Kotherapeutin, als einer ehemals Zwangserkrankten, erzählen die Betroffenen oft ihre intimsten Befürchtungen. Für eine junge Frau, die sich ihre Kinder so sehr gewünscht hatte, ist es ein schrecklicher, abstoßender und intimer Gedanke, sie könnte ihre Kinder verletzen oder sogar töten. Die Heimlichkeit verhindert auch, dass sich Patienten rechtzeitig an Fachleute wenden. Zu oft sind sie auch hier auf Unverständnis gestoßen. Deshalb dauert es auch so lange, bis Hilfe aufgesucht wird. Deshalb kann man Ihnen nur raten: Wenn Sie denken, dass Sie unter einer Zwangsstörung leiden könnten, wenden Sie sich an einen Fachmann, am besten gleich an einen Verhaltenstherapeuten oder eine -therapeutin. Hier besteht eine gute Chance auf Hilfe.
48
Hölle Ich weiß nicht, wie oft mir in der Kotherapie die Angst vor der Hölle begegnet ist. Zwangserkrankung kann wie »die Hölle auf Erden« sein. Zudem fürchten nicht wenige Zwangskranke einen weiteren Höllenaufenthalt im Jenseits. »Wir treffen uns dann im Himmel in der Zwänglerecke«, scherze ich manchmal. Der Therapeut sagte seinerzeit darauf: »Da wird dann Wasser und Seife bereit sein.« Soll er nur reden! »Und für Sie wird dort oben ein Aschenbecher bereitstehen«, gebe ich Kontra. Ich habe nicht nur in der Kotherapie viel Angst vor der Hölle erlebt. Bereits als zwanghaftes Kind und auch später noch hatte ich Angst vor der Hölle, vor der Strafe Gottes. Eine Patientin, die ich betreut habe, stellte sich Gott vor wie das bekannte Auge im Dreieck, stets präsent. Es sieht alles, besonders unsere Fehler beobachtet das Auge streng. Der neue Bischof in unserer Stadt ist mir sehr sympathisch; gar nicht verzopft, ernsthaft, gescheit; auf mich macht er den Eindruck eines gütigen Menschen. Er flößt mir Vertrauen ein; was er sagt, kann ich gut annehmen. In einer Zeitung hatte der Bischof etwas geschrieben, das mir sehr gefallen hat; es betrifft die Hölle. In Stichworten möchte ich es hier wiedergeben: Ein Zeitungsredakteur fragte im Hinblick auf all das Schreckliche an Gewalt und Terror in der Welt: »Gibt es das Verzeihen Gottes für alle?« Der Bischof: »Ich darf darauf hoffen, dass Gott das Heil aller Menschen will. Ich hoffe sehr, dass die Hölle leer ist.« Er spricht von der freien Entscheidung des Menschen, mit der er sich Gott zuwenden oder sich ihm verweigern kann. Von der Möglichkeit der barmherzigen Vergebung für alles, was der Mensch verursacht, spricht der Bischof. Wenn ich so etwas lese, dann kann ich das annehmen und drauf vertrauen, dass ich glauben darf, was hier gesagt wurde. Ich betreue eine Patientin, deren Krankheit die Ursache dafür ist, dass sie so hilfreiche Gedanken nicht an49
nehmen kann. Ich sage ihr, dass ich dran glaube, dass Christus auch um diese ihre Not weiß. Der Glaube ist ein Geschenk, Geschenke kann man annehmen, man muss es nicht. Sich um Glauben zu bemühen ist wie Beziehungsarbeit. Das funktioniert nicht ohne Anstrengung. Das ist wie in einer Freundschaft, denke ich; da muss ich mich auch um Kontakte bemühen, um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten und einander verstehen zu können. Ist es richtig, auch solche Gedanken in einen Ratgeber zu packen? Ich denke, ja, und habe auch beobachtet, dass Patienten mit Stütze aus dem Glauben noch mehr Kondition in der Therapie haben.
Humor Den Humor mag der Zwang nicht. Stellen Sie sich vor, Sie getrauten sich als ein beim Autofahren zwanghaft Ängstlicher zu sagen: »Heut fahr ich alle nieder!« Wenn Sie sich als Betroffener solches zu denken getrauen, dann sind Sie therapeutisch gut unterwegs. Dann zeigen Sie dem Zwang auch, dass Sie ihm nicht mehr das Märchen abnehmen, Gedanken könnten sich bewahrheiten oder dass Gedanken und Handlungen das Gleiche seien. Es gibt Patienten, die sich vom Zwang derartiges einreden lassen. Im Umgang mit Patientinnen und Patienten ist für mich als Kotherapeutin der Humor durchaus wichtig, auch wenn er für mich immer bedeutet, den Patienten nicht auf den Arm zu nehmen. Aber dem Patienten vermitteln, dass man sich selbst beziehungsweise den Zwang nicht immer allzu ernst und wichtig nehmen sollte, das darf auch mal sein. Therapeuten sollten allerdings respektieren, wenn depressive Patienten keine Lust zum Spaßen haben. Man darf 50
annehmen, dass recht bedrückte, etwa giftängstliche Patienten es nicht hilfreich und lustig finden, wenn sie vom Therapeuten auf diese Weise empfangen werden: »Nun, wen haben Sie heute vergiftet?« Wehren Sie sich, wenn Sie solch einen Stil nicht mögen, wenn Ihnen so etwas gegen den Strich geht! Es lässt sich alles aussprechen, Sie müssen sich nur trauen!
Impulsiv Spontan und impulsiv sein dürfen, nicht immer alles absichern, das kann wunderbare Gefühle der Freiheit vermitteln. »Jetzt gehe ich einfach dorthin, ich bin neugierig, was geschieht.« »Jetzt wehre ich mich einfach, was kann schon passieren.« »Jetzt mache ich es einmal ganz anders, wen geht das was an! Zum Kuckuck mit dem ewigen Absichern, ich möchte leben.« »Jetzt sage ich einfach einmal, was ich denke, ohne Angst vor Ablehnung und Kritik!« Und auch: »Mir reicht es! Das ist nicht mehr zum Aushalten! Jetzt rufe ich bei der mir empfohlenen Therapeutin an und bitte um einen Termin. Mal sehen, was mich erwartet!«
Informationen Es gibt heutzutage viel mehr Informationen über die Therapie bei Zwangserkrankungen als zu meiner Zeit. Wie immer, so auch hier, gibt es kluge und hilfreiche Informationen und leider auch solche, vor allem im Fernsehen, die eher abschrecken. Mich würde nicht wundern, wenn so 51
mancher Zwangspatient auf der Suche nach Hilfe bei derartigen Informationen denkt: »Nein, danke, auf solch eine Therapie habe ich keine Lust. Die überzeugt mich gar nicht. Die macht mir zuviel Angst.« TV-Sendungen, die über das Phänomen Zwangserkrankung berichten, scheinen manchmal eher auf die Lust des Menschen am Voyeurismus zu spekulieren, als dass in der Sendung aufgeklärt und mit Fingerspitzengefühl die Möglichkeit der Hilfe aufgezeigt wird. Medien funktionieren so manches Mal eben nach anderen Prinzipien als mit der Absicht, fachliche Hilfestellung für Betroffene zu geben. In einem Frauenblatt habe ich einen Artikel über die Therapie bei Zwangserkrankungen gelesen, übertitelt mit: »Das beste Gegenmittel: Tun, was Angst macht.« So wenig einfühlsam, einfach in einer Titelzeile – völlig unvorbereitet – an den Kopf geworfen, gewinnt man kaum Zwangskranke für eine Therapie! Informieren Sie sich lieber über Therapeuten oder Therapeutinnen, die Verhaltenstherapie praktizieren. In Österreich gibt es dafür die Internetseite www.zwaenge.at. Da sind Verhaltenstherapeuten für jedes Bundesland aufgelistet. Dort können Sie auch Kontakt aufnehmen mit der sehr netten, engagierten und einfühlsamen ehemals erkrankten Theresa, die diese Internetseite betreut (unterstützt durch ihren computerversierten Mann Josef). In Deutschland gibt es die »Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen« mit der Internetseite www.zwaenge.de und entsprechend in der Schweiz die »Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen« www.zwang.ch – fragen Sie dort nach! In Selbsthilfegruppen werden Sie durch die Erfahrung ebenfalls Betroffener vielleicht die Empfehlung für einen guten Therapeuten erhalten. Fragen Sie potentielle Therapeuten auch, ob sie (ausreichend!) Erfahrung mit Zwangspatienten haben. »Ich habe auch schon mit Zwangspatienten gearbeitet«, diese Aussage würde mir nicht unbedingt reichen. 52
Job Machen Sie sich ihre Therapie zum Job. Wenn zeitlich möglich, sogar zum wichtigsten momentanen Job in Ihrem Leben. Der Lohn dafür wird so groß sein, wie Sie ihn sich vor der Therapie gar nicht vorstellen können. Arbeiten Sie zu zweit mit Ihrem Therapeuten oder Ihrer Therapeutin. Damit meine ich, dass Sie auch selbst Ideen mit einbringen sollten. Therapie kann nicht eine ausschließliche »Berieselung« von Lösungsvorschlägen, Hilfestellungen und Anregungen seitens des Therapeuten sein. Therapie ist wie eine Bergtour und Ihr Therapeut (oder die Kotherapeutin) ist Ihr Bergführer: Sie selbst haben das Ziel ausgewählt, Sie müssen auch selbst die schwierigen Passagen gehen, aber der Therapeut ist Ihr Begleiter, er sichert Sie dort ab, wo es notwendig ist. Und: Es ist Ihr Schweiß und es ist Ihr Erfolg! Suchen Sie mit Engagement und Ernsthaftigkeit, vor allem mit fortschreitender Therapie, nach persönlichen Möglichkeiten, die Zwänge abzubauen. Therapie bedeutet nicht: Da gibt es nur das eine »Strickmuster«, dem zu folgen ist, und das gibt der Therapeut vor. So hatte ich mir anfangs Therapie gegen den Zwang vorgestellt. Ich selbst war einmal sehr verunsichert nach den Worten des Therapeuten: »Ich muss erst selbst über eine Lösung nachdenken, wie Ihr Problem mit dem Kleiderwechsel in den Griff zu bekommen wäre.« Ich hatte damals geglaubt, dass es dafür ein Rezept gibt und dass das ausschließlich vom Therapeuten kommt. Ich hatte mir zunächst in meiner riesengroßen Unsicherheit und Zwanghaftigkeit keine eigenen Ideen und neue Wege im Denken und Handeln zugetraut. Mit der Zeit konnte ich dann Eigeninitiative entwickeln. War meine Stimmung schlecht und deprimiert, dann habe ich verbissen geübt. War ich gut drauf, dann ist mir allerhand Ungewöhnliches und sogar Spaßiges zum Üben eingefallen. Ich habe schon einmal andernorts erzählt, wie ich mich, 53
»schmutzig«, weil von draußen gekommen, in meinen Kleiderschrank gekauert und erlebt habe, wie ich eins sein kann mit dem Inhalt im Kleiderschrank. Das Trennen von »guter Sauberkeit« und »bösem Schmutz« war aufgehoben. Die Übung war recht ungewöhnlich, aber im Kleiderschrank herrschten Erfolgserlebnis und Fröhlichkeit vor Ängstlichkeit und Minderwertigkeitsgefühlen. Nebenbei: Mein Vater war bezüglich Schmutz absolut unzimperlich. Wenn der Müllcontainer randvoll war, ist er hineingestiegen und hat – darin herumstampfend – wieder Platz gemacht. Er gehörte auch zu den ersten Touristen, die (gemeinsam mit meiner Mutter) auf Trekkingtour in Nepal waren. Mitteleuropäischen Standard in Bezug auf Hygiene und Reinlichkeit musste man dabei vergessen! Die Träger haben nicht viel Federlesens gemacht, wenn sie auf die Toilette mussten. Der Wanderpfad lag ihnen dabei am nächsten. Meine Eltern waren also in Hygienefragen recht unkompliziert. Es kann wohl auch passieren, dass man, statt Verhalten zu übernehmen, (zwanghaft) in Opposition dazu geht. Heute genügt mir meistens »der Schein«: Wenn das Porzellan der Bahnhofskloschale glänzt, dann fühle ich mich dort als Kunde gut bedient. Hinterfragen muss ich nicht mehr. Mir genügt, was ich sehe (oder rieche oder spüre), mehr muss ich nicht mehr wissen. Dass da noch Spuren von allerlei sind, das ist mir schon klar, aber es hat keine Bedeutung mehr. Beneiden Sie mich nicht, noch Betroffene! Ich habe übergeübt bis zum Gehtnichtmehr! Diese Therapie verlangt viel und schenkt viel. (Das Überüben bespreche ich beim Stichwort »Konfrontation«.) Trösten Sie sich – ich war sehr oft alles andere als »toll unterwegs«. Meine Therapie war einem häufigen Auf und Ab unterworfen, aber sie ist letztendlich sehr gut ausgegangen. Ich denke, ich hätte streckenweise unbedingt Kotherapie gebraucht. Kein Therapeut wird je realisieren können, welche Schwierigkeiten ein Erkrankter haben kann, der an 54
einem »relativ einfach zu behandelndem Zwang«, dem Waschzwang, leidet. Mein Hinarbeiten zum »normalen« Denken und Handeln war ungeheuer schwierig. Jeder Tag brachte Fragen über Fragen. Die Spitzfindigkeit des Zwangs hat sich auch während der Therapie in ständigen Unsicherheiten widergespiegelt. Maßlos rigoros war der Zwang mit mir umgegangen. »Das, was ich Ihnen an Hilfeleistung vor Ort, also dort, wo sich der Zwang abspielt, anbieten kann, das hätte ich seinerzeit selbst gern gehabt«, sage ich manchmal zu Betroffenen. Viele (längst nicht alle) bräuchten Kotherapie. Ein, zwei Begleitungen durch den Therapeuten sind oft viel zu wenig. Unter Kotherapie verstehe ich ein ausgiebiges Angebot an zusätzlicher Hilfe außerhalb der Praxis. Nehmen Sie den schwierigen »Job« der Therapie an, Sie können auch nichts Besseres tun! Eine Zwangserkrankung macht im Lauf der Jahre müde und mürbe. Sie brauchen noch genug Kraft für die Therapie. Geduld und Experimentierbereitschaft wünsche ich Ihnen, auch wenn Experimentieren bei einer Krankheit, die gerade in dem immer Gleichen Sicherheit findet, zunächst sehr schwer fällt. Suchen Sie gemeinsam mit dem Therapeuten nach Möglichkeiten. Sie dürfen auch den Mut zum Widerspruch bei einem Therapievorschlag haben. Therapeuten sind froh um Mitarbeit; Meinungsverschiedenheiten sind durchaus »eingeplant«. Zu passive Patienten sind eine mühsame Angelegenheit in der Verhaltenstherapie. Bei meinem Job als Kotherapeutin habe ich von den Patientinnen und Patienten ebenfalls eine ganze Menge gelernt, nicht nur sie von mir. Vieles davon ist (hoffentlich) wiederum den anderen Betroffenen zugute gekommen.
55
Konfrontation Mein Ratgeben zum Thema Konfrontation beziehungsweise Exposition wird umfangreich, das wird sich nicht umgehen lassen. Kein Wunder, denn die Konfrontation, mit dem anschließend so wichtigen Aushalten, also dem Aushalten von unangenehmen Gefühlen und dem Verzichten auf das »Wiedergutmachen«, das ist das Herzstück der Verhaltenstherapie gegen den Zwang. Also krempeln wir die Ärmel hoch, nehmen wir uns Zeit (so wie für die Therapie auch, das ist wichtig, das dürfen Sie sich zugestehen) und gehen wir das Thema an. Ich finde, das Wort Konfrontation (der etwas umständliche Fachausdruck heißt Konfrontation und Reaktionsverhinderung) klingt irgendwie streng und herb. Kommt Ihnen das auch so vor? Wie eine Aufforderung: »Jetzt mach dich ran, jetzt wirst du etwas erleben!« Das Wort Konfrontation bedeutet für uns das Gegenteil von Vermeiden von sehr unangenehmen Zwangsangelegenheiten. So heißt das Wort Konfrontation auch nicht: Ich lasse den Feind in meinem Haus, da kenne ich mich aus. Ihn hinauszuwerfen getraue ich mich nicht. Das Zwangsverhalten zu praktizieren, das bin ich gewöhnt, so sehr ich auch drunter leide. Mir gibt das ein Gefühl von Sicherheit, auch wenn ich mir dieses Gefühl sehr teuer erkaufen muss. Und wenn ich es dann endlich geschafft habe, weiß ich wohl, dass dieser Zustand von »Sicherheit« auf wackeligen Beinen steht. In Österreich sagt man: »Das Glück ist ein Vogerl!« Das Gefühl der Erleichterung nach einer Zwangsbefriedigung ist auch wie ein Vogerl. Es kann gleich wieder dahin sein; was bleibt, ist Frust, Zorn, Trauer, Verzweiflung, innere Qual. Mich wollten solch »frevelhafte« Gedanken über das Gefühl von (scheinbarer!) Sicherheit durchs Zwangsverhalten sogar noch in der Anfangszeit der Therapie verführen. Da hatte mich solches Denken und auch Zweifeln an dem 56
Erfolg der Therapie geplagt: »Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, wo kann ich mich noch festhalten?« In meiner zwangskranken Zeit habe ich – zwar meistens mit einem ängstlichen Gefühl – genau gewusst, was zu tun ist. Und wenn sich dieses Verhalten noch so umständlich gestaltete – ich hatte mein Programm im Kopf, mein eingefahrenes, immer gleiches Verhalten, zum Beispiel: Wenn ich aus dem Haus gehe, dann überprüfe ich sechsmal den Herd. (Hatte mich allerdings jemand beim Kontrollieren gestört oder war ich mir nach einer Kontrolle nicht sicher, dann ging’s sogar wieder von vorne los.) Ich habe gewusst, dass ich mich vor dem Stadtbesuch »waschmaschinenfest« anziehen muss, das würde die Sauberkeitsbemühungen beim Heimkehren erleichtern. Die Badezimmertür und die Schlafzimmertür lasse ich lieber gleich geöffnet, damit ich, mit schmutzigen Händen zurückgekommen, weniger Kontakte habe und also diese Türklinken nicht putzen muss. Und so weiter und so weiter. Während ich dies schreibe, atme ich tief durch – was habe ich mir damals nur alles antun müssen! Aber wiederum: Was hatte mich dann gesund gemacht? Vor allem die Konfrontation und natürlich das Aushalten. Denn Konfrontieren ohne das anschließende Aushalten funktioniert nicht. Das wäre, wie wenn man ins Wasser spränge und sich dann empörte, weil man nass geworden ist. Diese Verhaltenstherapie ist wie ein Wechselspiel: Sie lernen anders denken und Sie getrauen sich zu konfrontieren, das heißt, Sie setzen sich zwanghaften Situationen aus. Und durch dieses neue Handeln lernen Sie auch anders zu denken. Sie gewöhnen sich an früher Unmögliches, an das, was andere Leute auch dürfen, und Sie gewinnen neue Erkenntnisse. Ihre Einstellung zu früher Gefürchtetem und oft unmöglich Gewordenem verändert sich. Macht Ihnen das Angst? Sagen Sie, Sie wollen nicht umgekrempelt werden? Das werden Sie nicht! So wie Sie auch durch hilfreiche Medikamente Sie selbst bleiben. Fürchten Sie, nicht 57
mehr tun zu dürfen, was Ihre Identität ausmacht? Ich könnte Ihre Befürchtungen verstehen. Aber denken Sie doch zurück an die Zeit, da Sie noch nicht zwanghaft waren. Sehnen Sie diese Zeit nicht wieder herbei? »Ich verstehe es nicht, damals war mir so vieles möglich, was mir heute abhanden gekommen ist.« Sehen Sie, das sollen Sie zurückgewinnen. Vielleicht sagen Sie jetzt: »Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.« Wenn Sie noch so denken, dann könnte ich auch das gut verstehen. Ich hatte auch meine großen Zweifel. Ein fremdes WC ist ein Horror; das wird es immer bleiben – dachte ich. Ich habe aber gelernt, meine Einstellung zu verändern. Um das Benutzen dieser »Horroreinrichtung« bin ich dabei nicht herumgekommen. Nur hat sich aus dem Horror eine praktische Einrichtung entpuppt, nicht gerade, um mich darin wie zu Hause zu fühlen, aber durchaus benutzbar, ohne die vorher befürchteten Folgen. (Ist das WC für mich zu schmutzig, dann suche ich mir ein anderes, das gestehe ich mir zu.) Das war Knochenarbeit, manches Mal verbunden mit Tränen, aber oft auch mit einem unbeschreiblichen Gefühl des Triumphes und der Freude! Ich habe einmal, während meiner eigenen Therapie, in der Biographie einer inzwischen in der Befindlichkeit stark gebesserten Zwangspatientin gelesen. Sie hatte geschrieben: »Ich lernte leicht.« Sie meinte, dass sie in der Therapie rasch Fortschritte machte. Ich habe nach dieser Meldung das Buch in den Abfalleimer geworfen (obwohl mir damals der Abfalleimerkontakt noch recht schwer gefallen war). Ich wollte dieses Buch nicht mehr haben, denn was mich betrifft, so habe ich mich überhaupt nicht leicht getan. Konfrontieren vom Aufstehen bis zum Schlafengehen – ich habe wirklich nicht leicht gelernt. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um gesund zu werden. Ich persönlich finde gar nicht, dass zwei Jahre lang sind, um von so einer heimtückischen Krankheit loszukommen. Ich habe sehr unter depressiven Phasen gelitten und das Einstellen auf wirksame 58
Medikation dagegen hatte eine ganze Weile gedauert. Diese Erfahrung habe ich leider auch machen müssen. Darüber ist viel Therapiezeit vergangen. Aber auch das habe ich hinter mich gebracht. Ich habe in der Kotherapie so manche betreut, die weniger Schwierigkeiten hatten als ich. Vielleicht gehören Sie auch zu diesen. Wie auch immer, ob Sie nun zu den »Flotten« oder zu den »Langsameren« gehören, Sie können es schaffen, aber nur, wenn Sie es auch versuchen! Konfrontation bedeutet laut therapeutischem Fachwörterbuch die Darbietung einer vom Erkrankten gefürchteten Situation. Ich habe mich also diesen so genannten Darbietungen stellen müssen. Manchmal mit dem Mut der Verzweiflung, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Aber oft habe ich Konfrontation auch ganz anders erfahren. Ich habe mit fortschreitender Therapie eine neue Erkenntnis erworben: Ich mache da endlich etwas äußerst Sinnvolles nach einer sehr langen Zeit eigentlich unsinniger Plackerei. Als Kranke habe ich doch so oft gespürt, dass das, was ich da tue, niemand gut findet, im Grunde genommen ich selbst auch nicht. Die einzige Belohnung ist ein momentanes gutes Gefühl, eine kleine Auszeit vom Zwangsalltag. Was kann es Ihnen nun leichter machen, ins kalte Wasser zu springen? Vielleicht meine Worte voll Überzeugung: Ich habe es geschafft, mit Seufzen und Hadern zwar, aber letztendlich gut. Warum sollte Ihnen dies nicht auch gelingen! Ich bin jetzt schon viele Jahre gesund, habe inzwischen allerhand an wirklichen Lebensbelastungen aushalten müssen (davor ist man trotz erfolgreicher Therapie nicht gefeit) und konnte mir dennoch den Zwang vom Leibe halten. Und was – ganz praktisch – kann Ihnen Erleichterung schaffen, wenn Sie das tun müssen, was Ihnen eigentlich ausgeprägtes Unbehagen, wenn nicht sogar massive Angst bereitet? Haben Sie jetzt Geduld und geben Sie auch mir Zeit, darüber zu sprechen. Bei der Beantwortung dieser 59
Frage reicht nicht das Vermitteln von ein paar guten Tricks, sondern eine ernste Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ich will versuchen, Ihnen ein Bündel an Ratschlägen zusammenzustellen: • Sie sollten nicht allein, also nicht ohne therapeutische Begleitung, versuchen, mit Ihrer Krankheit fertig zu werden. Das könnte Sie bei Misserfolgen entmutigen und Ihnen die Überzeugung nehmen, dass eine Zwangskrankheit behandelbar ist. • Das Wissen, weshalb ich vermutlich zwangskrank geworden war, hat mir bei den Konfrontationen geholfen, mir mehr Selbstvertrauen gegeben: das Bewusstsein, dass nicht meine persönliche Unfähigkeit und Ungeschicklichkeit dran »schuld« sind, zwangskrank zu sein, sondern widrige Umstände, das Aufwachsen, persönliche Überängstlichkeit, momentane Lebensumstände, eine besondere Verletzlichkeit. • Wenn mir etwas von früherer Zwanghaftigkeit bewusst wird, dann denke ich mir ganz schnell: Ich brauche das, um gesund zu bleiben. Bin ich unterwegs und muss auf eine fremde Toilette, dann sage ich zu mir: »Geh nur, Ulrike, das tut dir gut!« So hört es sich freundlich an und hilft mir, am Ball zu bleiben. • Ich nehme die Welt in ihrer unveränderlichen Unvollkommenheit an. Das gibt Mut, wenn ein Zwanghafter Hundertprozentiges verlangt. Hundertprozentiges gibt es nicht. Mit diesem Gedanken sollten wir uns anfreunden. • Ich lasse mich vom Zwang nicht tyrannisieren! Keine Tyrannei beim Türschloss, beim Badewannenputzen, beim Anspruch des Zwangs, schuldfrei sein zu müssen, beim Anspruch, sich genau erinnern zu müssen, was man dem Chef erzählt hat oder was die Nachbarin gehört hat. • In Zeiten von Stress, Müdigkeit, Mutlosigkeit sich einen netten Gedanken schenken: »Bist müde, tust zwängeln, das ist verständlich!« (Siehe Stichwort »Energie«: Aufs Rasten achten!) 60
• Gebetsmühlenartig habe ich in der Therapie oft Hilfsgedanken eingesetzt, habe sie den Zwangsgedanken entgegengesetzt: – »Ich bin nicht meine Zwangsgedanken.« – »Ich kann meine Zwangsgedanken beobachten.« – »Ich stehe außerhalb meiner Angst.« – »Ich stehe außerhalb meiner Panik.« – »Das bin jetzt nicht ich, das ist mein Zwang!« Ich sehe mich dadurch wie ein außenstehender Beobachter, wie jemand, der mich beobachtet und sich denkt: »Da ist also die Arme mit ihren Zwangsgedanken. Zum Glück haben diese Gedanken aber mit ihr nichts zu tun. Diese Gedanken kommen nur von ihrer Zwangserkrankung.« Das hilft, Distanz zu schaffen. Ähnlich spielt sich das ab, wenn ich mit Patienten einen Rollentausch mache. Da muss der Erkrankte mir erklären, was ich im Zwangsfall zu tun oder nicht zu tun habe und weshalb ich mich nicht zu beunruhigen brauche. Dieses Spiel kann unter Umständen recht lebhaft ablaufen, weil ich dann immer noch ein Argument für den Zwang habe, das vom Gegenüber entkräftet werden muss. Was immer Fachleute über die Hilfsgedanken sagen mögen, für mich waren sie unentbehrlich. Jeden Tag habe ich sie gebraucht. Vor, während und nach der Konfrontation habe ich mir mit diesen »Helferleins« (so nannte sie ein Patient, der gut damit umgehen konnte) Mut zugesprochen. Die Hilfsgedanken haben mir Kraft gegeben, mich zu konfrontieren, sie haben mir Kampfgeist vermittelt, auch Versöhnlichkeit gegenüber Menschen, Dingen und Lebenssituationen. Und sie haben mir geholfen, eine gewisse Gelassenheit zu erlernen. Gut gefallen hat mir der Stil einer Konfrontation, den Angelika Lakatos und Hans Reinecker (2000) in ihrem Buch auf Seite 134 schildern. Hier wird eine Patientin einfühlsam und Schritt für Schritt angeleitet, ihre Zwangs61
angst zu überwinden. Dieses Buch empfehle ich gern weiter. Ich erzähle Ihnen jetzt von einem Hausbesuch bei einer jungen Frau in der Kotherapie als das praktische Beispiel einer Konfrontation. Hausbesuche werden gemocht und gefürchtet. Drücken Sie sich nicht davor, wenn Sie im Grunde wissen, dass es Ihnen sehr helfen würde. Gern erinnere ich mich an Patienten, die sehr überrascht und dankbar dafür waren, dass es Helfer gibt, die zu ihnen nach Hause kommen oder dorthin mitgehen, wo sich der Zwang abspielt. Das hatte mir, die ich doch als Kotherapeutin den unangenehmeren Teil der Therapie übernehmen musste, gut getan. Ich erzähle Ihnen deshalb von diesem Hausbesuch, weil sich bei der noch sehr jungen Patientin (sie war um die 20 Jahre alt) sehr vieles auf gedanklicher Ebene abgespielt hatte. Der Zwang hatte ihr viel an Verantwortung für die Lieben daheim aufgeladen. Oft geht es beim Zwang dann eigentlich gar nicht so sehr um das Wohl der anderen; oft sucht der Erkrankte einen Weg für das eigene momentane Wohlgefühl. Bei fast jeder Handlung warnte der Zwang die junge Frau: »Achtung, Achtung, wenn du dies, das oder jenes tust, dann passiert deinen Lieben etwas, dann machst du dich schuldig.« »Ich würde mich so gern wieder nützlich machen«, das wünschte sich die Geplagte vom Hausbesuch. Wir wollten also etwas probieren, das der Patientin ein besonderes Erfolgserlebnis war. Das war für die junge Frau dies: »Ich möchte, Zwang hin und Zwang her, wieder einen Kuchen backen können.« Das nächste Mal wollen wir das angehen, so hatten wir beschlossen. Die »Hausaufgabe« war das Besorgen der Zutaten. Das war eine schwierige Herausforderung für sie, denn der Zwang setzte sich wie ein frecher Patron schon beim Einkauf auf Mehl, Eier, Nüsse … Die Zutaten waren durch Zwangsgedanken »beschmutzt«, kontaminiert: »Wenn du die Nüsse in den Wa62
renkorb gibst, dann passiert etwas Schlimmes, dann verbreiten die Nüsse Unheil«, sagte der Zwang. Eigentlich war es gut, dass die junge Frau mit schon kontaminierten Kuchenzutaten arbeiten musste. Wenn nämlich der Beginn einer Konfrontation schon vom Zwang besetzt ist, dann geht Weiterhandeln bereits leichter. Es hat keinen Sinn mehr, zwangsfrei handeln zu wollen, denn der Zwang ist sowieso schon mit von der Partie. Weiter zum Kuchenbacken-Hausbesuch: »Wenn ich das Mehl in die Schüssel siebe, dann fällt der Vater die Treppe hinunter …« Das klingt ja grauslich! Nur Mut, es ist ja nur eine Übung gegen den Zwang. Hilfsgedanken dazu: »Es ist nichts, was ich zu befürchten habe.« »Ein Gedanke bleibt ein Gedanke, sonst gar nichts.« Hier haben wir aktiv geübt, wir haben freiwillig die gefürchteten Gedanken formuliert und ausgesprochen. Das erfordert einiges an Mut und die in der Therapie neu gewonnene Erkenntnis, dass Gedanken nichts bewirken können. Wir tun also uns und unseren Lieben nichts Schechtes, sondern nur Gutes dabei (auch wenn Außenstehende bei solchen Übungen recht verwundert dreinschauen würden!). Als Modell habe ich bei solchen Übungen immer fleißig mitgetan und auch die, die mir am Herzen liegen, nicht geschont! »Wenn ich die Eier aufschlage, dann wird die Mutter krank.« Keine Sorge, die Mutter wird nicht krank wegen eines ausgesprochenen Gedankens, sondern weil zurzeit die Grippe grassiert. Hilfsgedanke: »Ein Gedanke kann nichts bewirken!« Auf diese Weise war die ganze gedanklich bisher so gehütete Familie drangekommen. Natürlich war das schwer. Der Zwang hatte die junge Frau ständig mit Angst machenden Gedanken attackiert. Sie aber hatte die Anweisung, trotz der störenden Gedanken weiterzuhandeln; die Gedanken sogar freiwillig aussprechen und weiterhandeln. Schade, dass Sie nicht beobachten konnten, wie meine 63
Kotherapie-Patientin den Kuchen trotz der Anstrengung genießen konnte. Ich denke heute noch gern an dieses Bild: Die junge Frau sitzt am Tisch, erschöpft, aber den selbst gebackenen Kuchen und ihren Erfolg genießend – mit einem leisen Lächeln im Gesicht! So kann Therapie ablaufen und so ist sie auch machbar und zumutbar. Nicht schwindeln! »Reihen« heißt zum Beispiel, ich packe an der Kasse ganz schnell alle Lebensmittel ein, erst dann zahle ich. Es hat zwar schon die Kassiererin meine Einkäufe mit Geldhänden angefasst, aber wenigstens ich möchte sie mit noch sauberen Händen einpacken – im Sinn von Schadensbegrenzung. Bei der Konfrontation also nicht reihen! Machen Sie sich nicht allzu viel draus, wenn Sie sich bei den Übungen etwas in die Kindrolle versetzt fühlen. Es liegt im Wesen der Erkrankung, wieder Dinge erlernen zu müssen, die Ihnen früher selbstverständlich waren. Aufgrund Ihrer Erkrankung müssen Sie sich manchmal in einer Weise konfrontieren, in der Sie am liebsten unbeobachtet sind, weil Sie sich dabei komisch und unbeholfen vorkommen. Ich habe Patienten erlebt, die sich bei Konfrontationsübungen sogar vor mir als Kotherapeutin geniert hatten, obwohl sie wussten, dass ich all das schon selbst habe erleben müssen. Denken Sie dran: Sie sind nicht Ihr Zwang. So sollen Sie sich auch nicht weniger wertvoll fühlen, weil Sie in dieser Weise Therapie machen müssen. Denken Sie an das Wechselspiel. Diese Konfrontationen sind sinnvoll, weil Sie Ihnen helfen, ganz neue Erkenntnisse für sich und das Leben zu gewinnen. Ich habe kürzlich das Buch »Ich bezwinge meinen Zwang. Auseinandersetzung mit einem Waschzwang« von einem ehemals Betroffenen gelesen (Gielen et al. 2005). Auf Seite 101 beschreibt Herr Gielen, wie er seine schwierigste Auseinandersetzung mit dem Zwang angegangen und zu Ende geführt hatte. Dieses hohe Maß an Engagement und 64
Ernsthaftigkeit hatte mich wahrhaftig zum Staunen gebracht. Noch ein Tipp: Wenn ich am Morgen aufgestanden war, dann hatte ich mich oft schlecht gefühlt. Ich fühlte mich noch so sauber, so verletzlich gegenüber dem Zwang, ich wusste, dass das nicht so bleiben sollte. Also bin ich schnell in die Kleider geschlüpft und habe auf der Bank die Kontoauszüge geholt. »Was ist da groß dabei?«, so fragt der Ahnungslose. Da sind viele Kontakte dabei, für Hände und Kleidung. Diese Kontakte habe ich dann nach Hause mitgenommen und aktiv geübt, das heißt, ich habe die Kontakte in der Wohnung verteilt. Und weil das meine eigene Entscheidung war, mein freiwilliges Konfrontieren, deshalb habe ich mich erfolgreich gefühlt, und das tut Zwangspatienten ohnedies sehr gut. »Schmutzig« war ich dadurch auch schon, da hatte ich für den restlichen Tag weniger zu behüten. Wollen Sie das auch versuchen? Ob Waschzwang, ob Kontrollzwang, ob Zwang mit Schuldängsten oder Wiederholungszwang. Probieren Sie gleich zu Beginn des neuen Übungstags freiwillig etwas. Mag sein, dass dieser Tag für Sie leichter verläuft, als wenn Sie vom Zwang »überrollt« werden.
Kotherapeut/Kotherapeutin Ein Kotherapeut oder eine Kotherapeutin kann zusätzliche Hilfe bedeuten. In Kliniken für Zwangskranke gehören Kotherapeuten selbstverständlich mit zum Team. In der niedergelassenen Facharztpraxis würden Kotherapeuten für Zwangskranke gut dazu beitragen, Therapiezeit und Kosten zu sparen. Durch den Therapeuten angeleitet und mit Zustimmung des Patienten können auch Familie oder Freunde als Kotherapeuten eine Hilfe sein. 65
Ich habe nach Beendigung meiner Therapie zwölf Jahre lang als Kotherapeutin gearbeitet. Ich habe unheimlich viel erlebt bei dieser Arbeit »vor Ort«, bei der Unterstützung gerade dort, wo sich der Zwang unmittelbar abspielt. Ich habe mitgelitten, weil ich aus Erfahrung wusste, wie schwer vieles fällt. Aber ich habe auch die Gewissheit gehabt, dass es so sein muss, nur so gelingt Therapie. Leicht war diese Arbeit nicht. Aber dass ich mich als ehemals Erkrankte einfühlen konnte, war mein ganz besonderes »Kapital«. Ich empfinde meine Kontakte mit Zwangspatienten heute noch als etwas Besonderes. Es findet eine außergewöhnliche Art des sich Verstehens statt in dieser so merkwürdigen Erkrankung mit oft so skurrilen Erscheinungsformen. Heute betreibe ich noch Kotherapie im kleinen Stil: Gespräche im Kaffeehaus mit Mutmachen und kleinen Übungen, Ratgeben am Telefon, Antworten auf Hilfe suchende Briefe, Kontakte mit Theresa und ihrer Zwänge-Seite, Abhalten von Workshops. Hansruedi Ambühl und Barbara Meier bezeichnen in ihrem sehr guten Buch »Zwang verstehen und behandeln« (2003) Kotherapeuten als »Helfer«. Bitten Sie nötigenfalls Ihren Therapeuten um solch einen Helfer oder eine Helferin, falls er selbst nicht so viel Zeit für praktische Übungen anbieten kann. Kotherapeuten sind eine unverzichtbare Hilfe in natürlichen Situationen. Sie sind kein Ersatz für den Therapeuten, sie sind eine Ergänzung, eine Art verlängerter Arm. Gerade wenn es darum geht, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was »normal« ist, was »gesund« ist, sind Kotherapeuten eine wichtige Hilfe: Sie sind oft näher am Denken und Verhalten von Betroffenen dran, als das bei Professionellen der Fall ist. Als Kotherapeutin konnte ich Patientinnen gut helfen, wenn es um Zwangsstörungen rund um Körperpflege wie Duschen und so weiter ging. Wenn es das sehr menschliche Problem von eigenen Ausscheidungen betraf, also um den 66
Toilettengang, so haben wir uns meist durch die geschlossene WC-Tür verständigt. Da gab es kaum etwas, worüber man nicht reden konnte. Nachdem seinerzeit in meiner Arbeit als Kotherapeutin der Therapeut ein Mann war, hat es den männlichen Patienten oft gut getan, während der Therapie gegebenenfalls auch die Meinung einer Frau zu hören, etwa dass Frauen nicht unbedingt und ausschließlich den erfolgreichen, stets geistreichen, schönen, sportlichen, mit BMW-Autoschlüssel klappernden Muskel-Machotyp ohne Schwächen und Fehlern lieben! Hans S. Reinecker schreibt in seinem Buch »Zwänge« (1994) über Kotherapeuten, dass diese aus praktischen Gründen sehr hilfreich seien. Übrigens schätze ich dieses Buch »Zwänge« für Fachleute, Patienten und Angehörige ganz besonders. Es ist klar und verständlich geschrieben. Es ist sachlich in der Darstellung, und dann spürt der Leser auch wieder die Wärme und das Einfühlungsvermögen, das dem Erkrankten in seinem Leiden entgegengebracht wird.
Liebe Die Menschen, die Dinge, sich selbst lieben! Ängstigendes anlächeln, ob Mensch oder Ding, sich selbst innerlich oder auch im Spiegel zulächeln, das kann gut helfen. Manchmal allerdings wirkt wütend sein dürfen auch befreiend. Der kluge Philosoph Bertrand Russell hat als Motto seines Handelns einmal gemeint, er sei »von Liebe beseelt und von Erkenntnis geleitet«. Das kann man Betroffenen auf dem Weg der Therapie (und darüber hinaus) nur ans Herz legen.
67
Medikamente Das Thema »Medikamente« wollte ich eigentlich den Fachleuten überlassen. Einiges fällt auch mir dazu ein, also will ich dieses Stichwort mit dem Fachmann teilen: Spezielle Medikamente können für Zwangskranke ein wahrer Segen sein. Wenn Ihnen der Therapeut welche empfiehlt, dann sollten Sie nicht sagen: »Das Gift schlucke ich nicht.« Es ist außerdem kein Zeichen von Schwäche, ein Medikament zu nehmen. Medikamente machen nicht dumm und willenlos. Sie rauben nicht den Verstand, sondern sie geben ihm wieder eine Chance. Menschen sind auch biologische Lebewesen, und auch der Zwang hat eine biologische Seite – im Gehirn. Aber eine realistische Einschätzung ist wichtig, denn Medikamente allein können Sie nicht von der Zwangskrankheit befreien. Sie schaffen zumeist eine Erleichterung, speziell in Phasen der Verzweiflung und Depression. Sie können Ihnen damit wieder Mut geben, die anstrengende Therapie anzupacken und durchzustehen. Ohne zusätzliche Verhaltenstherapie wird es Ihnen aber nicht gelingen, den Zwang zu überwinden. Die bei Zwangsstörungen eingesetzten Medikamente stammen fast ausschließlich aus der Gruppe der Antidepressiva; sie helfen, den Stoffwechsel im Gehirn zu verbessern. Medikamente gegen den Zwang machen nicht abhängig. Nebenwirkungen kann es geben, da alle wirkungsvollen Medikamente auch Nebenwirkungen haben. Dabei handelt es sich zumeist um vorübergehende Begleiterscheinungen. Schaffen Sie es, den Beipackzettel nicht zu ernst zu nehmen? Auf dem steht nämlich »alles«! Ohne Medikamente hätte ich nicht gesund werden können. Wenn Sie keine Medikamente brauchen, was durchaus der Fall sein kann, dann sollte diese Erkenntnis vom Therapeuten kommen und nicht von der Freundin oder der Gemüsefrau um die Ecke. 68
Modelllernen Modelllernen heißt andere, vertrauenswürdige Personen nachzuahmen. Es hilft den meisten Zwangskranken sehr in ihrer eigenen Unsicherheit. Das Vorzeigen kann große Erleichterung bedeuten. »Was der sich traut, das kann ich auch!«, zum Beispiel nicht die Hände zu waschen und ein Stück Schokolade in den Mund zu schieben. »Was die wagt, das schaffe ich auch!«, zum Beispiel den Herd mit einem aufmerksamen Blick zu kontrollieren und alles andere – Licht, Wasser, Kaffeemaschine – immer wieder einmal gar nicht nachzuschauen. Einige Patienten berichten aber auch, dass ihnen das Vorzeigen gar nicht hilft, sie sagen dann zu mir als Kotherapeutin: »Dass Sie das können, ist mir klar, aber mein Problem ist gerade, dass ich es nicht kann!« Das sind anfängliche Schwierigkeiten, das gibt sich schon. Auf dem Ihnen schon bekannten Toilettenpapier (siehe beim Stichwort »Feind«) steht auch ein kluger Spruch von Oscar Wilde: »Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung.« Sich nachmachen getrauen, weil Vertrauen zum Therapeuten oder auch zum Kotherapeuten besteht. Durch Nachahmen anerkennen, dass der Therapeut für meine Probleme kompetent ist und es gut mit mir meint. Schon beim Beobachten einer Übungssituation werden im Gehirn Neuronen aktiviert, die es uns erleichtern, diese Handlung nachzuahmen, das hat die Evolution offenbar gut eingerichtet. Wollen wir uns eine Übungssituation vorstellen? Nehmen wir den »roten Fleck« her, der so viele Zwangskranke plagt. Nehmen wir an, Sie sitzen mit der Therapeutin übungshalber im Kaffeehaus. Wie erwartet und befürchtet, ist auch hier das Tischtuch nicht fleckenlos rein. Welche Gedanken könnten Ihnen dabei durch den Kopf gehen? Vielleicht diese: »Ich bin noch recht unsicher. Wir haben zwar in der Therapie schon über das gesprochen, was mich 69
an Flecken so verängstigt. Aber auch die neuen Überlegungen und Erkenntnisse verwirren mich noch. Alles ist so ungewohnt. Ich getraue mich einfach nicht, den (rotbraunen?) Fleck auf der Tischdecke zu berühren. Ich habe das schon seit Monaten oder gar seit Jahren nicht mehr gemacht, war ich doch schon ewig nicht mehr in einem Kaffeehaus! Anschließend Hände waschen sollte ich auch nicht, so war es vor der Übung besprochen worden. Ich komme mir vor wie ein Hasenfuß, was soll ich tun? Auf morgen verschieben? Schnell einmal antupfen? Mit dem Therapeuten verhandeln, dass ich den Fleck berühre, wenn ich anschließend die Hände waschen darf?« Er ist schon mächtig, der Zwang! Sogar zu zweit, zusammen mit dem Therapeuten, innerhalb einer Therapie also, braucht es oft viel Kraft, sich gegen den Zwang zu behaupten. Setzen wir voraus, dass Sie bereits Vertrauen zum Therapeuten gefasst haben. Nehmen wir an, dass Sie ihm zutrauen, Ihnen in Ihrer Krankheit eine gute Hilfe zu sein. Dann könnten Sie den roten Fleck doch auch anfassen, wenn der Therapeut Ihnen das vormacht. Sie könnten ihm genau auf die Finger schauen. Sie könnten sehen, dass er den Fleck ordentlich berührt, nicht so schnell und ängstlich. Sie werden beobachten, dass er anschließend nicht die Hände wäscht und Ihnen dabei erklärt, weshalb das nicht nötig ist. Wenn Sie der Zwang dann immer noch dran hindern will, Gleiches zu tun, dann sagen Sie ihm einfach: »Du hast mich lange genug hineingelegt! Sag, was du willst. Ich habe jetzt einen besseren Berater als bisher!« Und dann machen Sie nach, was Sie gerade gelernt haben! Ich zeige in der Kotherapie Mögliches immer vor und habe selbst durch Modelllernen viel profitiert. Modelllernen in der Therapie muss sich nicht ausschließlich auf den Abbau der Zwänge beschränken. Ein Therapeut als akzeptables Modell in wichtigen Bereichen der Lebensführung und Lebenseinstellung wäre auch eine feine Sache! 70
Motivation Ich habe einmal einen Patienten mitbetreut, der hatte es beim Üben wirklich nicht leicht. Wenn er im Zweifel war, ob er sich einen neuen Schritt zutrauen könnte, dann hat ihn am hilfreichsten das Zaubersätzchen motiviert: »Sie wollen doch gesund werden, das haben Sie sich doch so sehr gewünscht.« Da hat er geseufzt und – es geschafft. Ich würde diejenigen, die meine Zeilen jetzt lesen, am liebsten an die Hand nehmen und ermuntern: Machen Sie diese Therapie, sie funktioniert, auch wenn Sie noch so dran zweifeln. Ist doch das Zweifeln eine Eigenschaft, die »uns Zwänglern« ständig das Denken, Handeln und Entscheiden erschwert: »Soll ich überhaupt zu einem Therapeuten gehen, um mir helfen zu lassen? Kann er mir helfen? Wem soll ich mich anvertrauen? Ist ein Therapeut oder eine Therapeutin für mich besser? Was kann ich mir zumuten? Oder auch: Was wird mir zugemutet? So lange Fahrzeit zum Therapieort, das schaffe ich nicht. Wie weit werde ich es bringen? Wird der Erfolg von Dauer sein? Werde ich mir die Therapie leisten können?« Über so vielen Zweifeln und Überlegungen kann kostbare Zeit verstreichen. Suchen Sie ernsthaft einen Therapeuten oder eine Therapeutin, und dann nehmen Sie diese Therapie auf sich. Viele der genannten Fragen, die Sie sich vor einem Erstgespräch zweifelnd stellen, können Ihnen dann beantwortet werden. Sie werden die Entscheidung, Ihr Leben verändern zu wollen (auch wenn Sie sich dabei dem Zwang stellen müssen), niemals bereuen. Ganz bestimmt nicht! Gehen Sie zum ersten Termin als Ratsuchende hin. Sie werden zu nichts verpflichtet sein, Sie werden nichts tun müssen. Ich bin mir sicher, dass der mangelnde Mut, einen Therapeuten aufzusuchen, oft der hauptsächliche Grund dafür ist, sich allzu lange arm und verlassen zu fühlen. Sie müssen ein Ziel haben, für das Sie kämpfen. Ich 71
selbst hatte zunächst nur das eine Ziel gehabt: Ich muss wieder funktionieren können. So kann das nicht weiter gehen. Ich hätte mich nicht einmal in der Lage gesehen, stationär aufgenommen zu werden. Das war für mich schon in der Vorstellung unausführbar (Koffer packen, die vielen »Schmutzkontakte« …). Aber im Lauf der Therapie habe ich dann gemerkt, dass ich anspruchsvoller wurde in meinen Wünschen und Zielen. Und das ist gut. Das sollen Sie auch sein, um leichter über die Runden zu kommen. Therapeuten helfen bei der Entwicklung von »Träumen für die Zukunft«, die wahr werden können. Es ist zunächst der erste Schritt, wahrscheinlich therapeutengeleitet, auf den Sie sich einlassen müssen, wenn er auch noch ganz klein ist. Ich haben den ersten Schritt empfunden, als ob ein Bann gebrochen würde. Sie werden das schöne Gefühl erleben: »Das könnte doch tatsächlich funktionieren. Ich will versuchen, diesen ersten Schritt durchzuhalten. Ich kann mir helfen lassen, ich bin nicht mehr allein.« Sie werden sich sogar wundern, dass plötzlich funktioniert, was sie allein nie geschafft haben. Bedenken und erfahren Sie: Die Vorstellung, etwas Schwieriges tun zu müssen, lässt die Sache immer bedrohlicher erscheinen, als dann das Tun selbst. Manches Mal kann es auch passieren, dass Sie etwas recht mutig gewagt haben, und im Nachhinein kommen die großen Bedenken. Lassen Sie sich deshalb nicht irreführen. Hier sind Gefühle unterwegs, die vom Zwang kommen. »Es ist nichts, was Sie zu fürchten brauchen – es ist nur Ihre Angst!«
72
Mut »Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht.« Der Ausspruch ist vom römischen Dichter Publius Syrus. »Seien Sie mutig!«, werden wir manchmal aufgefordert, wenn das Konfrontieren so schwer fällt. Denken Sie an Publius Syrus: Wer sich getraut, wird anschließend immer wieder überrascht sein, wozu er imstande ist; wird staunen, dass eine Hand, die nicht mehr ganz so sauber ist, weiter benutzbar ist, auch wenn es noch schwer fällt und vor dem ersten Versuch unmöglich erschien. Ich erzähle Ihnen etwas, das ich im November 2004 erlebt habe: Ich gehe durch unsere Stadt, da fällt mir ein Mann auf. »Unsereins« hat dafür eine besondere Wahrnehmung. Der Mann macht nämlich mit dem Schuh eine Bewegung auf dem Asphalt, als ob er eine Zigarette ausdrückte. Allerdings sehe ich keine Zigarette am Boden. Der Mann geht ein paar Schritte weiter, hält inne, kehrt zurück, schaut konzentriert auf die Straße, geht wieder weiter. Da liegt dann wirklich eine Zigarettenkippe, die hebt der Arme auf, geht zu einem Abfalleimer, wirft sie hinein, geht weiter, kehrt zurück, holt den Zigarettenrest wieder aus dem schmutzigen Straßenabfalleimer und so weiter. Ich habe ihn mit dem großen Mitleid der ehemals Betroffenen beobachtet. Ich konnte nicht anders – ich wollte ihn nicht so weitergehen lassen. »Vielleicht kommt er mir grob, wenn ich ihn anspreche, weil er sich wegen seines Verhaltens schämt. Oder weil er glaubt, da sei jemand einfach neugierig«, so habe ich überlegt. Ich habe es riskiert und ihn angesprochen: »Bitte, darf ich etwas zu Ihnen sagen?« »Ja«, sagte er etwas erstaunt. »Die Straße ist wohl schwierig für Sie? Das, worunter Sie leiden, das habe ich auch einmal gehabt.« Denn ob Zwangsangst vor der Verantwortung für einen vielleicht noch glimmenden Zigarettenstummel oder ob übermäßige Angst vor dem Straßenschmutz, so wie ich sie hatte, da kann ich mich doch einfühlen. Wo liegt da der 73
Unterschied? Es ist die Angst, die uns leiden macht! Der Mann zeigt merkwürdig schnell Vertrauen, er reagiert nicht abweisend. Ich habe zu Recht vermutet, dass er sehr leidet. Wir kommen ins Gespräch, wobei er die Straße, den Boden um sich herum nicht aus den Augen lässt. Der Zwang will eben immer vorn stehen und am wichtigsten sein. Das kennen Sie wohl auch. Dass der Mann durch seine Zwangshandlungen in Abfalleimern verschmutzte Kleidung hat und vor allem schmutzige Hände, das ist mir bewusst. Aber zum Glück läuft heute solches Bewusstsein für mich auf dem Nebengleis; das ist durch die Therapie möglich geworden. Beim Verabschieden schüttelt mir der Herr die Hand, nicht einmal, sondern vor lauter Dankbarkeit immer wieder. Ich habe gewusst, dass ich jetzt auch schmutzige Hände habe, und ich habe auch gewusst, dass jemand, der nie an einem Waschzwang gelitten hat, diese Hände vielleicht bei nächster Gelegenheit gewaschen hätte. Ich wollte das nicht tun. Ich habe – ebenfalls bewusst – vor dem Händeschütteln nicht den Ärmel meiner Jacke hochgeschoben, um die Jacke zu schonen, aus Achtung vor dem Leid des Geplagten und weil ich wusste, dass auch ich in Übung bleiben muss. Ich möchte Ihnen mit dieser kleinen Geschichte nicht dokumentieren, wie »toll« ich bin im Umgang mit dem früheren Zwang. Das nicht. Aber »leichtsinnig« dürfen wir auch nach Entlassung aus der Therapie nicht sein. »Ja, müssen Sie auch heute noch solche Dinge tun? Müssen Sie auch noch an so etwas denken?«, wurde ich gefragt. Sicher denke ich noch dran, ich habe doch ein Gedächtnis. Und weil ich auch ab und zu noch an »Schmutz« von früher denke, weiß ich, was mir gut tut. Dran denken darf man, aber daraufhin etwas tun, was man früher in solchen Situationen immer getan hat, das ist nicht ratsam. Ich habe Ihnen diese Geschichte und mein Verhalten dazu erzählt, um Ihnen (als Modell) zu sagen: Haben Sie keine Angst vor einem Rückfall, aber nehmen Sie das Gesundwerden vom 74
Zwang oder auch die Besserung Ihres Befindens nicht als selbstverständlich und unverrückbar hin. Therapieerfolge sind Geschenke, die sollen wir sorgfältig behandeln.
Nie Niemals aufgeben, auch wenn es Durststrecken gibt, in denen nichts weitergeht. Das ist ganz normal. Gut wäre es, wenn Sie in schwierigen Phasen den bisher erreichten Stand halten können: »Ich lasse mir das schon Erreichte nicht mehr nehmen!« Oder: Es ist keine Schande, hinzufallen, aber es wäre eine Schande, nicht mehr aufzustehen!
Normal Was ist normal? Das Gefühl dafür haben viele Patienten verloren, besonders wenn sie lange Zeit unter ihren Zwängen gelitten haben. Sie müssen erst wieder lernen, was »normales« Händewaschen, Duschen, Kontrollieren von Herd, Stereoanlage oder Autotür bedeuten. Normalität kann man nur ganz langsam wieder lernen, und das Lernen geschieht auf drei Wegen, von denen jeder für sich erfolgreich sein kann: – Lernen durch Übung, – Lernen durch Modelle, – Lernen durch Information. In der Regel sind die drei Wege kombiniert, sie überlappen sich. Kritisch kann es dann werden, wenn Betroffene im 75
Verlauf der Therapie verunsichert sind und den Therapeuten oder mich als Kotherapeutin zum Maßstab für Normalität machen: »Wie viele Handtücher benutzen Sie nach dem Duschen, zwei sind doch in Ordnung, oder?« Hier ist es zwar verführerisch, dem Patienten einen ganz konkreten Hinweis zu geben, und für die allererste Zeit der massiven Unsicherheit darf und soll das auch so sein. Mit der Zeit muss er oder sie aber Eigenständigkeit lernen, so schwer das auch manchmal fallen mag. Seien Sie ermutigt: Der Begriff »normal« verliert mit fortschreitender Therapie an Schärfe und Gewichtigkeit. Das müssen Sie geduldig durchleben. Das scheint nur anfangs so schwer.
OCD OCD steht für Obsessive Compulsive Disorder (englisch für Zwangsstörung). It’s my OCD, that’s not me! Auf gut Deutsch: Ich bin nicht meine Zwangserkrankung! Ich bin nicht mein Zwang! Rabenmütter fürchten keine Messer im Umgang mit ihren Kindern! Die ohnedies nicht an Gott glauben, erschrecken nicht über gotteslästerliche Gedanken! Ein verantwortungsloser Autoraser kehrt nicht auf der Straße um, weil er glaubt, jemanden gestreift zu haben. Der Mörder in der Tiefgarage (siehe Krimi im TV) hat nicht Angst, jemanden unabsichtlich gewürgt zu haben! Sie sind nicht Ihr Zwang! Sie müssen sich nicht dem Zwang gegenüber verteidigen. Sie müssen sich nicht sagen: »Aber ich bin doch eine gute Mutter.« »Aber ich bin doch eine Tochter, die ihre Eltern liebt.« Das sind Beruhigungen, so wie Rituale auch. Zudem haben Sie es nicht nötig, sich auf solche Weise zu rechtfertigen! Es ist die Krankheit, die 76
Ihnen ein schlechtes Gewissen macht. Wenn Sie sich als Ganzes vorstellen, so ist der Zwang nur ein Teil von Ihrem gesunden Ganzen. Die Therapie wird Ihnen helfen, sich selbst wieder zu achten.
Offenheit Offenheit in der Therapie – das ist ein heißes Eisen! Da fürchtet so mancher Zwangskranker in der Therapie, er würde sich ein Eigentor schießen. Weit gefehlt! Offenheit in der Therapie bedeutet, Zwanghaftigkeiten nicht zu verheimlichen, sondern die Karten offen auf den zu Tisch legen. Auch wenn man weiß: Diese Offenheit wird »Konsequenzen« haben. Vielleicht nicht gleich, aber irgendwann ziemlich sicher. Jetzt ist es wieder einmal Zeit für einen klugen Spruch: »Offenheit verdient Anerkennung« (sagt Otto von Bismarck). »Hätte ich doch nicht erzählt, dass ich nie durch die Innenstadt gehe, weil dort so viele Menschen unterwegs sind, an denen ich nicht anstreifen mag.« »Hätte ich doch nicht erzählt, dass es am Abend immer nur kalte Platte gibt, weil ich den Herd nicht mehr benutzen möchte.« Was wird der Therapeut dazu sagen? Sicher dies: »Gut, dass Sie davon gesprochen haben. Irgendwann werden wir den Zwang überrumpeln und erleben, was für nette Geschäfte es in der Innenstadt gibt und dass zum Abendessen zumindest ein heißer Tee passt.«
77
Perfektionismus Zwang und Perfektionismus sind ein ideales Paar, das sich gut versteht. Weniger Perfektionismus hat auch mit Selbstannahme zu tun und in der Folge auch mit Großzügigkeit gegenüber den anderen. Mit wem würden Sie lieber vier Wochen in Urlaub fahren, mit jemand ganz Perfektem oder mit jemandem, der oder die auch mal locker, nicht ganz so streng, heiter und auch fehlerhaft sein darf?
Prinzipiell Sie sollten prinzipiell keine Diskussion mit dem Zwang führen. Seine Behauptungen sind irreal. Er besteht darauf, das letzte Wort zu haben, und Sie können eigentlich nur verlieren. Er ist ein schlechter Berater, der nie gut findet, was man vernünftigerweise tut und denkt. Wenn Sie dem Zwang zugestehen, dass »er doch irgendwie Recht hat«, dann werden Sie Schwierigkeiten haben, ihn wirklich abzuschütteln. Wenn Sie von Gedanken geplagt sind, die so anfangen: »Ich habe Angst, dass …«, »Ich befürchte, dass …«, dann können Sie annehmen, dass der Zwang noch Ihr Diskussionspartner sein möchte. Stopfen Sie ihm den Mund! Es hat deshalb prinzipiell keinen Sinn, über den Inhalt des Zwangs zu diskutieren: Sie werden den Kürzeren ziehen! Oder möchten Sie beweisen, dass es nicht sinnvoll sein kann, den Herd viermal oder vier mal vier oder vier mal vier mal vier zu kontrollieren? Oder dass man von einem Mückenstich keinesfalls Aids bekommen kann? Einzig sinnvoll ist die Auseinandersetzung mir Ihrer Angst (s. dazu oben).
78
Q Der Zwang redet reinen Quatsch!
Reaktionsverhinderung Die Reaktionsverhinderung wird zumeist als zweiter Bestandteil der Konfrontation bei Zwängen bezeichnet. Konkret heißt das Folgendes: Der Patient sollte sich mit denjenigen Dingen, Gedanken oder Handlungen konfrontieren, die seine Angst und Unruhe auslösen. Üblicherweise wird er oder sie umgehend auf Vermeidungsstrategien zurückgreifen – diese aber sind ein Teil des Zwangs! Und genau diese gilt es zu verhindern. Prof. Iver Hand (Hamburg) verwendet hier lieber den Begriff Reaktionsmanagement: Er will damit verdeutlichen, dass es nicht so sehr um die Verhinderung irgendeines Verhaltens, sondern um ein gezieltes Management von Handlungen angesichts einer schwierigen Situation gehen sollte. Genau hier kommen auch die angesprochenen Alternativen ins Spiel: Es kann bei Ihrer Therapie keinesfalls nur darum gehen, dass Sie lernen, bestimmte Handlungen nicht mehr auszuführen, sondern Sie sollten auch konkrete, gesunde Verhaltensmuster einüben. Genau dabei werden Ihnen ein Therapeut und eine Kotherapeutin beiseite stehen, und zwar auch in der natürlichen Situation bei Ihnen zu Hause. Sie werden Sie keinesfalls zwingen, Ihre Zwänge nicht auszuführen, sie werden Sie allerdings ermutigen, darauf zu verzichten, weil es gute, gesunde Alternativen gibt.
79
Ressourcenaktivierung »Was soll denn das bedeuten?«, werden Sie vielleicht fragen. Dieses lange Wort soll Sie ermuntern, darüber nachzudenken, was Ihnen an Möglichkeiten zur Verfügung steht, an Fähigkeiten, Begabungen, Vorlieben, Charakter, Familie, Partner, Freunden, Mitmenschen, alles, was Ihnen in der Therapie mithelfen könnte. Ich war in der Therapie eine Zeit lang sehr depressiv. Nichts wollte mich freuen, zu nichts hatte ich Antrieb, trotz der Erfolge in der Therapie. Da sitze ich eines Tages am Tisch, eine kleine Blume in einer Vase vor mir. Weshalb ich den Versuch gemacht habe, die Blume zu zeichnen, weiß ich heute gar nicht mehr. Als Kind hatte ich recht gern gezeichnet, später jedoch kaum mehr. Also strichele ich herum, zunächst noch recht lustlos, doch verspüre ich mit der Zeit etwas Erstaunliches, ein sich Lösen des depressiven Schmerzes auf meiner Brust. Ich habe diese Entdeckung der Erleichterung weitergeführt, die Therapie hat mir den Umgang mit Papier, Bleistift, Spitzer, mit Gegenständen »von draußen« immer besser möglich gemacht wie auch die Außenaktivität, nämlich einen Zeichenkurs. Ich habe immer gern gelesen; das war ja etwas, das ich gut im geschützten Zuhause tun konnte. Doch es waren immer mehr die vertrauten Bücher aus dem eigenen Bücherschrank, die mir zur Verfügung standen, oder jene aus der Buchhandlung, die in Folie verpackt verkauft wurden. Denn die erschienen mir, daheim dann »sachgemäß« ausgepackt, sauber. Aber in der Therapie war es schon ein Erlebnis (mit Kraftanstrengung!), ein unverpacktes Buch zu kaufen, ohne Handschuhe, ohne Feuchtigkeitstüchlein für meine Hände. Frisch vom Ladentisch gekauft und dann am Abend mit ins Bett nehmen und lesen. Wieder etwas geschafft! Ähnlich war es mit der Lust am Schreiben. Ich wusste nur, dass ich keine Schwierigkeiten beim Deutschaufsatz in 80
der Schule hatte. Hatte ich den Aufsatz für die Deutschstunde nicht gemacht, so konnte ich das in kürzester Zeit noch schnell vor Unterrichtsbeginn in der Schule nachholen. Wissen Sie, wo ich immer wieder einmal schnell und heimlich solche Aufgaben in der Schule erledigt habe? Der WC-Deckel in der Schülertoilette war mein Schreibpult, da konnte mich keine Lehreraufsicht erwischen. Warum nur konnte ich diesen so lockeren Umgang mit Klodeckeln nicht weiterführen? Weshalb sind sie mir später »unberührbar« geworden? Schwamm drüber! Heute habe ich keinen so unbekümmerten Umgang mit WC-Deckeln auf öffentlichen Toiletten mehr wie damals in der Schule, aber das muss auch nicht sein. Sie sind immerhin wieder berührbar geworden, ich darf sie ohne Konsequenzen anstreifen, kurz: Ich kann wieder hinaus, weg von dem während der Krankheit einzigen akzeptablen WC daheim. So war das also mit dem Schreiben in der Schule. Später gab es nichts Besonderes mehr zu schreiben für mich – bis zur Therapie. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir Schreiben hilft, sowohl in der Depression als auch beim Üben in der Therapie. Ich war eine Zeit lang richtig schreibbedürftig. Mir hatte das Niederschreiben so geholfen. Ich konnte auf diese Weise etwas Ordnung in meinem Kopf herstellen. Erlebnisse, Unsicherheiten, Erfolge, Misserfolge, Therapiefragen, Therapieantworten, alles war in einem Therapietagebuch gesammelt. Zunächst war es für mich und als Hilfestellung in der Therapie gedacht, später dann konnte ich es zum Wiedererinnern und zum Weitergeben für Betroffene nutzen. Ich besitze es nicht mehr. Ich wollte nicht aufbewahren, was eine mir in vielen Abschnitten des Tagebuchs später recht fremd Gewordene einmal geschrieben hatte. Sie glauben, Sie können nichts, Sie vermögen nichts? Seien Sie nicht zu anspruchsvoll, wenn es um »das Können« geht. Von mir hängen nur wenige Zeichnungen an den eigenen vier Wänden. Jede Menge werfe ich wieder 81
weg, andere liegen in der Bettzeuglade. Wenn mir das Zwergkaninchen entwischt, dann hat es nur das eine Bestreben: hinein ins verbotene Zimmer, schnell wie der Wind, und dort in die Bettzeuglade. So viel herrliches Papier! Viele meiner Zeichnungen haben einen künstlerisch beachtenswert gezackten Rand. Das Kaninchen hat seine Zähnchen erprobt. Mich kränkt das nicht weiter. Die Freude während des Tuns und den Spaß am Zeichnen und Malen mit anderen habe ich immer wieder, und das ist mir wichtig. Außerdem weiß ich, dass es nicht meine Schuld ist, viel Zeit während der 27 Jahre durch den »Dienst am Zwang« vertan zu haben, anstatt gescheitere Aktivitäten zu pflegen. Die Freude an dem, was ich heute vermag, beim Zeichnen und anderem, die kann mir keiner nehmen. Schon gar nicht das kleine freche Kaninchen, das ich mir auch erst gönnen konnte, als ich wieder gesund war! Denn ich weiß, dass auch das Kaninchen »Schmutz« vertragen kann, wenn ich es mit Stadthänden streichle. Auch dieses kleine Tier ist eines, das mir hilft, »am Ball« zu bleiben. Zum besseren Verständnis: Zwergkaninchen dürfen weder gewaschen noch gebadet werden! Sie verabscheuen es nämlich, nass zu werden. Ich kenne einen jungen Mann aus der Kotherapie, der seine Katze heute noch mehr schätzt als früher, weil sie ihm in schwierigen Zeiten der Therapie Trost und Hilfe war. Und eine tierliebende Patientin wusste, dass ihr der Hund aus dem Tierheim, den sie sich schon so lange gewünscht hatte, viel Freude und zudem noch Abbau von »Giftangst« bringen würde. Eine ehemals Betroffene hat ihre Freude am Bauchtanz entdeckt, ein anderer lernt reiten, die Digitalfotografie boomt geradezu bei von mir Betreuten, die Südtirolerin lernt Salsatanzen. Nun, glauben Sie nicht auch, dass Sie Ressourcen haben, dass Sie Möglichkeiten nutzen können, die Ihnen in der Therapie und in der Zeit danach helfen könnten?
82
Lassen Sie sich von niemandem die Freude an den »kleinen Dingen des Lebens« nehmen!
Risiko Risikofreudig sein! Der Zwang macht starr und leblos. Lieber riskieren, »verarmt und abgebrannt«, nicht von allen akzeptiert, auch einmal etwas schmuddelig oder ungenau, nicht ganz abgesichert, mit erheblichen Flecken auf der ursprünglich vermeintlich »weißen Weste« zu sein – statt zwanghaft! Kleine Risiken einzugehen, auch abseits und neben dem Zwang, das kann Ihnen helfen, einen Teil Ihres Freiraums zurückzugewinnen, den Ihnen die Krankheit genommen hat. Das können auch ganz alltägliche Dinge sein. Ein Patient berichtete von der Anstrengung, die es ihn zunächst gekostet hatte, seine Stereoanlage den Tag über angeschaltet zu haben, das Licht im Keller während der Nacht brennen zu lassen. Und ich erinnere mich an seine Erleichterung und an sein Schmunzeln nachher, sich über solche Kleinigkeiten viele Gedanken gemacht zu haben. Er fand es jetzt geradezu befremdend, dass er sich von diesen Gewohnheiten jahrelang einengen hatte lassen.
Rückfall Das Stichwort »Rückfall« könnte unangenehme Gefühle auslösen. Ich würde Sie ja gern so beruhigen: »Lassen Sie sich keine Angst einjagen, beunruhigen Sie sich nicht, ein Rückfall, das wird Ihnen bestimmt nicht passieren.« Dann 83
wäre ich aber keine gute Ratgeberin. Ich habe selbst einmal in einer allzu großen Stresssituation Angst vor einem Rückfall gehabt. Ich habe gegenüber dem Zwang eine leise, aber nicht übersehbare Schwäche gefühlt, die mir signalisiert hat: Auch dich könnte es wieder erwischen. Aber da habe ich auf die Person, die mich in solch einen Zustand manövriert hatte, so einen Zorn bekommen, dass ich mir auf diese Weise geholfen habe: »Wegen dieser Person werde ich ganz bestimmt nicht wieder zwanghaft, mir reicht der Kummer, den ich erleiden muss. Da hat der Zwang nicht auch noch Platz.« Das waren die Gedanken. Dann bin ich üben gegangen, wenn auch nicht so intensiv wie in Therapiezeiten, aber in ähnlicher Weise. Zunächst war mir mein Handeln noch bewusster und nicht so selbstverständlich wie an »normalen« Tagen, wohl auch wegen der Trauer, die ich wegen des drohenden Rückfalls verspürte. Der Spuk war schnell vorbei, aber ich habe »am eigenen Leib« erlebt, dass ich immer ein wenig auf der Hut bleiben muss. »Sinnvoll ist die Vermittlung konkreter und im täglichen Leben einsetzbarer Strategien der Bewältigung von Stress und Belastungen« (Reinecker 1994). Meine Strategie war in diesem Fall der Zorn und die Selbstachtung. Beobachten sie immer wieder einmal unängstlich, ob sich nicht wieder »Nachlässigkeiten« einnisten möchten. Beobachten Sie auch, ob sich ein Vermeiden einschleichen möchte. Und wenn es Ihnen doch einmal passiert, dass Sie rückfällig werden, dann sagen Sie nicht: »Jetzt fängt alles wieder von vorn an!« Lassen Sie sich nicht entmutigen – Sie haben schon viel gelernt, das geht Ihnen nicht verloren. Auffrischende Therapiestunden sind nichts, wofür man sich schämen soll. Das kann durchaus vernünftig sein und gibt neuen Mut und wieder mehr Sicherheit. Auch Selbsthilfebücher und Kontakte in Selbsthilfegruppen können dazu beitragen, das Erlernte aufzufrischen und »dranzubleiben«. Ich selbst habe immer noch gern Kontakte mit Nochoder ehemals Betroffenen. 84
Hansruedi Ambühl und Barbara Meier (2003) schreiben: »Der Therapieabschluß steht weniger unter dem Motto ›Ende gut, alles gut!‹ als unter dem Motto ›Dranbleiben und nicht locker lassen!‹«
Schamgefühle Es ist ein zusätzliches Leiden der Zwangskranken, dass sie oft so große Schwierigkeiten haben, sich jemandem anzuvertrauen. Selbst Eltern und gute Freunde werden für gewöhnlich lange Zeit nicht als Helfer in der Not herangezogen: Man schämt sich einfach. »Der Zwang verlangt so Ungewöhnliches, das kann doch keiner verstehen«, so denken viele. »Helfen kann mir auch niemand, wozu soll ich mich also zusätzlich zum Leiden auch noch der Lächerlichkeit preisgeben und dem völligen Unverständnis anderer aussetzen.« Hätte ich meinen engsten Verwandten (Vater, Mutter, Bruder, Schwester) erzählt, dass ich mich beim Einkaufen von Lebensmitteln für die Familie so unendlich schwer tue, weil alles so verschmutzt in die Wohnung kommt, dass ich die Waren, meine Kleidung und mich selbst nach dem Einkauf reinigen muss, hätten sie mich angesehen, als ob ich von einem anderen Planeten käme: »Wo bleibt denn bei der der gesunde Menschenverstand?« Gerade der hat bei Zwangskranken so wenig Chance. Das wiederum ist die Ursache für die ausgeprägten Schamgefühle. »Jedes Kind kann besser eine Tür abschließen als ich.« »So dumm kann kein anderer sein, dass er nicht den Unterschied kennt zwischen Gift sehen und Gift trinken.« Solche Selbstvorwürfe machen sich die Zwangskranken. So wollte auch ich nichts von meiner inneren Qual erzählen. Nur mein Mann hatte davon gewusst. Andere ha85
ben mein komisches Verhalten ganz sicher auch beobachtet. Ich habe es unterschwellig zu spüren bekommen, dass die anderen mich für merkwürdig, arbeitsscheu, wenig initiativ, kontaktscheu halten. Dabei hätte ich immer gern Umgang mit Menschen gehabt, hatte auch vor der Erkrankung keinerlei derartige Schwierigkeiten. Nun gibt es bei der »Merkwürdigkeit« des Zwangs graduelle Unterschiede. Ich war einmal bei einem Workshop. Die Betroffenen waren froh, auch einmal im kleinen Kreis über ihre Krankheit reden zu können, und fühlten sich erleichtert, dass sie nicht allein auf der Welt sind mit ihrer Erkrankung. Aber da gab es auch einige, die ganz still blieben. Sie waren nur Zuhörer. Ich habe ihnen angesehen, dass sie etwas enttäuscht waren. Sie haben sich nicht an den Gesprächen beteiligt. Sie konnten sich nicht mit den anderen austauschen, dadurch Erleichterung finden und für sich profitieren. Für sie war es, als ob wir am Thema vorbeiredeten. Waschen, Kontrollieren, Ordnen, Sammeln – nein, all das waren nicht ihre Probleme. Sie haben sich, trotz der Offenheit der Übrigen, die über ihre Zwänge sprechen konnten, geschämt. Wir haben dann diese Schweigsamen direkt angesprochen: »Könnte es sein, dass hier gar nicht über die Symptome gesprochen wird, unter denen Sie leiden? Haben Sie das Gefühl, Ihre Zwänge seien noch viel merkwürdiger und schwieriger zu schildern als die der Übrigen?« So war es auch. Wir konnten Ihnen die Scheu nehmen. Daraufhin haben auch diese den Mut gefunden, zu erzählen: »Ich getraue mich nicht, von einem Raum in den anderen zu gehen. Weil ich fürchte, dass dann meine Mutter sterben wird.« »Ich muss mit dem Kopf verneinende Bewegungen machen, damit der Teufel weiß, dass ich nicht meine Seele verkaufe.« »Ich getraue mich nicht, auf der Straße den Menschen ins Gesicht zu schauen. Ich fürchte nämlich, ein Passant könnte meiner Freundin ähnlich sehen. Wenn dies der Fall wäre, dann müsste ich gleich einen ›guten‹ Ge86
danken haben zu meiner Zwangsbefürchtung, dass die Freundin mich nicht mehr mag.« »Ich muss in Gedanken den Weg zurückverfolgen, den die zehn Euro aus meiner Geldtasche genommen haben, damit ich weiß, dass ich niemandem etwas schulde.« »Ich darf auf der Straße auf keine Zigarettenkippe treten«, klagte ein junger Mann, noch keine 20 Jahre alt. »Jemand, der erst fünfzig Jahre alt ist, könnte die Zigarette geraucht haben. Wenn ich durch Darauftreten Kontakt mit dem Zigarettenstummel habe, dann werde ich nicht älter als fünfzig Jahre. Das ist mir zu wenig. Auch hundert Jahre sind mir zu wenig.« »Aber dreihundert Jahre, das wäre schon recht ungewöhnlich«, frage ich vorsichtig. Der junge Mann schaut mich vorwurfsvoll an. Ob ich ihm kein langes Leben wünsche, fragt er mich. Ja, auch das sind Zwänge, die sehr leiden lassen, wie zwanghaftes Waschen und zwanghaftes Kontrollieren auch. Eine Zwangserkrankung ist nichts, wovor Sie sich schämen müssen. Auch wenn Ihre Zwangsvorstellungen noch so ungewöhnlich sind. Ich würde mir nur gut überlegen, wem ich davon erzählte. Sie müssten einigermaßen sicher sein, dass Sie Ihr Bekenntnis nicht zu bereuen hätten. Wenn Sie das Pech haben, dass ein Therapeut große erstaunte Augen macht, wenn Sie von sich erzählen, dann sollten Sie einen anderen suchen. Erfahrenen Verhaltenstherapeuten können Sie alles erzählen, Schamgefühle sind da fehl am Platz. Je besser der Therapeut über Sie und Ihre Zwänge Bescheid weiß, umso effektiver wird er Ihnen helfen können.
87
Selbsthilfe »Nur du allein kannst es schaffen, aber du schaffst es nicht allein!« Dieser Spruch wird häufig als Motto für Selbsthilfegruppen ganz unterschiedlicher Bereiche verwendet. In Deutschland ist mittlerweile ein ganzes Netzwerk von Gruppen für Patienten mit Zwangsstörungen entstanden. Auf der einen Seite sind das ganz wichtige Einrichtungen, insbesondere wenn es um den Austausch, um gegenseitige Unterstützung, um die Vermittlung von Information (zum Beispiel über Therapiemöglichkeiten) und um die Motivierung für eine Therapie geht. Auf der anderen Seite sollte man sich von Selbsthilfegruppen nicht erwarten, dass sie einen Ersatz für Therapie darstellen. Das ist bei vielen psychischen Störungen ganz anders: Patienten, die unter Alkoholproblemen, Essstörungen, Angststörungen leiden, profitieren in der Regel gut von der Teilnahme an Selbsthilfegruppen. Viele Patienten haben auch Angst davor, in eine Gruppe zu gehen. Dabei spielt Scham wegen der eigenen Problematik ebenso eine Rolle wie die häufig genannte Befürchtung, in der Gruppe zusätzlich »angesteckt« zu werden. Eine Betroffene meinte einmal, dass sie mit Gedanken konfrontiert wurde, die ihr selbst niemals gekommen seien und die sie nun nicht mehr los werde. Also: Fachliche therapeutische Hilfe ist bei Zwängen unverzichtbar, Selbsthilfe hat aber eine wichtige Funktion zur Unterstützung der Betroffenen.
88
Show Dem Zwang die Show stehlen. Das ist nicht »auf meinem Mist gewachsen«. Das ist einem Patienten eingefallen. Ich bringe am besten gleich ein Beispiel, wobei ich Ihnen sagen möchte, dass diese Taktik gegen den Zwang nicht leicht ist und eher für Fortgeschrittene geeignet, die schon gut annehmen können, dass ein Gedanke mit einer Handlung rein gar nichts zu tun hat. Sie dürfen »das Blaue vom Himmel herunter denken« – es passiert nichts. Ganz konkret: Eine Patientin will zum Beispiel bei ihrem an Grippe Erkrankten Kind Fieber messen. Sie macht sich gerade dran, das Fieberthermometer zu suchen, und schon ist der Zwang mit dabei: »Aha, du willst bei deinem Kind Fieber messen. Du willst also, dass dein Kind Fieber hat!« Unerhört, nicht wahr! Da sorgt man sich um das Kind und was hat man davon? Eine gemeine Unterstellung durch den Zwang. (Ich habe das tatsächlich bei einer Betroffenen in der Kotherapie erlebt.) Was kann helfen? Nicht erschrecken! Weiter das Thermometer suchen und getrost Fiebermessen. Sich nicht beruhigen mit: »Aber ich bin doch eine gute Mutter.« Sie müssen sich nicht rechtfertigen, weil sie einen unsinnigen Gedanken haben. Sie können mit »Blödsinn!« oder »Quatsch!« antworten. Das ist schnell gesagt und schnelles Reagieren ist wichtig, denn der Zwang soll keine Gelegenheit haben, sich einzunisten. Aber wenn Sie noch toller sein wollen, dann »stehlen Sie dem Zwang die Show«: »Aber natürlich will ich, dass mein Kind Fieber hat. Ist doch klar, du blöder Zwang!« Was kann der Zwang dann noch sagen – Sie haben ihn mundtot gemacht. Liebe Betroffene, ich weiß, manche mögen das Wort »tot« nicht. Auch das Wort » Ende« ist nicht beliebt und die Farbe Schwarz auch nicht. Lassen Sie sich nicht irre machen. Das sind nur Wörter, die nichts bewirken können. Sie 89
dürfen Sie aussprechen – je öfter, desto besser –, wenn der Zwang Ihnen das verbieten will. Sie dürfen ein Bild ganz in Schwarz malen. Sie dürfen eine schwarze Fahne sehen, das hat keine Folgen. Es passiert gar nichts. Es ist nichts, was Sie zu befürchten haben. Das Gefühl der Angst und Unruhe bedeutet nicht, dass etwas passieren wird, wofür Sie sich schuldig oder verantwortlich fühlen müssen. Das Gefühl bedeutet nur, dass der Zwang noch unterwegs ist und Sie verunsichern will. Stehlen Sie dem Zwang die Show und getrauen Sie sich zu sagen: Schwarz ist eine Farbe so wie Gelb und Grün auch. Und tot ist ein Wort mit drei Buchstaben, sonst gar nichts. Was der Zwang draus macht, das ist seine Sache. Ich bin nicht mein Zwang und ich denke nicht wie mein Zwang.
Sicherheit Es gibt keine absolute Sicherheit. Die Ereignisse der Weltgeschichte führen uns das in den vergangenen Jahren deutlich vor Augen. Es gibt auch keine absolute Sicherheit vor »Schmutz«; keine absolute Sicherheit, nicht doch einmal beim »Wohnungscheck« das offene Fenster übersehen zu haben. Keine absolute Sicherheit, immer zu wissen, was man gerade gesagt oder gehört oder getan hat. Keine absolute Sicherheit, dass Gedanken immer »richtig« sind. Es gibt keine absolute Sicherheit, vom Chef nicht kritisiert zu werden oder von Mitarbeitern gemocht zu werden. Loslassen können von absoluten Ansprüchen – wenn Sie das einüben wollen, sind Sie gut beraten. Glauben Sie mir, noch heute helfe ich mir ab und zu mit diesem »ein bissel darf sein«. Auf »Schwitzerdütsch«: »Äs bätzli darf si.« »Ein wenig darf sein!«, so verstehen es unsere nördlichen Nachbarn besser. Ein wenig 90
an mangelnder Sauberkeit. Ein wenig an Möglichkeit, krank zu werden. Ein wenig an Gefahr, Schuld auf sich zu laden. Ein wenig an Unsicherheit, wie etwas wohl enden wird. Ein wenig an Bereitschaft, auf andere angewiesen zu sein. Sogar ein wenig an Restzwängen darf sein, jedenfalls besser als das ewige Zweifeln an der eigenen Fähigkeit, mit dem Zwang »hundertprozentig« fertig zu werden.
Stress Zwanghaftigkeit und Stress, die beiden tun sich gern zusammen. Stress ist wie Nahrung für den Zwang: Wir wissen zwar nicht genau, was da im Patienten vor sich geht, aber erhöhter Stress – ganz unterschiedlicher Art – führt dazu, die Rituale verstärkt auszuführen. Stress ganz auszuschließen – wem gelingt das schon? Wenn ich während der Therapie bemerkt habe: Achtung, jetzt wird es stressig, jetzt könnte ich hineinschlittern, dann habe ich möglichst versucht, kurz innezuhalten (stehen bleiben, hinsetzen oder eine Handlung unterbrechen) durchzuatmen und einen Hilfsgedanken herzunehmen – einen Gedanken, der zur Situation passt; einen Gedanken, der mich ans Wesentliche denken lässt; einen Lieblingshilfsgedanken, den ich schnell zur Hand habe. Auf diese Weise ist es mir immer wieder gelungen, durch das Innehalten und Rastendürfen zwanghafte Handlungen zu stoppen oder gar nicht aufkommen zu lassen. Und auch gedanklich konnte ich »umleiten«. Vielleicht hilft Ihnen meine Erfahrung. Auch zum Vorbeugen von Rückfällen ist es wichtig, dass Sie lernen, mit Stresssituationen umzugehen; aber auch das ist nicht einfach. Eine Patientin, die ich lange Zeit als Kotherapeutin begleitet habe und die von ihrem Zwang ge91
heilt war, rief mich nach Jahren wieder an: »Ulrike, meine Zwänge haben wieder begonnen, ich wasche, ich putze, ich kontrolliere, ich muss meinen Beruf aufgeben, wenn das so weitergeht!« Auf eine kurze Nachfrage hin teilte sie mir mit, dass bei ihrem Mann vor wenigen Wochen eine schwere, unheilbare Krankheit diagnostiziert worden war. Die Krankheit des Mannes hat mit dem Zwang der Patientin im Prinzip nichts zu tun. Aber sie bedeutet Stress, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, und so greift die Frau auf »Lösungsstrategien« zurück, die zwar pathologisch sind, die ihr aber kurzfristig helfen, mit ihrer Angst, Unruhe und Verzweiflung zurande zu kommen. Hier mein Rat: Um einen Termin beim Therapeuten bitten. Patienten kann ich nur dann mitunterstützen, wenn sie in therapeutischer Behandlung sind.
Therapeutinnen und Therapeuten Therapeuten sind auch nur Menschen, deshalb können sie nicht perfekt sein – warum auch?! Therapeuten sind Fachleute, ausgebildete Personen, die viel über Denken, Verhalten, Gefühle, Gehirn und so weiter gelernt haben, wovon Sie als Betroffene profitieren können. Therapeuten helfen Ihnen dort weiter, wo Sie selbst nicht mehr zurechtkommen. Vielleicht meinen Sie, dass das alles, diese vielen Rituale und Verrücktheiten, ein Therapeut gar nicht verstehen kann! Allerdings steckt Ihr Therapeut nicht in der Problematik, unter der Sie leiden, und das ist wichtig, weil er Ihnen eine andere, eine fachlich-wissenschaftliche Perspektive und Hilfestellung bieten kann. Noch einmal: Nutzen Sie die Chance, wenn Sie an einen kompetenten Therapeuten gekommen sind, er wird Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen helfen. 92
Übungen Seien Sie fleißig beim Üben. Wenn Sie eine Übung zum ersten Mal gemacht haben, dann sagen Sie nicht: »Gott sei Dank, das habe ich hinter mich gebracht (mit Hilfe und im Beisein des Therapeuten), ein zweites Mal möchte ich das nicht erleben!« Eine neue Übung sollten Sie gleich wiederholen. Kennen Sie das Sprichwort: Einmal ist keinmal. Das hat Gültigkeit beim Üben, wenn der neue Schritt Gewohnheit werden soll. »Überüben«, meint Psychologie-Professor Hans Reinecker, also sehr fleißiges Üben, kann vor Rückfällen bewahren. Dadurch werden die neu gelernten Verbindungen in Ihrem Gehirn besonders gefestigt, das gibt Ihnen zunehmend Vertrauen in das neue Verhalten. Ich selbst habe eine Zeit lang starke Angst vor einem ernsten Rückfall gehabt, auch vor dem Verlustigwerden von bereits erreichten Erfolgen. Deshalb habe ich wirklich übergeübt. Das sollten Sie, wenn Sie Therapie ernst nehmen. Sie können Ihre Therapeutin bitten, Sie mit Übungen nicht zu überraschen. Dann können Sie sich seelisch drauf vorbereiten. Ob das immer gut ist? Ich denke, auch hier gilt, wie auch sonst beim Üben: Es darf auch mal anders ablaufen. Die Erwartungsanspannung ist zumeist größer als das, was dann passiert. Soll ich Ihnen ein winziges Detail aus meinem seinerzeitigen Übungsrepertoire erzählen? Mit entsprechendem Ratgeben dazu? Dass ich mich an diese Gegebenheit wieder erinnert habe, ist in der ersten Therapiezeit passiert. Ich übe also in meinem damals so viel geliebten Bahnhof, fasse an, was dem Therapeuten so alles einfällt, zunächst halt nur gottergeben und weil es sein muss. Später dann einsichtsvoller, weil ich merke, dass so etwas gesund macht. Kennen Sie die Blazer, die, neu gekauft, oft noch zugenähte Taschen haben? Als Steigerungsstufe der Übung sollen die schmutzigen Hände in die Blazertaschen langen. Nein, nicht um sich erleichtern zu können durch Abputzen 93
am Taschentuch, sondern um den letzten Hort an Sauberkeit, die Blazertaschen, auch noch »zu beschmutzen«. (Erschrecken Sie nicht, diese Mengen sind so gering, das sieht man diesen Taschen gar nicht an, und darauf kommt es doch an.) Beim besten Willen, ich kann diese Übung nicht machen, ich komme in meine Taschen nicht hinein – sie sind noch zugenäht! Ich habe doch vor der Therapie nicht einmal im Traum daran gedacht, diese Taschen zu benützen! Es hilft nicht, beim nächsten Übungsgang bin ich dran! Ich habe dabei ein unbeschreiblich verwirrtes Gefühl gehabt. Die abhanden gekommene Gewohnheit und die weitere »Beschmutzung«, verbunden mit Anspannung, auch Angst, haben meine Verwirrung ausgemacht. Was in den nächsten Tagen und Wochen folgte, war: üben, wiederholen, Schmutz einsammeln, in die Tasche stecken, bis aus der Verwirrung Gewöhnung und aus der Gewöhnung Selbstverständlichkeit wird. Das geschieht beim Üben.
Ungewissheit Ungewissheit aushalten ist gleichzusetzen mit dem Verzichten auf Zwangsbefriedigen. Also ist das etwas, das unsereins in Zwangsangelegenheiten oft enorm schwerfällt. Ein ausgeprägter Zweifler würde am liebsten Medizin studieren, um die ihm vom Therapeuten verschriebenen Medikamente mit Gewissheit bezüglich Unbedenklichkeit und Wirksamkeit schlucken zu können. Muss er das wissen? Nein. Es genügt doch, wenn der Artzt, dem er vertrauen sollte, das Studium absolviert hat. Analysiertes, Schriftliches, von der Wissenschaft hundertprozentig Bewiesenes, statistisch Nachweisbares, Computerausgedrucktes, verbal endlos Wiederholtes – das sind 94
die Wünsche vieler Betroffener. Sogar das kleine rote Lämpchen, das aufleuchtet, wenn nicht sichtbarer, aber vermuteter Schmutz oder Keime gefürchtet werden – nicht nur ich habe mir so ein traumhaftes »Hilfsmittel« gewünscht, um Gewissheit zu erlangen und mich nicht zwanghaft ängstigen zu müssen. Auch hier gilt das Auseinanderhalten von im Grunde harmlosem Ungewissen. Hilfsgedanken: – »Wer will das wissen? Sie oder Ihr Zwang?« – »Muss ich es wissen? Nein!« – »Es ist nichts, was ich zu fürchten brauche!«
Verantwortung Verantwortung auch abzugeben oder teilen zu lernen – wie wichtig ist das! Wie wäre es, zur Abwechslung einmal darüber nachzudenken, dass Sie in Ihrem Leben sicher auch für so manches Positive und Erfreuliche verantwortlich waren! Diesen Denkanstoß habe ich dem Buch von Ambühl und Meier (2003) entnommen.
Vergleichen Vergleichen Sie sich nicht immer mit anderen. Vor allem nicht mit solchen, die nicht zwangskrank sind und mit so einer Last nicht fertig werden müssen. Auch nicht mit solchen, die andere Begabungen haben als Sie. Vielleicht hilft Ihnen ein spezieller Ratgeber, der Ihnen einen liebenswerteren und großzügigeren Umgang mit sich selbst zeigt.
95
Verhaltenstherapie Eine (kognitive) Verhaltenstherapie aufzusuchen, das ist ein mutiger Schritt. Manchmal hat man selbst das Empfinden: Wenn ich mir jetzt nicht bald Hilfe hole, dann weiß ich nicht, wie lange ich noch funktionieren kann. Manchmal sind es die Familie oder das nahe Umfeld, die zu einer Therapie drängen. Viele Angehörige fragen, wie kann ich meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder und so weiter dazu bewegen, eine Verhaltenstherapie aufzusuchen? Aus meiner Sicht als ehemalige Betroffene ist es besonders wichtig, ganz präzise und realistische Information darüber zu bekommen, was Verhaltenstherapie bedeutet. Beispiele ehemaliger Patienten, aber auch Hinweise im Internet und vielleicht Berichte von ehemaligen Patienten können hier sehr hilfreich sein (z. B. Gielen et al. 2005). Ein kurze Erklärung noch vorab: Über die Frage, ob man bloß von Verhaltenstherapie oder, wie viele meinen, unbedingt von Kognitiver Verhaltenstherapie sprechen sollte, kann man streiten. Verhaltenstherapie berücksichtigt seit langem alle Ebenen menschlicher Existenz, also das Verhalten, die körperliche Ebene und die Gedanken (Kognitionen). Alle Ebenen zusammengenommen erfassen auch Gefühle, Emotionen. Ich habe zur Notwendigkeit, sich zur Verhaltenstherapie aufzuraffen, einen Vergleich. Er hinkt zwar, aber trotzdem möchte ich ihn versuchen: Ich sollte fleißig Bewegung machen, auch im Freien, wegen der guten Luft! Das findet jedenfalls der Arzt. Ich selbst bin nicht so wahnsinnig begeistert davon. Zwei Stimmen sprechen in mir: »Daheim ist es warm, du könntest jetzt lesen, zeichnen, ein Mittagsschläfchen machen. Ob der Arzt überhaupt Recht hat? Woher weiß er, was mir gut tut?« Die andere Stimme sagt: »Sei nicht so träge, du weißt, hinterher hat dir das noch immer gut getan, du hast es nie bereut. Denk dran, was der Arzt 96
gesagt hat, dein Bewegungsapparat braucht das!« Wenn ich mich dann doch überwunden habe und unterwegs bin, am liebsten im nahen Wald, dann kann ich fast nicht verstehen, weshalb ich mich immer so dagegen gesträubt habe. Schon unterwegs merke ich, dass mir die Bewegung gut tut, obwohl ich mich oft beim Aufwärtsgehen plagen muss. So ist das halt bei uns im gebirgigen Tirol! Meistens bin ich sogar noch länger draußen, als ich mir zuvor auferlegt hatte. Und daheim angekommen, fühle ich mich wohler als vorher und bin zufrieden mit mir, weil ich wieder einmal meine Trägheit überwunden habe. Jetzt geht es um die Therapie. Die eine Stimme sagt: »Weißt du, was auf dich zukommt, wenn du in Therapie gehst? Das wird ein Therapeut oder eine Therapeutin sein, die du nicht kennst. Ob er oder sie dich überhaupt versteht? Eine Therapie könnte vielleicht zu schwer sein! Weiß Gott, ob sie hilft! Wer weiß, ob du den Erfolg halten kannst? Dir fehlt das Geld, du möchtest doch lieber die Wohnung verschönern. Dir fehlt die Zeit. Wolltest du nicht endlich einmal in Urlaub fahren? Lass dich auf nichts Unsicheres ein. Du kannst ja ein Selbsthilfebuch kaufen und selbst deine Therapie bestimmen.« Es gibt aber auch eine andere Stimme, die sagt: »Hast du nicht gelesen, was für Zwangskranke im Internet steht? (www.zwaenge.at, www.zwaenge de, www.zwang.ch). Da berichten doch Betroffene von der großen Erleichterung, weil sie sich zu einer Therapie entschlossen haben. Da kannst du dich informieren, Empfehlungen für kompetente Therapeuten nachlesen. Was ist wichtiger: eine schöne Wohnung oder ein schöneres Leben, nämlich ohne die massiven Einschränkungen durch den Zwang. Zwanghaft in einer schönen Wohnung, das ist doch nichts. Der Zwang wird dich im Urlaub begleiten. Mach dir nichts vor! Probier’s doch! Wer wagt, gewinnt!«
97
Vermeiden Ich möchte diesen Begriff ganz praktisch erklären. Waschzwang: »Ich geh lieber nicht in die Stadt. Ich könnte mir dort einen Zwang einfangen. Die Stadt ist so schmutzig.« Oder auch das Vermeiden in der Therapie: »Ich geh lieber nicht in die Stadt, denn wieder daheim angekommen, dürfte ich mir übungshalber nicht die Hände waschen. Das ist mir zu schwer.« Kontrollzwang, bevor ich aus dem Haus gehe: »Eigentlich würde mir noch eine feine Suppe gut tun. Aber dann brauche ich so lange für die Kontrollen. Muss ja nicht unbedingt sein, dass ich eine Suppe esse.« Das Vermeiden in der Therapie: »Eigentlich würde ich gern noch eine warme Suppe essen, bevor ich aus dem Haus gehe. Aber der Therapeut hat empfohlen, ich solle die Herdknöpfe nur einmal mit einem kurzen aufmerksamen Blick kontrollieren. Das ist mir zu unsicher, da könnte ich mich in der Stadt beunruhigen und das Bummeln nicht genießen. Lieber keine warme Suppe!« Achtung Zwangsfalle: Vermeiden bedeutet: Ich lasse da lieber etwas bleiben, das zu tun ich mir nicht zutraue. Damit kann ich nicht umgehen. Darf ich Ihnen dazu wieder einen gescheiten Spruch reichen? »Die Furcht zu fehlen ist die reichste Quelle von Fehlern.« Dieser kluge Satz stammt vom römischen Dichter Vergil. Das ist der, der die Irrfahrten des Äneas beschreibt. Was uns betrifft, so interessieren uns im Augenblick mehr die Irrfahrten, die uns der Zwang ständig bescheren möchte und die wir uns nicht mehr lange gefallen lassen wollen, nicht wahr?!
98
Vertrauen Das ist ein großes Wort in der Therapie. Vertrauen zur Therapie, auch wenn man den Erfolg und den Sinn der Therapie, vor allem zu Beginn, anzweifelt. Ich selbst dachte anfangs: »Diese Wohnung werde ich nie mehr in den Griff bekommen. Ich werde mich nie mehr so wohl und sicher in meiner Wohnung fühlen wie früher!« Vertrauen Sie – Therapie nimmt Ihnen nichts weg. Therapie gibt Ihnen etwas! Vertrauen zum Therapeuten, zur Therapeutin. Vertrauen zu sich selbst, mehr Vertrauen zu Ihren eigenen Fähigkeiten.
Vorlieben Darf ich mir persönliche Vorlieben bewahren, auch wenn besonders kritische Beobachter dahinter noch eine Haltung mit Tendenz zu früherer Zwanghaftigkeit vermuten könnten? Ich sage: Aber sicher dürfen Sie das. Therapie hilft vom Zwanghaften wegzukommen, aber völlig umkrempeln müssen Sie sich deshalb nicht. Ich mag zum Beispiel gern meine eigenen Bücher. Wenn ich eines (meist ungern) verleihe und ich bekomme es mit einem Knick im Blatt oder mit einem Fleck zurück, dann kann ich mich richtig ärgern mit dem Vorsatz: »Der oder die bekommt sicher kein Buch mehr von mir geliehen.« Ich mag auch lieber einen nagelneuen Euroschein; so einen glänzenden, der aussieht, als wäre er direkt aus der Geldpresse. Ich bevorzuge Hosen, die nicht die Straße fegen, obwohl das heute Mode ist. Und am Abend schaue ich vor dem Schlafengehen die Herdplatten nach, obwohl das meine Freundin und vielleicht viele andere nicht machen. Wenn ich per Bahn zu den Enkelkindern fahre, dann be99
nutze ich vor Abfahrt des Zuges lieber das WC von unserem erst kürzlich neu eröffneten Bahnhof als das im Zug. Die Grenze zwischen Normalität und Zwanghaftigkeit ist nicht so einfach zu ziehen: Wenn Sie durch Ihre Vorlieben so sehr beeinträchtigt und eingeschränkt sind, dass Sie Ihr Leben (in persönlicher, beruflicher und zwischenmenschlicher Hinsicht) nicht mehr so führen können, wie Sie das gern möchten, dann kann man möglicherweise von einer Störung oder einer Krankheit sprechen. Aber: Wenn ich müsste (um »am Ball« zu bleiben oder weil ich meiner nicht mehr so sicher bin), dann könnte ich auch ein Buch aus der Leihbücherei am Abend im Bett lesen (ich habe das mit der Zeitschrift der Straßenverkäufer geübt) und den Herd auch wieder einmal sich selbst überlassen. Trotz meines fortgeschrittenen Alters kann ich mich noch so ziemlich auf meine Automatik verlassen! Ich kann auch immer noch ein Zug-WC benutzen, obwohl ich seit den Übungen dort eindeutig genug davon habe. Denn die WCs der Bundesbahnen sind meist alles andere als neu und modern, da unterscheiden sich die einzelnen Länder nicht wesentlich. Trick: Ich benütze jetzt die WC der ersten Klasse, die sind (für gewöhnlich) akzeptabler. Vorlieben dürfen sein. »Normale« sind manchmal viel hygienebewusster und kontrollbedürftiger als ich. Ich muss nur ehrlich mir selbst gegenüber sein. Spüren, ob anderes Verhalten auch wieder einmal möglich ist und ob die Vorlieben nicht zum neuerlichen Zwangsverhalten verführen möchten. Ein Gespür müssen Sie sich bewahren für das, was Ihnen zum Aufrechterhalten Ihres Therapieerfolgs gut tut.
100
Warum? »Warum, weshalb habe ich diese Krankheit?« Das zu erfahren, ist wichtig in der Therapie, aber es ist nur ein Teil davon. Wieder anders handeln und denken lernen ist wohl noch wichtiger. Das ist das Ziel! Die ewige Suche nach dem Warum, nach einer möglichen Ursache, kann vielfach den Weg zu einer Besserung verstellen. Sie kann vielfach die Rolle der Vermeidung haben, wenn Patienten meinen, man müsse zunächst so lange suchen, bis man die Wurzel der Krankheit erkannt habe. Dabei ist die Zwangserkrankung in »guter Gesellschaft«: Für viele körperliche Erkrankungen gibt es bis heute keine Erklärung, auch der Hinweis auf »multifaktorielle Ursachen« ist nur ein Begriff, der erklärt und erläutert werden muss. Dennoch ist es durchaus sinnvoll, wenn Sie als Patient versuchen, gemeinsam mit Ihrem Therapeuten, ein plausibles Modell für die Entstehung zu entwickeln. Das kann Ihnen helfen, die Problematik einzuordnen, sich auf die Therapie einzulassen und frühzeitig selbst zu erkennen, wenn Warnzeichen beginnender Zwänge wieder auftreten. Darüber hinaus ist es das Gebot einer guten und transparenten Verhaltenstherapie, den Patienten als eine kompetente und mündige Person zu sehen.
Widerstand Der Widerstand von manchen Patienten gegen Übungsvorschläge in der Therapie kann für Therapeuten und Helfer zermürbend sein. Glauben Sie mir das! Sie haben es sehr schwer, aber machen Sie es Ihren Therapeutinnen und Therapeuten nicht zu schwer! 101
Wiederholungen Kennen Sie das? Wenn ich die Kaffeetasse hinstelle, dann muss ich einen guten Gedanken haben. Stelle ich die Tasse auf den Unterteller und der Zwang sagt dazu: »Die Mutter wird krank«, dann muss ich das Tassenhinstellen wiederholen. Also (mit Seufzen) noch einmal: Tasse hinstellen – das ist die Wiederholungshandlung. Dabei denken: »Die Mutter wird lange leben«, das gefällt dem Zwang. »Mutter neunzig«, damit ist er auch zufrieden. Nein, er ist doch nicht zufrieden, denn ich war unkonzentriert. Jemand hat gehustet, das hat mich drausgebracht. Also noch einmal … Ich habe mit einer Erkrankten telefoniert über die Wiederholungen, die zu nichts gut sind. Die Wiederholungen können nichts »gutmachen«. Es gibt ja auch nichts »gutzumachen«. Die Wiederholungen können keinen Einfluss auf Geschehnisse haben. Sie bringen nichts. Die Wiederholungen sind zwanghaft überzogener Aberglaube, wie das dreimal auf Holz klopfen. Wiederholungen sind Reaktionen auf Zwangsgedanken, auf Zwangsvorstellungen. Dabei gilt die gute alte Regel: Gedanken zulassen, keine Bedeutung beimessen, nicht durch ein Ritual drauf reagieren. Fein ausgedrückt: Es besteht keine Handlungsrelevanz. Ganz einfach ausgedrückt: »Ich muss nichts tun« (also auch nicht wiederholen). Ich war selbst sehr zwangskrank. Ich weiß, dass so allgemeine Erörterungen wie: »Sie sollten auf das Wiederholen verzichten« meiner Hilfesuchenden am Telefon viel zu mager sind. Sie will die Angelegenheit – sie ist eben noch Anfängerin in der Therapie – ganz genau besprochen haben. Es geht hier ganz speziell um das Nachttischlämpchen. Das plagt sie mit Wiederholungsansprüchen. Wenn sie am Abend zu Bett geht, wird ohnedies alles Zwanghafte noch dringlicher. Der Tag geht zu Ende, das ist ein Einschnitt, der sich bedeutend machen möchte. Jetzt entscheidet sich, ob der Tag letztendlich ein gutes Ende findet und ich mir 102
die Ruhe der Nacht gönnen darf. Ruhe gibt es erst nach dem letzten »geglückten« Ritual am Tag. Dann kann meine Betroffene am Telefon beruhigt einschlafen. Das alles wird besser werden, sie wird Fortschritte machen. Sie wird lernen, eine erfolgreiche Handlung gegen den Zwang auf eine nächste und wieder eine nächste zu übertragen! Noch ist sie nicht soweit. Sie will nur eins wissen: Darf ich das Nachttischlämpchen nur einmal ausknipsen, obwohl der Zwang sagt: »Der Freund wird verunglücken. Wiederhole!« Also Licht anschalten, wieder ausschalten. »Sie dürfen«, das will sie hören, und: »Wenn Sie anschließend das bekannte schlechte Gefühl haben, das sich noch einstellt, weil der Zwang unterwegs ist und nicht, weil etwas passiert, dann seien Sie stark (aushalten!). Nehmen Sie in Kauf, dass Sie vielleicht nicht recht einschlafen können. Denken Sie dran: Sie sind nicht verantwortungslos, weil Sie der Stimme des Zwangs nicht nachgeben. Im Gegenteil, das Nichtnachgeben ist wie eine gute Tat.« Es ist immer sehr schön, wenn sich am anderen Ende des Telefons Erleichterung breit macht. Wir vereinbaren, dass ich beim nächsten Gespräch, Tag und Stunde werden festgelegt, ganz speziell nach dem Nachttischlämpchen fragen werde. Die Unsicherheitskrankheit braucht so viel Helfen im Detail. Das wäre also ein weiteres Stichwort unter »U«. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon einiges geklärt, Zweifel und Unsicherheit gehen Arm in Arm!
Xylophon spielen (fällt Ihnen für das »X« etwas Besseres ein?), zeichnen, malen, singen, laufen, schreiben, sich für den Wiedereinstieg in den Beruf vorbereiten, eine Freundschaft suchen 103
(z. B. in Kursen), all das nimmt dem Zwang die Zeit, und das ist eine der großen Chancen, ihn wieder loszukriegen.
Y Zum »Y« fällt mir wirklich gar nichts ein! Mit dem »Y« plage ich mich schon seit Tagen herum. Somit ist mein Leitfaden von A bis Z nicht vollständig, das muss ich aushalten können!
Zeit Die Zeit arbeitet für Sie, wenn Sie sich an die Therapie halten. Es ist auch eine Frage der Zeit, neue gute Gewohnheiten einzuüben. Stellen Sie sich vor, Sie würden nur ganz einfach Ihre Besteckschublade umräumen. Sie können das auch wirklich ausprobieren: Bei mir liegen die Messer in der Schublade links, die Gabeln in der Mitte, die Löffel rechts. Wenn die drei jetzt einen Platzwechsel machen müssten, dann könnten zum Beispiel die Löffel in die Mitte wandern, die Messer kämen rechts zu liegen und die Gabeln links. Was glauben Sie, was sich jetzt bei mir abspielen würde? Wie lange bräuchte ich, um mich an diese veränderten Zustände zu gewöhnen? Und das in einer Angelegenheit, die mit keinerlei Befürchtungen verbunden ist. (Falls Sie erst zwanzig Jahre alt sind, würden Sie so eine Umstellung schneller in den Griff bekommen. Bei mir könnte das ganz schön dauern!) Das hat alles mit Lernen zu tun: Neue Gewohnheiten müssen sich neue Bahnungen in Ihrem Gehirn und in Ih104
rem Verhalten schaffen, und das braucht Zeit. In der Therapie lernen Sie, sich an Neues zu gewöhnen, das zunächst stark mit negativen Gefühlen verbunden ist. Das braucht Zeit und also auch Geduld mit sich selbst.
Zweifel Ich möchte den Begriff »Zweifel« in der eigentlich alphabetischen Folge der Stichwörter etwas vorreihen. Mein letzter Begriff beim Ratgeben soll ein schöner und Mut machender sein. Die Zwangskrankheit wird auch Zweifelkrankheit genannt, und zwar schon fast 200 Jahre lang. »Ist das richtig ausgedrückt oder für andere nicht ganz verständlich?«, »Ist das gut oder muss ich mich doch etwas schuldig fühlen?«, »Ist das sauber oder muss ich reinigen?«, »Ist das nur geschummelt oder bereits gelogen?«, »Kann das Unglück bewirken oder muss ich etwas dagegen tun?«, »Bin ich nicht ganz unschuldig oder kann ich ein ganz reines Gewissen haben?«, »Ist das eklig beziehungsweise krank machend oder ganz bedenkenlos?«, »Ist das jetzt wieder in Ordnung oder noch nicht ganz hundertprozentig?« So geht’s von früh bis spät! Lässigkeit oder Laisser-faire, das sind keine Eigenschaften der Zwangskranken. Ein wenig in diese Richtung gehen zu lernen, sollten Sie aber versuchen. Ich selbst muss auch noch dran arbeiten! Ich habe einmal bei mir daheim Handwerker gehabt. Sie sollten irgendetwas montieren und hatten Schwierigkeiten dabei. Sie haben sich echt bemüht. Aber plötzlich sagte einer, ohne zu realisieren, dass ich in der Nähe war und ihm zuhören konnte: »Jetzt hauen wir den Hut drauf!« Das haben sie dann auch getan! 105
Vielleicht könnten Sie das auch zum Modelllernen nehmen: Immer wieder einmal »den Hut drauf zu hauen«, wenn Sie zweifeln, ob der Herd aus ist oder der rote Fleck unbedenklich, ob beim Autofahren der kleine Rumpler vom Bierkasten im Kofferraum herrührt oder ob Sie vielleicht doch jemanden angefahren haben. Den Hut drauf hauen und abwarten, was passiert. Ich weiß, das schreibt sich leicht. Aber lassen Sie doch auch den Zorn zu. Sie haben einfach genug davon, Sie haben sozusagen die Nase voll davon, so vieles anzweifeln zu müssen. Beim Buchstaben »Z« erwarten Sie wohl sicher auch das Stichwort »Zwang«. So viel Bedeutung am Ende des Ratgebers würde den Zwang freuen! Nein, Zuversicht ist hier das schönere Wort.
Zuversicht Zuversicht, die dürfen Sie haben, und Mut, Motivation und Ernsthaftigkeit, Fleiß und Willen auf dem Weg zum Gesundwerden. Zuversicht, die wünsche ich allen Betroffenen sehr herzlich! Ihre Ulrike S.
106
Literatur Ambühl, H.; Meier, B. (2003): Zwang verstehen und behandeln. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutischer Zugang. Stuttgart. Fricke, S.; Hand, I. (2004): Zwangsstörungen verstehen und bewältigen. Hilfe zur Selbsthilfe. Bonn. Gielen, G.; Bracht, S.; Reinecker, H. (2005): Ich bezwinge meinen Zwang. Auseinandersetzung mit einem Waschzwang. Lengerich. Hoffmann, N. (1990): Wenn Zwänge das Leben einengen. Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Mannheim. Klepsch, R.; Wilcken, S. (1998): Zwangshandlungen und Zwangsgedanken. Wie Sie den inneren Teufelskreis durchbrechen. Stuttgart. Lakatos, A.; Reinecker, H. (2000): Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen. 2. Auflage. Göttingen. Reinecker, H. (1994): Zwänge. Diagnose, Theorien und Behandlung. 2. Auflage. Bern. Reinecker, H. (2006): Ratgeber Zwangsstörungen. Informationen für Betroffene und Angehörige. Göttingen. Ulrike S.; Crombach, G.; Reinecker, H. (2000): Der Weg aus der Zwangserkrankung. 4. Auflage. Göttingen. Ulrike S.; Crombach, G.; Reinecker, H. (2002): Hilfreiche Briefe an Zwangskranke. Göttingen.
107
Hilfen für Zwangskranke Ulrike S. / Gerhard Crombach / Hans Reinecker Der Weg aus der Zwangserkrankung
Ulrike S. / Gerhard Crombach / Hans Reinecker Hilfreiche Briefe an Zwangskranke
Bericht einer Betroffenen für ihre Leidensgefährten
2002. 179 Seiten, kartoniert ISBN 3-525-01465-1
Transparent, Band 34. 4. Auflage 2003. 122 Seiten, kartoniert. ISBN 3-525-01724-3 Ulrike S. schildert die Entstehung ihrer Zwänge und vor allem die vielen Einschränkungen, die mit der Krankheit verbunden sind – im Beruf, in der Partnerschaft, der Familie, dem sozialen Umfeld. Dann berichtet sie im Detail über die Schritte der Veränderung in der Verhaltenstherapie, heraus aus dem Gefängnis ihrer Zwänge zu einem normalen Leben. Gerhard Crombach, ihr Verhaltenstherapeut, erklärt die einzelnen Stufen ihrer Therapie aus seiner Sicht. Hans Reinecker stellt grundsätzliche Merkmale der Verhaltenstherapie von Zwangsstörungen dar. Das Buch macht Betroffenen Mut zur Therapie und zur Veränderung ihrer Lebenseinstellungen.
Ulrike S. hat eine Reihe von Briefen an Zwangskranke verfasst. Damit schließt sie an den Bericht ihrer eigenen Erkrankung und erfolgreichen Verhaltenstherapie in ihrem Buch »Der Weg aus der Zwangserkrankung« an. Die Briefe wenden sich an Betroffene und Angehörige. Sie vermitteln Mut und Optimismus in Situationen der Unentschlossenheit und Verzweiflung. Die Autorin richtet ihren Blick nicht auf die Problematik, sondern auf konkrete Handlungen, die in Richtung einer Lösung gehen können. Frau S. zeigt, wie gleichsinnige Bemühungen von Betroffenen, Angehörigen, Therapeuten und Kotherapeuten trotz Krankheit und Belastung eine Besserung ermöglichen. Die Psychotherapeuten Gerhard Crombach und Hans Reinecker kommentieren die Darstellung aus fachlicher Perspektive.



![ABC of Nutrition (ABC Series) [4 ed.]
0727916645, 9780727916648](https://dokumen.pub/img/200x200/abc-of-nutrition-abc-series-4nbsped-0727916645-9780727916648.jpg)